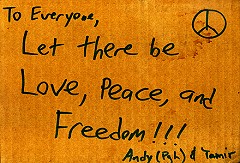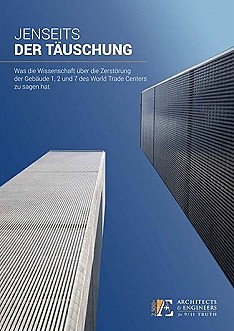SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Literatur
Aus dem Roman "Bitten der Vögel im Winter" (Auszug 2)
Berlin, 1936
Von Ute Bales
 Immer noch sind die großen Gebäude der Stadt beflaggt. Aber der Verkehr ist weniger geworden, in den vor Tagen noch überfüllten Bars und Restaurants gibt es wieder Platz, die Menschenknäuel haben sich aufgelöst. »Sie hätten zu den Wettkämpfen hier sein sollen«, sagt die alte Frau, die, kurzatmig und langsam, einen Schlüsselbund in der Hand, eine enge Treppe hinaufsteigt. »Was hier los war! Feste und Aufmärsche. Alles war geschmückt. Sogar die Schiffe auf der Spree. In der ganzen Gegend kein freies Zimmer. So was kann man sich gar nicht vorstellen. Also, wenn das immer so wäre, nee, nee, das wär nichts für mich.« Die junge Frau, die der alten folgt, sieht müde aus, hört nur mit halbem Ohr zu. Der Koffer, den sie trägt, ist schwer. Der Riemen der Reisetasche schneidet in die Schulter. Sie gehen einen langen Flur entlang, dann zwei, drei Stufen hinauf. »Ich wär schon gern im Olympiastadion gewesen«, sagt die Alte, »aber das ging ja nicht, wegen der vielen Arbeit. Unseren Führer hätt ich auch gern gesehn. Den Siegern hat er persönlich die Hand geschüttelt.« »Den Negern nicht«, sagt die Jüngere.
Immer noch sind die großen Gebäude der Stadt beflaggt. Aber der Verkehr ist weniger geworden, in den vor Tagen noch überfüllten Bars und Restaurants gibt es wieder Platz, die Menschenknäuel haben sich aufgelöst. »Sie hätten zu den Wettkämpfen hier sein sollen«, sagt die alte Frau, die, kurzatmig und langsam, einen Schlüsselbund in der Hand, eine enge Treppe hinaufsteigt. »Was hier los war! Feste und Aufmärsche. Alles war geschmückt. Sogar die Schiffe auf der Spree. In der ganzen Gegend kein freies Zimmer. So was kann man sich gar nicht vorstellen. Also, wenn das immer so wäre, nee, nee, das wär nichts für mich.« Die junge Frau, die der alten folgt, sieht müde aus, hört nur mit halbem Ohr zu. Der Koffer, den sie trägt, ist schwer. Der Riemen der Reisetasche schneidet in die Schulter. Sie gehen einen langen Flur entlang, dann zwei, drei Stufen hinauf. »Ich wär schon gern im Olympiastadion gewesen«, sagt die Alte, »aber das ging ja nicht, wegen der vielen Arbeit. Unseren Führer hätt ich auch gern gesehn. Den Siegern hat er persönlich die Hand geschüttelt.« »Den Negern nicht«, sagt die Jüngere.
»Ja, den Negern vielleicht nicht. Das muss er ja auch nicht. Dafür hat er aber dann doch noch Juden zugelassen. Die habens jetzt wieder besser. Das Schild an der Metzgerei ist verschwunden. Sah ja auch nicht gut aus: Juden raus. Was solln denn da die Fremden denken? Manche regen sich so drüber auf. Aber jetzt sieht man, es wird doch nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.« Die Alte bleibt vor einer Tür stehen, hantiert mit einem Schlüsselbund. »Seien Sie froh, dass Sie jetzt nach Berlin kommen. Es ist nicht lange her, da sahs hier anders aus. Ich komm aus nem Arbeiterviertel und kann Ihnen en Liedchen singen von Elend und Hunger.« Der zweite Schlüssel passt. Mit einem harten, scharrenden Geräusch geht die Tür auf. »Kommen Sie, kommen Sie, Fräulein Justin. Dr. Ritter persönlich hat die Wohnung begutachtet. Sehr gut hat sie ihm gefallen.
Ein feiner Mann. Die Miete für September hat er schon bezahlt.« Die Luft in der Wohnung ist abgestanden. Auf den ersten Blick wirkt alles düster: die Tapete, stockfleckig, mit einem verblichenen Blumenmuster, die dunklen Schränke, die schwarz gebeizten Türen. Nur durch die Ritzen der Fensterläden dringt Licht und sprenkelt den Fußboden mit gelben Flecken. Es gibt eine Küche mit fließendem Wasser, einem emaillierten Kohlenherd mit Gussfüßen, einem Tisch und drei Stühlen, einem hohen Schrank mit mittigen Schubladen. Eine Zinkwanne lehnt hochkant an der Wand. Zwei kleinere Durchgangsräume, Wohnzimmer und Schlafkammer, schließen sich an. Beide möbliert mit billigem, bestoßenem Inventar.
Die alte Frau öffnet das Fenster in der Küche und drückt die Läden auf. Helles Licht strömt herein und verändert die Farben. »Sehn Sie mal raus hier. Das hat Dr. Ritter so gut gefallen. Alles grün. Wie in einem Garten. Da hinten, da liegt der Fliegeberg. Da hat Otto Lilienthal seine ersten Flugversuche gemacht. Sie werden doch wohl von Lilienthal gehört haben?« Eine Antwort erwartet sie nicht, denn sie dreht sich um und hebt die Stimme. »Aber dass Sie mir auf die Möbel aufpassen! Dass Sie nu ja dran denken. Das war alles nicht billig. Geraucht wird auch nicht. Bleibt alles in den Vorhängen. Und wenn Sie nachts mal raus müssen, das Klo liegt auf dem Gang, nen halben Stock tiefer.« Die junge Frau antwortet nicht. Sie stellt Koffer und Tasche ab. Die Alte legt den Schlüssel auf die Fensterbank. »Jetzt machen Sie sich erstmal ein bisschen frisch. War ja ne weite Reise von Tübingen rauf. Sie müssen todmüde sein.«
Eva Justin ist froh, allein zu sein. Die Stunden im Zug waren lang und anstrengend, das Abteil voller Soldaten. Dreimal musste sie umsteigen, das Stück zwischen Hanau und Göttingen im Gang stehen. In der Küche lehnt sie sich aus dem Fenster. Es ist wirklich alles grün. Besonders in der Ferne. Die Straße sieht aus wie eine Allee, begrenzt von alten, hohen Eschen. Im Restaurant gegenüber stehen Tische und Stühle bis auf den Gehweg. Kellner balancieren volle Tabletts. An der Ecke geigt ein Musiker. Greta Garbo lächelt von einem Plakat. Vor der Garbo winkt ein Mann nach einem Taxi. Er hat Schläfenlocken und ein schwarzes Käppchen auf dem Kopf. Sie schließt das Fenster und trägt den Koffer ins Schlafzimmer. Leicht in die Knie gehen muss sie, um sich in dem kleinen Spiegel, der an der Wand hängt, sehen zu können. Der Spiegel wirft das Bild einer jungen, streng aussehenden Frau zurück. Die rotblonden Haare, halblang und leicht lockig, in der Mitte gescheitelt, sind von einem Hut verdrückt. Das Gesicht ist blass, wie es Rothaarigen eigen ist; Wimpern und Augenbrauen um die hellen Augen sind kaum sichtbar. Sie fährt sich durch die Haare, öffnet die Jacke eines kragenlosen, braunmelierten Kostüms, streift sie ab und hängt sie auf einen Bügel. Dann stellt sie den Koffer auf das Bett und räumt die Kleider in den Schrank. Sie ordnet exakt und lässt sich Zeit. Millimetergenau legt sie Handtücher aufeinander und faltet die Wäsche auf Kante.
Früher, in der Volksschule, hat sie Bilder großer deutscher Städte gesehen: Hamburg mit dem Hafen, vom Kehrwieder aus fotografiert, München mit dem Marienplatz, Köln mit dem Dom. Am schönsten fand sie die Bilder von Berlin. Eines ist ihr im Kopf geblieben. Es war ein Foto der Kreuzung Friedrichstraße/Unter den Linden. Mit modisch gekleideten Leuten, denen man die Großstadt ansah, Straßenbahnen, teuren Autos, teuren Geschäften.
Immer hat sie an Berlin gedacht wie an etwas Mächtiges, Großes. Etwas mit Sog. Sie hat an diese Stadt gedacht wie an einen magischen Ort der Möglichkeiten: Hauptstadt des erneuerten Reichs, eine brodelnde Metropole mit Weltflair. Berlin wird eine der bedeutendsten Städte der Welt werden. Alle sagen das. Dass sie gerade jetzt in diese Stadt kommt, hat etwas zu bedeuten.
Sie breitet einen Stadtplan auf dem Bett aus, fährt mit dem Finger über Straßen und Plätze. Die Friedrichstraße mit den Bars und den Tanzlokalen dürfte nur knapp einen Kilometer entfernt liegen. Sie stellt sich vor, wie Leute zu den neuesten Varieténummern in den Wintergarten oder die Scala strömen, wie sie bei Tanzvergnügungen Sektgläser heben und sich zuprosten. Aber da wird sie nicht dabei sein. Sie ist nicht gekommen, um sich zu amüsieren.
Gegen Abend verlässt sie das Haus. In der Nähe des Viktoriaparks steigt sie in eine Straßenbahn. Sie fährt bis Kurfürstendamm. Die Straße ist dickflüssig von hastenden und lärmenden Menschen. Cafés, Restaurants und Bars reihen sich aneinander. Das Verkehrsgewühl der Autos, Doppeldeckerbusse und Pferdefuhrwerke vibriert. Eine rollende, von Eseln gezogene Litfaßsäule, auf der Plakate eine Revue ankündigen, bewegt sich vorwärts wie ein Koloss. Die Straßencafés sind gut besetzt, die Schaufenster hell erleuchtet. Aus einem Meer ständig aufflammender und wieder verlöschender Lichtreklamen sticht eine heraus: Scharlachberg Meisterbrand. Der Abend ist lau, das braune Kostüm fast zu warm. Vor einem Modehaus flattert eine Fahne mit olympischen Ringen, dahinter, die komplette Straße entlang, fast an jedem Haus, lange rote Fahnen mit schwarzen Hakenkreuzen in weißem Kreis.
An einer Kreuzung bleibt sie stehen, im Rücken das Licht der Werbetafeln von Dunlop und C&A. Sie überfliegt die Titelseite der neuesten Ausgabe des Stürmers, die in einem Zeitungskasten aushängt: »Wer den Juden kennt, kennt den Teufel.«
An einer Laterne lehnt ein Kriegsversehrter. Er stützt sich auf Krücken. Sein linkes Hosenbein ist ab dem Knie, offensichtlich über einem Stumpf, eingeschlagen. Sie befürchtet, dass er betteln könnte und wendet sich ab.
Da bremst ein Taxi auf dem Gehweg, ein Mann steigt aus, lacht und breitet die Arme aus. »Eva! Willkommen in Berlin! Hoffentlich hab ich dich nicht warten lassen!« Er umarmt sie, hakt sich bei ihr ein, fragt nach ihrer Reise und wie sie die Wohnung findet, will wissen, ob sie Hunger hat und vielleicht Lust, anderentags das olympische Dorf zu besichtigen. Sie gehen die Straße hinunter. Der Mann ist einen Kopf größer als sie, trägt einen lässigen Sakkoanzug mit einer gerade geschnittenen, weiten Hose. Sein Haar wird von einem breiten Hut verdeckt.
Sie entdecken einen freien Platz in einem Café in der Rankestraße, drängen an einer lauten Reisegruppe vorbei, setzen sich an einen Tisch unter einer Kastanie und bestellen bei einem schwitzenden Kellner zwei Kaffee mit Milch. »Eigentlich hätten wir Sekt bestellen sollen. Wo du doch Geburtstag hattest«, sagt er und flüstert ihr Geburtstagswünsche ins Ohr. »26 Jahre. Als ich 26 war, habe ich promoviert. Das ist zehn Jahre her. Und jetzt bin ich da, wo ich immer hinwollte. Wie gings denn noch in Tübingen?« Sie erzählt von ihrer Arbeit, von den letzten Wochen in der Klinik, wo sie bis vor ein paar Monaten zusammen gearbeitet haben. Er ist voller Ideen und Tatendrang für seine neue Stelle, für die er seit April freigestellt ist, erklärt ihr, was er vorhat, was er ändern will, wo er Chancen sieht. Seinen Hut hat er vor sich auf den Tisch gelegt. Er trägt die braunen, früh schon lichten Haare zurückgekämmt und mit Pomade geglättet.
Seine ständig hochgezogene linke Augenbraue hat etwas Überlegenes, auch das energische Kinn mit den schwarzen Bartstoppeln, die selbst nach der Rasur dunkle Schatten auf der Haut zurücklassen. Es ist nicht lange her, dass sie ihn zum ersten Mal gesehen hat. Etwas mehr als zwei Jahre. Sie war Teilnehmerin an einem Lehrgang des Roten Kreuzes für Krankenschwestern und er Oberarzt an der Universitätsnervenklinik in Tübingen. Mit ein paar losen Zetteln in der Hand hatte er an einem Pult gestanden, über vererbte Merkmale bei Erbsenpflanzen gesprochen und sie mit seiner weichen Stimme eingehüllt wie in eine Decke.
Jetzt, mitten in Berlin, unter der Kastanie, hat sie ihn endlich ganz für sich: Dr. Robert Ritter. Wenn sie allein sind, sagt er Du zu ihr. Wenn Leute dabei sind, nennt er sie Fräulein Justin. Alles an ihm gefällt ihr. Die Art, wie er sich bewegt, wie er sie ansieht, wie er redet. Auch die Energie, die von ihm ausgeht. »Tübingen war schön und gut. Aber Berlin ist eben doch was anderes. Wir werden forschen, forschen, forschen. Das, was wir immer wollten.« Er streichelt ihre Hand und flüstert: »Eigentlich wollte ich es dir schreiben, aber dann dachte ich, dass es besser ist, wenn ich es dir persönlich sage. Aber vielleicht weißt du es ja auch schon.« Er macht eine bedeutsame Pause und sieht sie an. »Vor ein paar Wochen haben sie die Zigeuner zusammengeführt. Wegen der Olympischen Spiele und wegen des Stadtbildes. Mit Betteln und Herumlungern ist endgültig Schluss. Sie hatten sich ja auch überall ausgebreitet. Die Leute sind froh, dass die Schandflecken verschwinden. Jetzt sind sie auf einem Rastplatz untergebracht. Marzahn. Ein Außenbezirk. Du wirst dort ganz schön was zu tun bekommen.« Robert Ritter grinst und zieht einen Zeitungsausschnitt aus der Tasche seines Sakkos. »Lief wie am Schnürchen. War sehr gut organisiert. Ein riesiges Polizeiaufgebot.
«Er dämpft die Stimme, während er den Zeitungsausschnitt auf dem Tisch auffaltet: »Seit Maria Theresia versucht man der Rumtreiberei Herr zu werden. Bismarck hat sie zur Plage erklärt, sämtliche Parteien im Kaiserreich waren sich einig. Jede Menge Verordnungen gab es. Alles zwecklos, weil die Gemeinden bloß immer wieder versucht haben, sie loszuwerden, statt sie festzusetzen und zu kontrollieren. Aber jetzt werden neue Wege beschritten. So wie der Führer die Judenfrage lösen wird, so wird er auch die Zigeunerfrage regeln.
Marzahn ist der erste Schritt. Dort sind sie isoliert und wir haben sie unter Kontrolle.« Er schiebt den Ausschnitt aus dem Berliner Lokal-Anzeiger in Evas Richtung und während sie die Schlagzeile überfliegt, kramt er in seiner Tasche, zündet sich eine Zigarette an, beugt sich vor und flüstert: »Der lustige Zug ging mitten durch Berlin. Eskortiert von Polizei natürlich. Über 600 haben sie aufgespürt. Aus allen Winkeln kamen sie: Alexanderplatz, Scheunenviertel, Wedding, Prenzlauer Berg. Auch von außerhalb. Über 100 Planwagen haben sie abgeschleppt und die Wohnbaracken auf Tieflader gehievt. Wenn du die Leute fragst, sie sind alle erleichtert.«
Er lehnt sich zurück, zieht an der Zigarette, inhaliert den Rauch und spricht wieder lauter. »Man muss aber auch sagen, dass es in Marzahn besser ist als anderswo. Die Kinder werden Unterricht bekommen, für die Jugend soll einiges getan werden. Waschplätze gibt es auch. Das Wohlfahrtsamt unterstützt die Sache. Alles natürlich im Einvernehmen mit dem Rassenpolitischen Amt der Gauleitung. Mit den Einweisungen nach Marzahn haben wir vorerst nichts zu tun. Da ist die Zigeunerdienststelle im Polizeipräsidium zuständig. Die sammeln alle ein, die in der Stadt herumlungern. Wir erfassen sie dann. Du wirst allerdings vorher nochmals auf Reisen gehen. Ab Januar ist dann Marzahn angesagt. Also noch ein wenig Geduld. Die Zeit solltest du nutzen, um zumindest ein paar Brocken Romanes zu lernen. Ich mache das auch. Seit ein paar Tagen nehme ich Stunden bei einem Sprachwissenschaftler.«
Sie nickt. Er sieht glücklich aus, denkt sie und sieht ihm zu, wie er die Zigarette zwischen Zeigefinger und Mittelfinger bewegt und mit dem Daumen auf den Filter tippt, um die Asche wegzuschnippen. Das einzige, das ihr zu schaffen macht, ist, dass er sie auf Reisen schicken will und sie sich also kaum sehen werden. Aber das sagt sie nicht.
Am Nebentisch hat sich eine Herrenrunde zusammengefunden. Alles dreht sich um die Olympischen Spiele. Ein schwergewichtiger Mann, dessen Zigarre Ringe in der Luft hinterlässt, erklärt mit der Miene eines Menschen, der sich auskennt, dass das große Geschick eines Läufers darin bestehe, leicht und beweglich zu sein, dabei stur vor sich hin zu sehen, sich von nichts ablenken zu lassen, einfach zu rennen, wie ein Pferd mit Scheuklappen.
»Man hört von nichts anderem«, sagt Eva, »auch im Zug hatten die Leute kein anderes Thema. Also, dass Sport so eine Begeisterung auslösen kann?« Sie nippt am Kaffee, der ein bisschen zu heiß ist. Der Dicke vom Nebentisch hat Evas Bemerkung mitbekommen und dreht sich nach ihr um: »Sie waren wohl nicht dabei, gnädge Frau? Die Leute waren wie verrückt. Wann passiert so was schon mal? 33 Goldmedaillen. Also, wer das nicht erlebt hat. Schon die Eröffnung. Ein Zeppelin kreiste, und stellen Sie sich vor, sogar die Franzosen haben den Deutschen Gruß entboten! Plötzlich sind Tausende von Tauben aufgestiegen. Dann Kanonenschüsse. Und wissen Sie, was dann passiert ist?« Er schlägt sich auf die Schenkel und lässt ein kolleriges Lachen los. »Die Vögel haben vor Schreck angefangen zu scheißen!« Er dreht sich nach Eva um: »Verzeihen Sie, Madame, aber so war es. Alles über die Köpfe der Leute. Bei den Männern ging es ja noch, die meisten tragen ja Hüte. Aber die Damen! Die hatten das alles in den Haaren kleben!« Er wiehert, hebt das Glas und trinkt. Dann wischt er sich den Bierschaum von den Lippen.
»Tja, daran hat der Führer wohl nicht gedacht. An alles kann er ja auch nicht denken. Aber 33 Goldmedaillen – das muss uns erstmal einer nachmachen. Die Amerikaner habens nur auf 24 gebracht.« »Trotzdem hatten sie den besten Mann im Rennen.« Ein kleiner Mann mit einer goldgeränderten Brille beugt sich vor: »Ich sag nur Owens. Jesse Owens. Unglaublich, der Kerl! Wie eine Wildkatze aus dem Dschungel. Vier Goldmedaillen hat er abgeräumt. Schwarz wie die Nacht war der. Ich habs selbst gesehn. Aber wie ne Gazelle! Long hat ihn umarmt. Also, ich wüsste nicht, ob ich so einen Neger umarmen könnte.« Der Dicke sieht nach Eva, aber sie beachtet ihn nicht. »Erzähl mir mehr über Marzahn«, bittet sie und rückt mit ihrem Stuhl näher an Robert heran. Robert will etwas sagen, aber der Dicke übertönt seine Antwort: »Owens hin oder her. Unsere Sportler sind auch nicht schlecht. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl! Natürlich keine Dschungelaffen, das natürlich nicht.« Robert sieht verärgert hinüber. »Ihre Wettkämpfe interessieren uns nicht. Wenn Sie also etwas leiser sein könnten, wir möchten uns unterhalten.« Der Dicke reagiert mit einem wütenden Blick. Abrupt dreht er seinen Stuhl und setzt sich mit dem Rücken zu Eva.
Provokant bläst er seinen Rauch in Roberts Richtung. »Sollen wir woanders hingehn?«, fragt Robert, als das Gespräch am Nebentisch wieder auf die Olympischen Spiele kommt, aber sie schüttelt den Kopf. Während sie reden, wandert ihr Blick immer wieder zu dem Mann mit der Goldbrille, dessen Stimme anschwillt, bis er schließlich mit der Faust auf den Tisch schlägt: »Ihr könnt alle von Glück reden, dass die Spiele überhaupt stattgefunden haben. Diese miese Auslandspresse! Die schreiben über Deutschland genau das, was die Exilanten loslassen. In Spanien kritisieren sie die Methoden des Führers, das sei zu rabiat, Zwangsarbeit und so weiter, auch das mit den Juden. Sie schreiben, dass der Führer einen Krieg vorbereitet, dass die Propaganda verlogen und ihm die olympische Idee völlig egal ist.« Eva sieht, wie der Dicke rot anläuft. »Ausgerechnet Spanien kann es sich absolut nicht leisten, unsere Regierung zu kritisieren. Die haben genug mit sich zu tun. Ich wette drauf, dass der Führer dort noch eingreifen wird und dann können sie froh sein …« Der mit der Brille fällt ihm ins Wort. »Ich hab gehört, dass die griechischen Kommunisten den Fackellauf aufhalten, ja sogar die Fackel löschen wollten, um ein Zeichen zu setzen.« Robert schrammt den Stuhl zurück und setzt den Hut auf. »Das ist ja nicht zum Aushalten. Gehn wir, Fräulein Justin.«
Ute Bales: Bitten der Vögel im Winter

Roman, Rhein-Mosel-Verlag, Zell, 2018, 410 Seiten, Hardcover, 22,80 Euro
Pressetext zum Buch
Es braucht Mut, einen Roman aus der Perspektive einer NS-Täterin zu schreiben und Ute Bales ist mehrfach gewarnt worden. Sie hat es trotzdem getan und beschreibt in ihrem neuen Werk „Bitten der Vögel im Winter“ ein tiefdunkles Kapitel der deutschen Geschichte, über das bis heute weitgehend geschwiegen wird. Es geht um die Verfolgung der Sinti und Roma und es geht um Eva Justin, eine der bekanntesten „Rassenforscherinnen“ zur Zeit des Nationalsozialismus.
Es ist ein aufwühlender Roman, der kontrovers diskutiert wird. Die Hauptfigur, Eva Justin, ist grotesk, widersprüchlich, ungeheuerlich. Ute Bales erzählt von Selektionen in Jugendgefängnissen, von nächtlichen Übergriffen auf Lagerinsassen, von Kinderspielen, die über Leben und Tod entscheiden. Eva Justin ist keine Phantasiefigur. Sie bewegt sich auf einem gut recherchierten, historischen Terrain. Orte und Personen, die unfassbaren Verbrechen und die damit verbundenen administrativen Vorgehensweisen hat es wirklich gegeben. Historische, politische und psychologische Ebenen verschmelzen: Was ist der Mensch und warum wird er zum Täter?
Eva Justin wurde im Kaiserreich geboren. Ute Bales schildert deren Kindheit, die strenge Erziehung und den schon früh auffälligen Drang, alles zu sortieren und zu ordnen. Hier mögen die Wurzeln liegen für ihre spätere monströse Aufgabe im Nazi-Reich.
Als junge Frau nimmt Justin an einem Lehrgang für Krankenschwestern in Tübingen teil und lernt dort Dr. Robert Ritter kennen, Oberarzt mit besten Karriereaussichten, verheiratet. An Ritter ist nichts zufällig, nichts nebensächlich. Sie ist bereit, als er fragt, ob sie seine Arbeit unterstützen will. Saubere Menschen sind sein Ziel. Eine „Rasse“ ohne Makel. Von Anfang an teilt Justin seine Lust zu forschen, unterstützt seine Arbeit und geht bald eine Beziehung mit ihm ein, die in ein sexuelles Abhängigkeitsverhältnis führt, das als Analogie der Abhängigkeit der Deutschen zu Hitler gelesen werden kann. Konsequent tut Justin das, was Ritter sagt, hinterfragt nichts, sieht weg, wo es heikel wird, verbeugt sich vor jedem seiner Worte.
1936 folgt sie ihm nach Berlin, wo er zum Leiter der „Rassenhygienischen Forschungsstelle im Reichsgesundheitsamt“ berufen wird. Die Forschungsstelle befasst sich hauptsächlich mit „Zigeuner-Gutachten“. Im Rahmen großangelegter Aktionen zur „Bekämpfung der Zigeunerplage“ vermessen, verhören und klassifizieren die Arbeitsgruppen, zu denen Eva Justin gehört, Tausende Sinti und Roma und legen „Sippenarchive“ an. Justins Verhältnis zu Ritter führt dazu, dass sie ein immenses Arbeitstempo an den Tag legt. Sie glaubt einer großen Bewegung anzugehören, Teil einer gleichgesinnten Gemeinschaft zu sein.
1937 beginnt sie, auf Ritters Wunsch hin, neben ihrer Tätigkeit als „Rassenforscherin“, ein Studium der Anthropologie und macht sich auf dem „Zigeunerrastplatz“ Berlin-Marzahn, wo immer mehr Sinti und Roma konzentriert werden, bald einen Namen als „Zigeuner-Expertin“. Die Gutachten, die sie und die Kollegen verfassen, dienen als Grundlage, Sinti und Roma in Lager zu deportieren, wo sie entwürdigt, gefoltert, verstümmelt und ermordet werden.
Um die Gutachten aufzuwerten, verlangt Ritter, dass Justin eine Doktorarbeit schreiben soll. Er hat Bedenken, die massenhaften Bewertungen, die Todesurteilen gleichkommen, von einer Studentin unterschreiben zu lassen. Obwohl Justin kein abgeschlossenes Studium vorweisen kann, wird sie mithilfe seiner einflussreichen Kollegen zur Promotion zugelassen. In ihrer Arbeit untersucht sie, inwiefern „Zigeunerkinder“ erziehbar sind oder nicht. 1942 reist sie zu diesem Zweck ins schwäbische Mulfingen, wo ihr in einem katholischen Kinderheim 40 Sinti-Kinder zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt werden. Die Heimkinder bleiben so lange von der „Endlösung“ verschont, wie sie Justin als Versuchsobjekte nützen. Nach Abschluss der Doktorarbeit werden sie der SS übergeben und nach Auschwitz ausgewiesen.
Bei allem, was sie tut, bleibt Justin unzugänglich und kalt. Nur Ritter gegenüber zeigt sie Gefühl. Erbarmungslos reißt sie Familien auseinander, lässt Leute verhaften und Frauen, wenn sie nicht spuren, die Haare abschneiden. Sie weiß, was sie tut. Fassungslos verfolgt man, wie sie Kinder aushorcht, Leute denunziert, eine Schwangere zur Zwangsabtreibung schickt. Bei alldem begreift Justin nicht, dass alle angeblichen Eigenschaften, die sie den „Zigeunern“ zuschreibt – Dummheit, Gemeinheit, Schwachheit – ihre eigenen Eigenschaften sind.
„Bitten der Vögel im Winter“ erinnert eindrücklich an die mörderische Politik der NS-Zeit, die auf Basis einer verheerenden Rassenideologie unter anderem zur Vernichtung von mehr als 500.000 Sinti, Roma und Jenischen in Deutschland und Europa führte.

Ute Bales, 1961 in der Eifel geboren und dort aufgewachsen, studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Kunst in Giessen und Freiburg, wo sie seither lebt und arbeitet. Sie ist Mitglied im Literaturwerk Rheinland-Pfalz-Saar e.V., im Literarischen Verein der Pfalz, im Literatur Forum Südwest e.V. Freiburg, gehört dem Kunstverein Weißenseifen/Eifel an sowie der Künstlergruppe SternwARTe Daun. Sie hat bisher sieben Romane veröffentlich sowie zahlreiche Kurzgeschichten und Essays. Der Roman „Bitten der Vögel im Winter“ ist mit dem Martha-Saalfeld-Förderpreis 2018 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.
Siehe auch:
Auszug 1
Kinderheim Mulfingen, 1942
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=25728
Online-Flyer Nr. 697 vom 20.03.2019
Druckversion
Literatur
Aus dem Roman "Bitten der Vögel im Winter" (Auszug 2)
Berlin, 1936
Von Ute Bales
 Immer noch sind die großen Gebäude der Stadt beflaggt. Aber der Verkehr ist weniger geworden, in den vor Tagen noch überfüllten Bars und Restaurants gibt es wieder Platz, die Menschenknäuel haben sich aufgelöst. »Sie hätten zu den Wettkämpfen hier sein sollen«, sagt die alte Frau, die, kurzatmig und langsam, einen Schlüsselbund in der Hand, eine enge Treppe hinaufsteigt. »Was hier los war! Feste und Aufmärsche. Alles war geschmückt. Sogar die Schiffe auf der Spree. In der ganzen Gegend kein freies Zimmer. So was kann man sich gar nicht vorstellen. Also, wenn das immer so wäre, nee, nee, das wär nichts für mich.« Die junge Frau, die der alten folgt, sieht müde aus, hört nur mit halbem Ohr zu. Der Koffer, den sie trägt, ist schwer. Der Riemen der Reisetasche schneidet in die Schulter. Sie gehen einen langen Flur entlang, dann zwei, drei Stufen hinauf. »Ich wär schon gern im Olympiastadion gewesen«, sagt die Alte, »aber das ging ja nicht, wegen der vielen Arbeit. Unseren Führer hätt ich auch gern gesehn. Den Siegern hat er persönlich die Hand geschüttelt.« »Den Negern nicht«, sagt die Jüngere.
Immer noch sind die großen Gebäude der Stadt beflaggt. Aber der Verkehr ist weniger geworden, in den vor Tagen noch überfüllten Bars und Restaurants gibt es wieder Platz, die Menschenknäuel haben sich aufgelöst. »Sie hätten zu den Wettkämpfen hier sein sollen«, sagt die alte Frau, die, kurzatmig und langsam, einen Schlüsselbund in der Hand, eine enge Treppe hinaufsteigt. »Was hier los war! Feste und Aufmärsche. Alles war geschmückt. Sogar die Schiffe auf der Spree. In der ganzen Gegend kein freies Zimmer. So was kann man sich gar nicht vorstellen. Also, wenn das immer so wäre, nee, nee, das wär nichts für mich.« Die junge Frau, die der alten folgt, sieht müde aus, hört nur mit halbem Ohr zu. Der Koffer, den sie trägt, ist schwer. Der Riemen der Reisetasche schneidet in die Schulter. Sie gehen einen langen Flur entlang, dann zwei, drei Stufen hinauf. »Ich wär schon gern im Olympiastadion gewesen«, sagt die Alte, »aber das ging ja nicht, wegen der vielen Arbeit. Unseren Führer hätt ich auch gern gesehn. Den Siegern hat er persönlich die Hand geschüttelt.« »Den Negern nicht«, sagt die Jüngere.»Ja, den Negern vielleicht nicht. Das muss er ja auch nicht. Dafür hat er aber dann doch noch Juden zugelassen. Die habens jetzt wieder besser. Das Schild an der Metzgerei ist verschwunden. Sah ja auch nicht gut aus: Juden raus. Was solln denn da die Fremden denken? Manche regen sich so drüber auf. Aber jetzt sieht man, es wird doch nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.« Die Alte bleibt vor einer Tür stehen, hantiert mit einem Schlüsselbund. »Seien Sie froh, dass Sie jetzt nach Berlin kommen. Es ist nicht lange her, da sahs hier anders aus. Ich komm aus nem Arbeiterviertel und kann Ihnen en Liedchen singen von Elend und Hunger.« Der zweite Schlüssel passt. Mit einem harten, scharrenden Geräusch geht die Tür auf. »Kommen Sie, kommen Sie, Fräulein Justin. Dr. Ritter persönlich hat die Wohnung begutachtet. Sehr gut hat sie ihm gefallen.
Ein feiner Mann. Die Miete für September hat er schon bezahlt.« Die Luft in der Wohnung ist abgestanden. Auf den ersten Blick wirkt alles düster: die Tapete, stockfleckig, mit einem verblichenen Blumenmuster, die dunklen Schränke, die schwarz gebeizten Türen. Nur durch die Ritzen der Fensterläden dringt Licht und sprenkelt den Fußboden mit gelben Flecken. Es gibt eine Küche mit fließendem Wasser, einem emaillierten Kohlenherd mit Gussfüßen, einem Tisch und drei Stühlen, einem hohen Schrank mit mittigen Schubladen. Eine Zinkwanne lehnt hochkant an der Wand. Zwei kleinere Durchgangsräume, Wohnzimmer und Schlafkammer, schließen sich an. Beide möbliert mit billigem, bestoßenem Inventar.
Die alte Frau öffnet das Fenster in der Küche und drückt die Läden auf. Helles Licht strömt herein und verändert die Farben. »Sehn Sie mal raus hier. Das hat Dr. Ritter so gut gefallen. Alles grün. Wie in einem Garten. Da hinten, da liegt der Fliegeberg. Da hat Otto Lilienthal seine ersten Flugversuche gemacht. Sie werden doch wohl von Lilienthal gehört haben?« Eine Antwort erwartet sie nicht, denn sie dreht sich um und hebt die Stimme. »Aber dass Sie mir auf die Möbel aufpassen! Dass Sie nu ja dran denken. Das war alles nicht billig. Geraucht wird auch nicht. Bleibt alles in den Vorhängen. Und wenn Sie nachts mal raus müssen, das Klo liegt auf dem Gang, nen halben Stock tiefer.« Die junge Frau antwortet nicht. Sie stellt Koffer und Tasche ab. Die Alte legt den Schlüssel auf die Fensterbank. »Jetzt machen Sie sich erstmal ein bisschen frisch. War ja ne weite Reise von Tübingen rauf. Sie müssen todmüde sein.«
Eva Justin ist froh, allein zu sein. Die Stunden im Zug waren lang und anstrengend, das Abteil voller Soldaten. Dreimal musste sie umsteigen, das Stück zwischen Hanau und Göttingen im Gang stehen. In der Küche lehnt sie sich aus dem Fenster. Es ist wirklich alles grün. Besonders in der Ferne. Die Straße sieht aus wie eine Allee, begrenzt von alten, hohen Eschen. Im Restaurant gegenüber stehen Tische und Stühle bis auf den Gehweg. Kellner balancieren volle Tabletts. An der Ecke geigt ein Musiker. Greta Garbo lächelt von einem Plakat. Vor der Garbo winkt ein Mann nach einem Taxi. Er hat Schläfenlocken und ein schwarzes Käppchen auf dem Kopf. Sie schließt das Fenster und trägt den Koffer ins Schlafzimmer. Leicht in die Knie gehen muss sie, um sich in dem kleinen Spiegel, der an der Wand hängt, sehen zu können. Der Spiegel wirft das Bild einer jungen, streng aussehenden Frau zurück. Die rotblonden Haare, halblang und leicht lockig, in der Mitte gescheitelt, sind von einem Hut verdrückt. Das Gesicht ist blass, wie es Rothaarigen eigen ist; Wimpern und Augenbrauen um die hellen Augen sind kaum sichtbar. Sie fährt sich durch die Haare, öffnet die Jacke eines kragenlosen, braunmelierten Kostüms, streift sie ab und hängt sie auf einen Bügel. Dann stellt sie den Koffer auf das Bett und räumt die Kleider in den Schrank. Sie ordnet exakt und lässt sich Zeit. Millimetergenau legt sie Handtücher aufeinander und faltet die Wäsche auf Kante.
Früher, in der Volksschule, hat sie Bilder großer deutscher Städte gesehen: Hamburg mit dem Hafen, vom Kehrwieder aus fotografiert, München mit dem Marienplatz, Köln mit dem Dom. Am schönsten fand sie die Bilder von Berlin. Eines ist ihr im Kopf geblieben. Es war ein Foto der Kreuzung Friedrichstraße/Unter den Linden. Mit modisch gekleideten Leuten, denen man die Großstadt ansah, Straßenbahnen, teuren Autos, teuren Geschäften.
Immer hat sie an Berlin gedacht wie an etwas Mächtiges, Großes. Etwas mit Sog. Sie hat an diese Stadt gedacht wie an einen magischen Ort der Möglichkeiten: Hauptstadt des erneuerten Reichs, eine brodelnde Metropole mit Weltflair. Berlin wird eine der bedeutendsten Städte der Welt werden. Alle sagen das. Dass sie gerade jetzt in diese Stadt kommt, hat etwas zu bedeuten.
Sie breitet einen Stadtplan auf dem Bett aus, fährt mit dem Finger über Straßen und Plätze. Die Friedrichstraße mit den Bars und den Tanzlokalen dürfte nur knapp einen Kilometer entfernt liegen. Sie stellt sich vor, wie Leute zu den neuesten Varieténummern in den Wintergarten oder die Scala strömen, wie sie bei Tanzvergnügungen Sektgläser heben und sich zuprosten. Aber da wird sie nicht dabei sein. Sie ist nicht gekommen, um sich zu amüsieren.
Gegen Abend verlässt sie das Haus. In der Nähe des Viktoriaparks steigt sie in eine Straßenbahn. Sie fährt bis Kurfürstendamm. Die Straße ist dickflüssig von hastenden und lärmenden Menschen. Cafés, Restaurants und Bars reihen sich aneinander. Das Verkehrsgewühl der Autos, Doppeldeckerbusse und Pferdefuhrwerke vibriert. Eine rollende, von Eseln gezogene Litfaßsäule, auf der Plakate eine Revue ankündigen, bewegt sich vorwärts wie ein Koloss. Die Straßencafés sind gut besetzt, die Schaufenster hell erleuchtet. Aus einem Meer ständig aufflammender und wieder verlöschender Lichtreklamen sticht eine heraus: Scharlachberg Meisterbrand. Der Abend ist lau, das braune Kostüm fast zu warm. Vor einem Modehaus flattert eine Fahne mit olympischen Ringen, dahinter, die komplette Straße entlang, fast an jedem Haus, lange rote Fahnen mit schwarzen Hakenkreuzen in weißem Kreis.
An einer Kreuzung bleibt sie stehen, im Rücken das Licht der Werbetafeln von Dunlop und C&A. Sie überfliegt die Titelseite der neuesten Ausgabe des Stürmers, die in einem Zeitungskasten aushängt: »Wer den Juden kennt, kennt den Teufel.«
An einer Laterne lehnt ein Kriegsversehrter. Er stützt sich auf Krücken. Sein linkes Hosenbein ist ab dem Knie, offensichtlich über einem Stumpf, eingeschlagen. Sie befürchtet, dass er betteln könnte und wendet sich ab.
Da bremst ein Taxi auf dem Gehweg, ein Mann steigt aus, lacht und breitet die Arme aus. »Eva! Willkommen in Berlin! Hoffentlich hab ich dich nicht warten lassen!« Er umarmt sie, hakt sich bei ihr ein, fragt nach ihrer Reise und wie sie die Wohnung findet, will wissen, ob sie Hunger hat und vielleicht Lust, anderentags das olympische Dorf zu besichtigen. Sie gehen die Straße hinunter. Der Mann ist einen Kopf größer als sie, trägt einen lässigen Sakkoanzug mit einer gerade geschnittenen, weiten Hose. Sein Haar wird von einem breiten Hut verdeckt.
Sie entdecken einen freien Platz in einem Café in der Rankestraße, drängen an einer lauten Reisegruppe vorbei, setzen sich an einen Tisch unter einer Kastanie und bestellen bei einem schwitzenden Kellner zwei Kaffee mit Milch. »Eigentlich hätten wir Sekt bestellen sollen. Wo du doch Geburtstag hattest«, sagt er und flüstert ihr Geburtstagswünsche ins Ohr. »26 Jahre. Als ich 26 war, habe ich promoviert. Das ist zehn Jahre her. Und jetzt bin ich da, wo ich immer hinwollte. Wie gings denn noch in Tübingen?« Sie erzählt von ihrer Arbeit, von den letzten Wochen in der Klinik, wo sie bis vor ein paar Monaten zusammen gearbeitet haben. Er ist voller Ideen und Tatendrang für seine neue Stelle, für die er seit April freigestellt ist, erklärt ihr, was er vorhat, was er ändern will, wo er Chancen sieht. Seinen Hut hat er vor sich auf den Tisch gelegt. Er trägt die braunen, früh schon lichten Haare zurückgekämmt und mit Pomade geglättet.
Seine ständig hochgezogene linke Augenbraue hat etwas Überlegenes, auch das energische Kinn mit den schwarzen Bartstoppeln, die selbst nach der Rasur dunkle Schatten auf der Haut zurücklassen. Es ist nicht lange her, dass sie ihn zum ersten Mal gesehen hat. Etwas mehr als zwei Jahre. Sie war Teilnehmerin an einem Lehrgang des Roten Kreuzes für Krankenschwestern und er Oberarzt an der Universitätsnervenklinik in Tübingen. Mit ein paar losen Zetteln in der Hand hatte er an einem Pult gestanden, über vererbte Merkmale bei Erbsenpflanzen gesprochen und sie mit seiner weichen Stimme eingehüllt wie in eine Decke.
Jetzt, mitten in Berlin, unter der Kastanie, hat sie ihn endlich ganz für sich: Dr. Robert Ritter. Wenn sie allein sind, sagt er Du zu ihr. Wenn Leute dabei sind, nennt er sie Fräulein Justin. Alles an ihm gefällt ihr. Die Art, wie er sich bewegt, wie er sie ansieht, wie er redet. Auch die Energie, die von ihm ausgeht. »Tübingen war schön und gut. Aber Berlin ist eben doch was anderes. Wir werden forschen, forschen, forschen. Das, was wir immer wollten.« Er streichelt ihre Hand und flüstert: »Eigentlich wollte ich es dir schreiben, aber dann dachte ich, dass es besser ist, wenn ich es dir persönlich sage. Aber vielleicht weißt du es ja auch schon.« Er macht eine bedeutsame Pause und sieht sie an. »Vor ein paar Wochen haben sie die Zigeuner zusammengeführt. Wegen der Olympischen Spiele und wegen des Stadtbildes. Mit Betteln und Herumlungern ist endgültig Schluss. Sie hatten sich ja auch überall ausgebreitet. Die Leute sind froh, dass die Schandflecken verschwinden. Jetzt sind sie auf einem Rastplatz untergebracht. Marzahn. Ein Außenbezirk. Du wirst dort ganz schön was zu tun bekommen.« Robert Ritter grinst und zieht einen Zeitungsausschnitt aus der Tasche seines Sakkos. »Lief wie am Schnürchen. War sehr gut organisiert. Ein riesiges Polizeiaufgebot.
«Er dämpft die Stimme, während er den Zeitungsausschnitt auf dem Tisch auffaltet: »Seit Maria Theresia versucht man der Rumtreiberei Herr zu werden. Bismarck hat sie zur Plage erklärt, sämtliche Parteien im Kaiserreich waren sich einig. Jede Menge Verordnungen gab es. Alles zwecklos, weil die Gemeinden bloß immer wieder versucht haben, sie loszuwerden, statt sie festzusetzen und zu kontrollieren. Aber jetzt werden neue Wege beschritten. So wie der Führer die Judenfrage lösen wird, so wird er auch die Zigeunerfrage regeln.
Marzahn ist der erste Schritt. Dort sind sie isoliert und wir haben sie unter Kontrolle.« Er schiebt den Ausschnitt aus dem Berliner Lokal-Anzeiger in Evas Richtung und während sie die Schlagzeile überfliegt, kramt er in seiner Tasche, zündet sich eine Zigarette an, beugt sich vor und flüstert: »Der lustige Zug ging mitten durch Berlin. Eskortiert von Polizei natürlich. Über 600 haben sie aufgespürt. Aus allen Winkeln kamen sie: Alexanderplatz, Scheunenviertel, Wedding, Prenzlauer Berg. Auch von außerhalb. Über 100 Planwagen haben sie abgeschleppt und die Wohnbaracken auf Tieflader gehievt. Wenn du die Leute fragst, sie sind alle erleichtert.«
Er lehnt sich zurück, zieht an der Zigarette, inhaliert den Rauch und spricht wieder lauter. »Man muss aber auch sagen, dass es in Marzahn besser ist als anderswo. Die Kinder werden Unterricht bekommen, für die Jugend soll einiges getan werden. Waschplätze gibt es auch. Das Wohlfahrtsamt unterstützt die Sache. Alles natürlich im Einvernehmen mit dem Rassenpolitischen Amt der Gauleitung. Mit den Einweisungen nach Marzahn haben wir vorerst nichts zu tun. Da ist die Zigeunerdienststelle im Polizeipräsidium zuständig. Die sammeln alle ein, die in der Stadt herumlungern. Wir erfassen sie dann. Du wirst allerdings vorher nochmals auf Reisen gehen. Ab Januar ist dann Marzahn angesagt. Also noch ein wenig Geduld. Die Zeit solltest du nutzen, um zumindest ein paar Brocken Romanes zu lernen. Ich mache das auch. Seit ein paar Tagen nehme ich Stunden bei einem Sprachwissenschaftler.«
Sie nickt. Er sieht glücklich aus, denkt sie und sieht ihm zu, wie er die Zigarette zwischen Zeigefinger und Mittelfinger bewegt und mit dem Daumen auf den Filter tippt, um die Asche wegzuschnippen. Das einzige, das ihr zu schaffen macht, ist, dass er sie auf Reisen schicken will und sie sich also kaum sehen werden. Aber das sagt sie nicht.
Am Nebentisch hat sich eine Herrenrunde zusammengefunden. Alles dreht sich um die Olympischen Spiele. Ein schwergewichtiger Mann, dessen Zigarre Ringe in der Luft hinterlässt, erklärt mit der Miene eines Menschen, der sich auskennt, dass das große Geschick eines Läufers darin bestehe, leicht und beweglich zu sein, dabei stur vor sich hin zu sehen, sich von nichts ablenken zu lassen, einfach zu rennen, wie ein Pferd mit Scheuklappen.
»Man hört von nichts anderem«, sagt Eva, »auch im Zug hatten die Leute kein anderes Thema. Also, dass Sport so eine Begeisterung auslösen kann?« Sie nippt am Kaffee, der ein bisschen zu heiß ist. Der Dicke vom Nebentisch hat Evas Bemerkung mitbekommen und dreht sich nach ihr um: »Sie waren wohl nicht dabei, gnädge Frau? Die Leute waren wie verrückt. Wann passiert so was schon mal? 33 Goldmedaillen. Also, wer das nicht erlebt hat. Schon die Eröffnung. Ein Zeppelin kreiste, und stellen Sie sich vor, sogar die Franzosen haben den Deutschen Gruß entboten! Plötzlich sind Tausende von Tauben aufgestiegen. Dann Kanonenschüsse. Und wissen Sie, was dann passiert ist?« Er schlägt sich auf die Schenkel und lässt ein kolleriges Lachen los. »Die Vögel haben vor Schreck angefangen zu scheißen!« Er dreht sich nach Eva um: »Verzeihen Sie, Madame, aber so war es. Alles über die Köpfe der Leute. Bei den Männern ging es ja noch, die meisten tragen ja Hüte. Aber die Damen! Die hatten das alles in den Haaren kleben!« Er wiehert, hebt das Glas und trinkt. Dann wischt er sich den Bierschaum von den Lippen.
»Tja, daran hat der Führer wohl nicht gedacht. An alles kann er ja auch nicht denken. Aber 33 Goldmedaillen – das muss uns erstmal einer nachmachen. Die Amerikaner habens nur auf 24 gebracht.« »Trotzdem hatten sie den besten Mann im Rennen.« Ein kleiner Mann mit einer goldgeränderten Brille beugt sich vor: »Ich sag nur Owens. Jesse Owens. Unglaublich, der Kerl! Wie eine Wildkatze aus dem Dschungel. Vier Goldmedaillen hat er abgeräumt. Schwarz wie die Nacht war der. Ich habs selbst gesehn. Aber wie ne Gazelle! Long hat ihn umarmt. Also, ich wüsste nicht, ob ich so einen Neger umarmen könnte.« Der Dicke sieht nach Eva, aber sie beachtet ihn nicht. »Erzähl mir mehr über Marzahn«, bittet sie und rückt mit ihrem Stuhl näher an Robert heran. Robert will etwas sagen, aber der Dicke übertönt seine Antwort: »Owens hin oder her. Unsere Sportler sind auch nicht schlecht. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl! Natürlich keine Dschungelaffen, das natürlich nicht.« Robert sieht verärgert hinüber. »Ihre Wettkämpfe interessieren uns nicht. Wenn Sie also etwas leiser sein könnten, wir möchten uns unterhalten.« Der Dicke reagiert mit einem wütenden Blick. Abrupt dreht er seinen Stuhl und setzt sich mit dem Rücken zu Eva.
Provokant bläst er seinen Rauch in Roberts Richtung. »Sollen wir woanders hingehn?«, fragt Robert, als das Gespräch am Nebentisch wieder auf die Olympischen Spiele kommt, aber sie schüttelt den Kopf. Während sie reden, wandert ihr Blick immer wieder zu dem Mann mit der Goldbrille, dessen Stimme anschwillt, bis er schließlich mit der Faust auf den Tisch schlägt: »Ihr könnt alle von Glück reden, dass die Spiele überhaupt stattgefunden haben. Diese miese Auslandspresse! Die schreiben über Deutschland genau das, was die Exilanten loslassen. In Spanien kritisieren sie die Methoden des Führers, das sei zu rabiat, Zwangsarbeit und so weiter, auch das mit den Juden. Sie schreiben, dass der Führer einen Krieg vorbereitet, dass die Propaganda verlogen und ihm die olympische Idee völlig egal ist.« Eva sieht, wie der Dicke rot anläuft. »Ausgerechnet Spanien kann es sich absolut nicht leisten, unsere Regierung zu kritisieren. Die haben genug mit sich zu tun. Ich wette drauf, dass der Führer dort noch eingreifen wird und dann können sie froh sein …« Der mit der Brille fällt ihm ins Wort. »Ich hab gehört, dass die griechischen Kommunisten den Fackellauf aufhalten, ja sogar die Fackel löschen wollten, um ein Zeichen zu setzen.« Robert schrammt den Stuhl zurück und setzt den Hut auf. »Das ist ja nicht zum Aushalten. Gehn wir, Fräulein Justin.«
Ute Bales: Bitten der Vögel im Winter

Roman, Rhein-Mosel-Verlag, Zell, 2018, 410 Seiten, Hardcover, 22,80 Euro
Pressetext zum Buch
Es braucht Mut, einen Roman aus der Perspektive einer NS-Täterin zu schreiben und Ute Bales ist mehrfach gewarnt worden. Sie hat es trotzdem getan und beschreibt in ihrem neuen Werk „Bitten der Vögel im Winter“ ein tiefdunkles Kapitel der deutschen Geschichte, über das bis heute weitgehend geschwiegen wird. Es geht um die Verfolgung der Sinti und Roma und es geht um Eva Justin, eine der bekanntesten „Rassenforscherinnen“ zur Zeit des Nationalsozialismus.
Es ist ein aufwühlender Roman, der kontrovers diskutiert wird. Die Hauptfigur, Eva Justin, ist grotesk, widersprüchlich, ungeheuerlich. Ute Bales erzählt von Selektionen in Jugendgefängnissen, von nächtlichen Übergriffen auf Lagerinsassen, von Kinderspielen, die über Leben und Tod entscheiden. Eva Justin ist keine Phantasiefigur. Sie bewegt sich auf einem gut recherchierten, historischen Terrain. Orte und Personen, die unfassbaren Verbrechen und die damit verbundenen administrativen Vorgehensweisen hat es wirklich gegeben. Historische, politische und psychologische Ebenen verschmelzen: Was ist der Mensch und warum wird er zum Täter?
Eva Justin wurde im Kaiserreich geboren. Ute Bales schildert deren Kindheit, die strenge Erziehung und den schon früh auffälligen Drang, alles zu sortieren und zu ordnen. Hier mögen die Wurzeln liegen für ihre spätere monströse Aufgabe im Nazi-Reich.
Als junge Frau nimmt Justin an einem Lehrgang für Krankenschwestern in Tübingen teil und lernt dort Dr. Robert Ritter kennen, Oberarzt mit besten Karriereaussichten, verheiratet. An Ritter ist nichts zufällig, nichts nebensächlich. Sie ist bereit, als er fragt, ob sie seine Arbeit unterstützen will. Saubere Menschen sind sein Ziel. Eine „Rasse“ ohne Makel. Von Anfang an teilt Justin seine Lust zu forschen, unterstützt seine Arbeit und geht bald eine Beziehung mit ihm ein, die in ein sexuelles Abhängigkeitsverhältnis führt, das als Analogie der Abhängigkeit der Deutschen zu Hitler gelesen werden kann. Konsequent tut Justin das, was Ritter sagt, hinterfragt nichts, sieht weg, wo es heikel wird, verbeugt sich vor jedem seiner Worte.
1936 folgt sie ihm nach Berlin, wo er zum Leiter der „Rassenhygienischen Forschungsstelle im Reichsgesundheitsamt“ berufen wird. Die Forschungsstelle befasst sich hauptsächlich mit „Zigeuner-Gutachten“. Im Rahmen großangelegter Aktionen zur „Bekämpfung der Zigeunerplage“ vermessen, verhören und klassifizieren die Arbeitsgruppen, zu denen Eva Justin gehört, Tausende Sinti und Roma und legen „Sippenarchive“ an. Justins Verhältnis zu Ritter führt dazu, dass sie ein immenses Arbeitstempo an den Tag legt. Sie glaubt einer großen Bewegung anzugehören, Teil einer gleichgesinnten Gemeinschaft zu sein.
1937 beginnt sie, auf Ritters Wunsch hin, neben ihrer Tätigkeit als „Rassenforscherin“, ein Studium der Anthropologie und macht sich auf dem „Zigeunerrastplatz“ Berlin-Marzahn, wo immer mehr Sinti und Roma konzentriert werden, bald einen Namen als „Zigeuner-Expertin“. Die Gutachten, die sie und die Kollegen verfassen, dienen als Grundlage, Sinti und Roma in Lager zu deportieren, wo sie entwürdigt, gefoltert, verstümmelt und ermordet werden.
Um die Gutachten aufzuwerten, verlangt Ritter, dass Justin eine Doktorarbeit schreiben soll. Er hat Bedenken, die massenhaften Bewertungen, die Todesurteilen gleichkommen, von einer Studentin unterschreiben zu lassen. Obwohl Justin kein abgeschlossenes Studium vorweisen kann, wird sie mithilfe seiner einflussreichen Kollegen zur Promotion zugelassen. In ihrer Arbeit untersucht sie, inwiefern „Zigeunerkinder“ erziehbar sind oder nicht. 1942 reist sie zu diesem Zweck ins schwäbische Mulfingen, wo ihr in einem katholischen Kinderheim 40 Sinti-Kinder zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt werden. Die Heimkinder bleiben so lange von der „Endlösung“ verschont, wie sie Justin als Versuchsobjekte nützen. Nach Abschluss der Doktorarbeit werden sie der SS übergeben und nach Auschwitz ausgewiesen.
Bei allem, was sie tut, bleibt Justin unzugänglich und kalt. Nur Ritter gegenüber zeigt sie Gefühl. Erbarmungslos reißt sie Familien auseinander, lässt Leute verhaften und Frauen, wenn sie nicht spuren, die Haare abschneiden. Sie weiß, was sie tut. Fassungslos verfolgt man, wie sie Kinder aushorcht, Leute denunziert, eine Schwangere zur Zwangsabtreibung schickt. Bei alldem begreift Justin nicht, dass alle angeblichen Eigenschaften, die sie den „Zigeunern“ zuschreibt – Dummheit, Gemeinheit, Schwachheit – ihre eigenen Eigenschaften sind.
„Bitten der Vögel im Winter“ erinnert eindrücklich an die mörderische Politik der NS-Zeit, die auf Basis einer verheerenden Rassenideologie unter anderem zur Vernichtung von mehr als 500.000 Sinti, Roma und Jenischen in Deutschland und Europa führte.

Ute Bales, 1961 in der Eifel geboren und dort aufgewachsen, studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Kunst in Giessen und Freiburg, wo sie seither lebt und arbeitet. Sie ist Mitglied im Literaturwerk Rheinland-Pfalz-Saar e.V., im Literarischen Verein der Pfalz, im Literatur Forum Südwest e.V. Freiburg, gehört dem Kunstverein Weißenseifen/Eifel an sowie der Künstlergruppe SternwARTe Daun. Sie hat bisher sieben Romane veröffentlich sowie zahlreiche Kurzgeschichten und Essays. Der Roman „Bitten der Vögel im Winter“ ist mit dem Martha-Saalfeld-Förderpreis 2018 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.
Siehe auch:
Auszug 1
Kinderheim Mulfingen, 1942
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=25728
Online-Flyer Nr. 697 vom 20.03.2019
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE