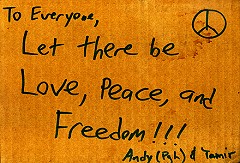SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Kultur und Wissen
Kinder- und Jugendliteratur als Prophylaxe - Teil 3
Lese-Kultur gegen Gewalt
Von Wolfgang Bittner
Defizite an Abenteuer
Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Zunahme von Gewalt unter Kindern und Jugendlichen ist offensichtlich ein nicht befriedigter und nicht zu kompensierender Abenteuerdrang. Sowohl die städtische als auch die ländliche Umgebung bietet kaum noch Freiräume; der Abenteuerspielplatz ist ohne Reiz, alles ist durchforstet, asphaltiert, betoniert und reglementiert. Aber Kinder und Jugendliche wollen etwas erleben, sie sind wissbegierig und neugierig, sie langweilen sich, wenn nichts los ist. Und in unserer immer steriler werdenden Erwachsenen-Umwelt ist kein Platz mehr für außergewöhnliche Erlebnisse und Abenteuer. Die schafft man sich dann, indem man Randale macht oder verbotene Wege geht. S-Bahn-Surfen, Crashrennen, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Automatenglücksspiele, unterschiedlichste Formen von Vandalismus oder die vielen Graffiti, sogar Jugendkriminalität, sind ein Symptom dafür, wie auch für ein immenses Reservoir an brachliegender kreativer Potenz.
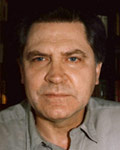 Nicht selten ist dieser unerfüllte Abenteuerdrang mit ein Grund für rechtsextreme Aktivitäten. Jugendliche suchen nach Orientierung, nach Perspektiven. Sie lassen sich leicht begeistern, und Lagerfeuerromantik, Naturverbundenheit, Körperertüchtigung, Kameradschaft, auch Mystizismus und das vermittelte Zugehörigkeitsgefühl, ziehen sie schnell in ihren Bann. Ideologen und Fanatiker haben dann leichtes Spiel.
Nicht selten ist dieser unerfüllte Abenteuerdrang mit ein Grund für rechtsextreme Aktivitäten. Jugendliche suchen nach Orientierung, nach Perspektiven. Sie lassen sich leicht begeistern, und Lagerfeuerromantik, Naturverbundenheit, Körperertüchtigung, Kameradschaft, auch Mystizismus und das vermittelte Zugehörigkeitsgefühl, ziehen sie schnell in ihren Bann. Ideologen und Fanatiker haben dann leichtes Spiel.
Die virtuellen Welten der Computerspiele, nach denen manche süchtig sind, oder die Chatting-Ecken des Internets, in denen Realität beliebig manipuliert wird, bieten hier keinen akzeptablen Ersatz. Der Psychologe Wolfgang Bergmann, Autor des Buches »Computerkids«, schreibt zum Phänomen einer technologisch-medial geprägten Kindheit: »Diese Kinder lehnen sich nicht gegen...Autoritäten auf. Sie weichen ihnen vielmehr aus, schieben sie beiseite und haben damit - anders als die Generationen vor ihnen - offenbar kaum Probleme. In Computerspielen wie >Mortal Kombat< oder >doom< wird mit ungeheurer destruktiver Kraft gespielt und abgeschossen, schnell und glatt und beiläufig ...«
Hier stoßen wir also wieder auf das Phänomen prägender Gewalt in den Medien. Bergmann fährt dann fort: »Zwar werden noch die Helden und die Bösen unterschieden, aber nicht nach moralischen Kategorien, sondern nach Zweckmäßigkeit der dramaturgischen Ökonomie. Töter sind sie alle, und sie töten ohne Zögern und Konflikte. In den guten alten Gary-Cooper-Western wie >Zwölf Uhr mittags< gab es diesen Gewissenseinspruch durchaus noch - die Frage: Darf ich überhaupt töten? Was ist Notwehr, was Mord? Gewalt musste immer erst die Gewissensinstanz passieren, bevor sie legitimiert und akzeptiert (und genossen) werden konnte. All das mögen die modernen Produzenten dem Publikum nicht mehr zumuten. Sie wissen: Die Ängste und Bedenken der Stimme des Gewissens versetzen nicht in Spannung, sondern langweilen. Sie finden keine emotionale Resonanz. Diese neue Medienwelt ist grandios und destruktiv, allmächtig und grausam.«
Nun wird gesagt, dass der private Austausch im Internet, die Vernetzung im intimen Kontakt, positive Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Leben habe. Menschen aus allen Ländern der Welt kommunizieren miteinander, sie schreiben sich E-Mails, sprechen sich aus, sogar Kinder nutzen diese Möglichkeiten digitaler Technik. Schön und gut. Aber wenn es um die Entlastungs-Kommunikation im Internet geht, ist auch ein kritischer Blick angezeigt. Sie schafft lediglich eine Pseudonähe, Intimität ohne wirkliche menschliche Begegnung, im Zweifel ohne Identität. Dagegen ist das Buch - wenn es etwas taugt - ein ernstzunehmendes, substanzielles Gegenüber. Es verbindet Menschen, Autor und Leser überall auf der Welt, auf geheimnisvolle, unaufdringliche Weise in ihrem innersten Wesen.
Perspektiven
Lesen kann Ventil und Katalysator sein. Literatur bietet Zuflucht und Anregungen, sie kann das Leben farbiger machen, den Horizont erweitern. Sie schafft Bewegung im Kopf. Und der Leser ist bei sich. Während die Computerbilder »der Zeit enthoben, vom Räumlichen befreit, in übermenschliche Geschwindigkeiten und andere Potentialitäten eingebunden« sind, »ohne Widerhall in der Erfahrung des Zuschauers oder Spielers«, ist das Betrachten eines Bildes im alten Sinn immer auch »Reflexion aufs eigene Selbst und auf das in ihm enthaltene, oft ungewusste, oft entstellte Humane an sich« (so Bergmann). Das gleiche gilt für das Lesen.
Der Fernsehjournalist Roger Willemsen hat in diesem Zusammenhang davon gesprochen, »dass sich lauter Menschen, die nichts von einander wissen, in einer Solidargemeinschaft über einer Welt zusammenschließen und kraft ihrer gemeinschaftlichen Erfahrung vielleicht davon träumen, wie Kant sagte, >es könne künftig besser werden, und zwar mit uneigennützigem Wohlwollen, wenn wir selbst nicht mehr sind, und die Früchte, die wir aussäen halfen, nicht einernten werden<.«
Das klingt schwärmerisch. Aber gäbe es statistische Untersuchungen darüber, würde man sicherlich zu dem Ergebnis kommen, dass sich Kinder, die lesen, weniger gewalttätig und überhaupt aufgeschlossener, toleranter und sozialer verhalten. Jedenfalls ist das meine Beobachtung über Jahre hinweg. Da ersetzt das Buch - und das ist ein weiterer Aspekt in diesem Spektrum - vielleicht auch ein wenig den familiären Austausch, der vielfach nicht mehr stattfindet und den kein Computerspiel zu simulieren vermag.
Die Auswüchse der Zivilisation, in der wir leben, nehmen weiter zu. Es bedarf heute keines Atomschlages mehr, um die Menschheit zu vernichten. Keiner kann sich mehr entziehen - das ist neu. Ziel müsste sein, vernünftiger, natürlicher, humaner, auch liebevoller und bescheidener zu leben. Dazu kann Literatur - gerade die Kinder- und Jugendliteratur - einen wesentlichen Beitrag leisten, sensibler machen, aufgeschlossener für Fragen des Zusammenlebens und der menschlichen Existenz. Dazu könnten auch die audiovisuellen Medien beitragen, aber das Gegenteil ist leider häufig der Fall.

Foto: Archiv W. Bittner
Insofern ist Leseförderung, wie auch ein Netz von Bibliotheken mit fachkundiger Beratung und von Jugendzentren, eine unabdingbare zivilisatorische Notwendigkeit. Das ist in unserer Zeit für ein funktionierendes Gemeinwesen, für eine demokratisch organisierte Gesellschaft, die den Anspruch erhebt, ein Kulturvolk zu sein, lebenswichtig und allemal billiger als die Behandlung von Verletzten, von Straftätern und Drogenabhängigen. Darauf kann nicht oft genug hingewiesen werden, denn die Entwicklung geht zurzeit in die entgegengesetzte Richtung. Wir sollten das nicht hinnehmen.
*Die ersten beiden Folgen finden Sie in NRhZ 33 und 34. Dem Beitrag liegt ein Vortrag von Wolfgang Bittner zugrunde. Eine Sammlung mit Essays und Vorträgen des Autors erscheint Ende März unter dem Titel "Schreiben, Lesen, Reisen" im Athena-Verlag in Oberhausen.
Online-Flyer Nr. 35 vom 14.03.2006
Druckversion
Kultur und Wissen
Kinder- und Jugendliteratur als Prophylaxe - Teil 3
Lese-Kultur gegen Gewalt
Von Wolfgang Bittner
Defizite an Abenteuer
Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Zunahme von Gewalt unter Kindern und Jugendlichen ist offensichtlich ein nicht befriedigter und nicht zu kompensierender Abenteuerdrang. Sowohl die städtische als auch die ländliche Umgebung bietet kaum noch Freiräume; der Abenteuerspielplatz ist ohne Reiz, alles ist durchforstet, asphaltiert, betoniert und reglementiert. Aber Kinder und Jugendliche wollen etwas erleben, sie sind wissbegierig und neugierig, sie langweilen sich, wenn nichts los ist. Und in unserer immer steriler werdenden Erwachsenen-Umwelt ist kein Platz mehr für außergewöhnliche Erlebnisse und Abenteuer. Die schafft man sich dann, indem man Randale macht oder verbotene Wege geht. S-Bahn-Surfen, Crashrennen, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Automatenglücksspiele, unterschiedlichste Formen von Vandalismus oder die vielen Graffiti, sogar Jugendkriminalität, sind ein Symptom dafür, wie auch für ein immenses Reservoir an brachliegender kreativer Potenz.
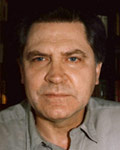 Nicht selten ist dieser unerfüllte Abenteuerdrang mit ein Grund für rechtsextreme Aktivitäten. Jugendliche suchen nach Orientierung, nach Perspektiven. Sie lassen sich leicht begeistern, und Lagerfeuerromantik, Naturverbundenheit, Körperertüchtigung, Kameradschaft, auch Mystizismus und das vermittelte Zugehörigkeitsgefühl, ziehen sie schnell in ihren Bann. Ideologen und Fanatiker haben dann leichtes Spiel.
Nicht selten ist dieser unerfüllte Abenteuerdrang mit ein Grund für rechtsextreme Aktivitäten. Jugendliche suchen nach Orientierung, nach Perspektiven. Sie lassen sich leicht begeistern, und Lagerfeuerromantik, Naturverbundenheit, Körperertüchtigung, Kameradschaft, auch Mystizismus und das vermittelte Zugehörigkeitsgefühl, ziehen sie schnell in ihren Bann. Ideologen und Fanatiker haben dann leichtes Spiel.Die virtuellen Welten der Computerspiele, nach denen manche süchtig sind, oder die Chatting-Ecken des Internets, in denen Realität beliebig manipuliert wird, bieten hier keinen akzeptablen Ersatz. Der Psychologe Wolfgang Bergmann, Autor des Buches »Computerkids«, schreibt zum Phänomen einer technologisch-medial geprägten Kindheit: »Diese Kinder lehnen sich nicht gegen...Autoritäten auf. Sie weichen ihnen vielmehr aus, schieben sie beiseite und haben damit - anders als die Generationen vor ihnen - offenbar kaum Probleme. In Computerspielen wie >Mortal Kombat< oder >doom< wird mit ungeheurer destruktiver Kraft gespielt und abgeschossen, schnell und glatt und beiläufig ...«
Hier stoßen wir also wieder auf das Phänomen prägender Gewalt in den Medien. Bergmann fährt dann fort: »Zwar werden noch die Helden und die Bösen unterschieden, aber nicht nach moralischen Kategorien, sondern nach Zweckmäßigkeit der dramaturgischen Ökonomie. Töter sind sie alle, und sie töten ohne Zögern und Konflikte. In den guten alten Gary-Cooper-Western wie >Zwölf Uhr mittags< gab es diesen Gewissenseinspruch durchaus noch - die Frage: Darf ich überhaupt töten? Was ist Notwehr, was Mord? Gewalt musste immer erst die Gewissensinstanz passieren, bevor sie legitimiert und akzeptiert (und genossen) werden konnte. All das mögen die modernen Produzenten dem Publikum nicht mehr zumuten. Sie wissen: Die Ängste und Bedenken der Stimme des Gewissens versetzen nicht in Spannung, sondern langweilen. Sie finden keine emotionale Resonanz. Diese neue Medienwelt ist grandios und destruktiv, allmächtig und grausam.«
Nun wird gesagt, dass der private Austausch im Internet, die Vernetzung im intimen Kontakt, positive Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Leben habe. Menschen aus allen Ländern der Welt kommunizieren miteinander, sie schreiben sich E-Mails, sprechen sich aus, sogar Kinder nutzen diese Möglichkeiten digitaler Technik. Schön und gut. Aber wenn es um die Entlastungs-Kommunikation im Internet geht, ist auch ein kritischer Blick angezeigt. Sie schafft lediglich eine Pseudonähe, Intimität ohne wirkliche menschliche Begegnung, im Zweifel ohne Identität. Dagegen ist das Buch - wenn es etwas taugt - ein ernstzunehmendes, substanzielles Gegenüber. Es verbindet Menschen, Autor und Leser überall auf der Welt, auf geheimnisvolle, unaufdringliche Weise in ihrem innersten Wesen.
Perspektiven
Lesen kann Ventil und Katalysator sein. Literatur bietet Zuflucht und Anregungen, sie kann das Leben farbiger machen, den Horizont erweitern. Sie schafft Bewegung im Kopf. Und der Leser ist bei sich. Während die Computerbilder »der Zeit enthoben, vom Räumlichen befreit, in übermenschliche Geschwindigkeiten und andere Potentialitäten eingebunden« sind, »ohne Widerhall in der Erfahrung des Zuschauers oder Spielers«, ist das Betrachten eines Bildes im alten Sinn immer auch »Reflexion aufs eigene Selbst und auf das in ihm enthaltene, oft ungewusste, oft entstellte Humane an sich« (so Bergmann). Das gleiche gilt für das Lesen.
Der Fernsehjournalist Roger Willemsen hat in diesem Zusammenhang davon gesprochen, »dass sich lauter Menschen, die nichts von einander wissen, in einer Solidargemeinschaft über einer Welt zusammenschließen und kraft ihrer gemeinschaftlichen Erfahrung vielleicht davon träumen, wie Kant sagte, >es könne künftig besser werden, und zwar mit uneigennützigem Wohlwollen, wenn wir selbst nicht mehr sind, und die Früchte, die wir aussäen halfen, nicht einernten werden<.«
Das klingt schwärmerisch. Aber gäbe es statistische Untersuchungen darüber, würde man sicherlich zu dem Ergebnis kommen, dass sich Kinder, die lesen, weniger gewalttätig und überhaupt aufgeschlossener, toleranter und sozialer verhalten. Jedenfalls ist das meine Beobachtung über Jahre hinweg. Da ersetzt das Buch - und das ist ein weiterer Aspekt in diesem Spektrum - vielleicht auch ein wenig den familiären Austausch, der vielfach nicht mehr stattfindet und den kein Computerspiel zu simulieren vermag.
Die Auswüchse der Zivilisation, in der wir leben, nehmen weiter zu. Es bedarf heute keines Atomschlages mehr, um die Menschheit zu vernichten. Keiner kann sich mehr entziehen - das ist neu. Ziel müsste sein, vernünftiger, natürlicher, humaner, auch liebevoller und bescheidener zu leben. Dazu kann Literatur - gerade die Kinder- und Jugendliteratur - einen wesentlichen Beitrag leisten, sensibler machen, aufgeschlossener für Fragen des Zusammenlebens und der menschlichen Existenz. Dazu könnten auch die audiovisuellen Medien beitragen, aber das Gegenteil ist leider häufig der Fall.

Foto: Archiv W. Bittner
Insofern ist Leseförderung, wie auch ein Netz von Bibliotheken mit fachkundiger Beratung und von Jugendzentren, eine unabdingbare zivilisatorische Notwendigkeit. Das ist in unserer Zeit für ein funktionierendes Gemeinwesen, für eine demokratisch organisierte Gesellschaft, die den Anspruch erhebt, ein Kulturvolk zu sein, lebenswichtig und allemal billiger als die Behandlung von Verletzten, von Straftätern und Drogenabhängigen. Darauf kann nicht oft genug hingewiesen werden, denn die Entwicklung geht zurzeit in die entgegengesetzte Richtung. Wir sollten das nicht hinnehmen.
*Die ersten beiden Folgen finden Sie in NRhZ 33 und 34. Dem Beitrag liegt ein Vortrag von Wolfgang Bittner zugrunde. Eine Sammlung mit Essays und Vorträgen des Autors erscheint Ende März unter dem Titel "Schreiben, Lesen, Reisen" im Athena-Verlag in Oberhausen.
Online-Flyer Nr. 35 vom 14.03.2006
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE