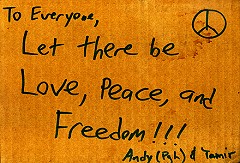SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Globales
Warum junge Franzosen auf die Barrikaden gehen
Denn sie wissen, was sie tun
Von Tahar Ben Jelloun
Frankreich wird in diesen Tagen brutal aus dem Schlaf gerissen. Es erkennt, dass seine menschliche Landschaft nicht schneeweiß ist. Es erkennt, dass die Franzosen nicht nur ein bunter Haufen sind, sondern zu großen Teilen arm und vernachlässigt. Und doch: Die schwierigen Lebensbedingungen, die Arbeits- und Perspektivlosigkeit allein können den Aufstand von Clichy-sous-Bois, der längst auf andere Vororte und Städte übergegriffen hat, nicht erklären.
Diese zornige Jugend kommt von weit her, und das Problem ihrer Identität wiegt schwerer als das ihrer Armut. Diese Jugendlichen sind nicht einmal hin- und hergerissen zwischen zwei Ländern, zum Beispiel Algerien und Frankreich. Nein, sie können sich weder mit dem einen noch mit dem anderen identifizieren. Frankreich ist ihre Heimat, doch das Land erkennt sie nicht an und lässt sie nicht mit am Tisch sitzen. Sie fühlen sich ausgeschlossen und abgelehnt. Nun halten sie ihrer Heimat einen Spiegel vor, aber Frankreich will sich darin nicht wiedererkennen. Tatsächlich hat das Land nie eine ernst zu nehmende Einwanderungspolitik gehabt. Vor allem aber hat die französische Öffentlichkeit sich nie vor Augen geführt, dass Einwanderer Kinder auf die Welt bringen und dass diese Kinder keine Einwanderer, sondern waschechte Franzosen sind.
Reaktion auf eine Tragödie
Das Missverständnis ist total. Es drängen Probleme, die ihre Wurzeln in der jüngeren Geschichte haben und die nun von den Jugendlichen mit Gewalt ausgetragen werden. Ein Funke reicht, um den Aufstand in andere Wohngebiete zu tragen. Bereits im April gab es in Aubervilliers gewaltsame Aufstände und Kämpfe zwischen rivalisierenden Banden. Die Stimmung ist verseucht, und das schon seit langem. Egal, ob in Frankreich die Linke oder die Rechte an der Macht ist.
Beim geringsten Anlass rebellieren die Jugendlichen, verbrennen Autos, zerstören Einkaufszentren und zünden Mülleimer an. Dennoch sind sie keine »ziellosen Rebellen«, keine rebels without a cause. Sie wissen, was sie tun, denn sie reagieren auf eine Tragödie, auf ein offensichtliches Unrecht, wie in Clichy am 27. Oktober, als zwei Minderjährige von der Polizei verfolgt wurden und in einem Transformatorenhäuschen starben. Es war ein Unfall, sicher, doch er wäre nicht geschehen, hätten die Sicherheitskräfte die beiden nicht verfolgt.
Der Jugendarbeit das Geld gestrichen
Die Revolte, die dieser Vorfall auslöste, speist sich aus einer älteren Geschichte, die Frankreich weder wahrhaben noch anerkennen will: der zutiefst ambivalenten Beziehung zu Algerien. Doch heute haben die politischen und sozialen Spannungen, die aus dieser Geschichte erwuchsen, eine andere, gewaltsamere Dimension angenommen. Das heißt, dass Frankreich seine Arbeit nicht getan und sich nicht um jene Bevölkerungsteile geschert hat, die eigentlich nur eines wollen: in Würde und Frieden arbeiten und leben. Den Bürgerinitiativen und Vereinen, die mit jenen Jugendlichen arbeiteten, wurde das Geld gestrichen; auch die Kommunen haben immer weniger Geld für soziale und kulturelle Maßnahmen. Die Eltern sind zumeist macht- und hilflos. Ihre Kinder hören nicht mehr auf sie, und so müssen sie verzweifelt mit ansehen, wie ihre Söhne die Autos der Nachbarn anzünden.
Im Jahre 1983 organisierten Jugendliche aus Einwandererfamilien, die man auch beurs nennt, einen Marsch durch Frankreich, um Staat und Öffentlichkeit auf ihre Lebensbedingungen aufmerksam zu machen. Die Aktion wurde von SOS Racisme und Bürgerinitiativen unterstützt. Für die sozialistische Regierung war sie Ausdruck des Willens zur Integration. Einige Vertreter wurden von Ministern empfangen, es gab vollmundige Versprechungen. Die Jugendlichen kehrten in ihre Vororte zurück. Es änderte sich nichts. Die beurs erlebten eine Enttäuschung nach der anderen. Manche, die sich verlassen und ungerecht behandelt fühlten, erlagen der Versuchung des schnellen Geldes. Sie drifteten ab - an die Ränder der Gesellschaft. Ob in Vénissieux, Straßburg oder den Pariser Vororten, ein Teil dieser in der Schule gescheiterten Jugendlichen ging den Weg der Gewalt: abgebrannte Autos, Drogenhandel, Straßenschlachten mit der Polizei.
All dies hätte man wissen können. Ende der achtziger Jahre gründeten junge französische Soziologen verschiedener Herkunft die Vereinigung Banlieuscopie mit dem Ziel, die Vororte zu beobachten und zu analysieren, um den Behörden Vorschläge zur Lösung der Probleme zu machen. Doch für die Regierung stellte sich das Ganze nur als Sicherheitsproblem dar, als Störung der öffentlichen Ordnung. Ihre Antwort war und ist - Repression.

Innenminister Nicolas Sarkozy:
Mit dem Hochdruckreiniger!
Gouv.Fr. - Foto: afp
Islamisten versprechen den Jugendlichen neuen Lebenssinn
So verstaubten die Berichte von Banlieuscopie in den Aktenschränken. Unterdessen gewann die rechtsextreme Partei Front National an Zulauf und an Stimmen. Sie nutzte die Lage in den Vororten, um ihre Anhänger zu mobilisieren. Zugleich entwickelte sich ein neues Phänomen: der Islamismus. Imame gaben einer orientierungslosen Jugend ohne klare Werte und Visionen eine neue Hoffnung und eine neue Identität. Das ist der Grund, warum manche Jugendliche mit Frankreich und seinem Gesellschaftsmodell gebrochen und sich in der islamischen Bewegung engagiert haben. Sie gibt ihrer Existenz einen Sinn.
Die Vereinigung Banlieuscopie ging unter. Privatinitiativen retteten manche Jugendlichen, doch das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Rassismus und Gesetzesbruch fielen auf fruchtbaren Boden - und das in Wohnvierteln, die sich chronisch in einem heruntergekommenen Zustand befinden. Die Generation der Eltern besteht zum Großteil aus Analphabeten und lebt in einem kulturellen Vakuum. Deshalb sind die Jugendlichen, ob sie aus nord- oder schwarzafrikanischen Familien stammen, dazu verurteilt, ein Leben als ausgestoßene Rebellen zu führen.
Sarkozy: "Mit dem Hochdruckreiniger säubern"
Innenminister Nicolas Sarkozy, der die soziale und konfliktlösende Rolle der Polizei in den letzten Jahren unterminiert und durch rein repressive Aktionen ersetzt hat, will den Franzosen beweisen, dass er der Garant ihrer Sicherheit ist. Er war es, der erklärte, die Cité de la Courneuve, einen schwierigen Pariser Vorort, mit dem Hochdruckreiniger säubern zu wollen. Kurz vor den tragischen Ereignissen in Clichy bezeichnete er die zornigen Jugendlichen in Argenteuil als »Abschaum«.
Dieses Vorgehen, vor allem aber seine Ausdrucksweise zeigen, dass Sarkozy entweder die Beherrschung verloren hat oder den Wählern der extremen Rechten eine Botschaft zukommen lassen will, denn in zwei Jahren sind Präsidentschaftswahlen. Wie er so schön sagt: »Ich halte keine Reden, ich handle und begebe mich an Ort und Stelle.« Azouz Begag, der Stellvertretende Minister zur Förderung der Chancengleichheit, hat offen die Methoden und die Sprache Sarkozys kritisiert, ohne dass ihm Premierminister de Villepin daraus einen Vorwurf gemacht hätte: »Es ist nicht uninteressant zu sehen, dass die beiden Minister nicht das gleiche Frankreich im Visier haben.«
Der Schriftsteller und Soziologe Azouz Begag weiß, wovon er spricht, denn ihm sind die Jugendlichen aus den Vororten vertraut. Er wurde als Sohn algerischer Zuwanderer in der Nähe von Lyon geboren und kennt die Leiden jener jungen Leute, die Frankreich nicht als die seinen anerkennen will. Jedes Mal wenn sie demonstrieren, schickt man ihnen die Polizei auf den Hals. Manche Banden nutzen das, um Schaukämpfe gegen andere Banden zu organisieren. Inzwischen ist das Terrain fast vollständig vermint; von öffentlicher Sicherheit kann kaum mehr die Rede sein.
Plünderer und Brandstifter müssen vor Gericht gestellt werden
Noch einmal: Die randalierenden Jugendlichen sind keine Ausländer und auch keine Einwanderer. Sie sind unterprivilegierte Franzosen, deren Schicksal bestimmt wird durch Armut, ungesunde Wohnbedingungen und eine Vorgeschichte, die ihnen zum Handicap wird. Sie sind Franzosen zweiter Klasse, die in der Schule scheitern. Kaum fünf Prozent der Einwandererkinder schaffen es an die Universität. Einige wurschteln sich durch, andere führen ein Dasein als Kleinkriminelle. Sie wissen, dass sie nicht akzeptiert werden und dass Herkunft und Status ihnen den Zugang zu den Grandes Ecoles verwehren, mehr noch: ihnen nicht einmal eine normale berufliche Karriere ermöglichen.
Nun hatte Nicolas Sarkozy am 26. Oktober in seinem Ministerium eine Tagung zur »positiven Diskriminierung à la française« organisiert, um den Rassismus an den Schulen und beim Berufseinstieg zu bekämpfen. Mich hatte er um eine Einleitungsrede gebeten. Da ich das Prinzip der Diskriminierung - ob positiv oder negativ - ablehne, forderte ich, dass sich die Mentalität der Franzosen ändern müsse und sie die neue Wirklichkeit akzeptieren müssten: Frankreich sei ein Land, dessen »menschliche Landschaft« sich verändert habe. Seine Zukunft liegt in der Vermischung mehrerer Farben, Düfte und Gewürze. Aus diesem Grund bin ich auch gegen das Vorlegen anonymer Lebensläufe bei Bewerbungen. Im Gegenteil, der französische Staatsbeamte soll wissen, dass der Stellenbewerber Mohamed heißt, Franzose ist und dass allein seine Fähigkeiten und Kompetenzen zählen. Alles andere ist für mich ein
Zugeständnis an den Rassismus.
Doch der Minister hat es eilig. Er will rasche Lösungen, will die Franzosen mit seinen Auftritten vor Ort beeindrucken, denn er befindet sich bereits im Wahlkampf. Repression aber löst die Probleme der Jugendlichen nicht; sie sorgt nur für Eskalation. Stattdessen brauchen wir eine neue Politik, die die Wirklichkeit anerkennt und den revoltierenden Bevölkerungsteil in die Zukunft unseres Landes einbindet. Denn diese Jugendlichen erklären laut und deutlich, ihre Heimat sei Frankreich. Doch Frankreich hört diesen Ruf viel zu selten. Das rechtfertigt keine Gewalt. Plünderer und Brandstifter müssen vor Gericht gestellt werden - aber vor ein Gericht, dessen Urteil nicht von vornherein feststeht.
Der Autor ist der bekannteste marokkanische Schriftsteller. 1944 in Fes geboren, wanderte er Anfang der siebziger Jahre nach Paris aus. Zuletzt erschien von ihm im Rowohlt Verlag "Papa, woher kommt der Hass?"
Aus dem Französischen von Christiane Kayser
(c) DIE ZEIT 10.11.2005 Nr.46
Online-Flyer Nr. 18 vom 16.11.2005
Druckversion
Globales
Warum junge Franzosen auf die Barrikaden gehen
Denn sie wissen, was sie tun
Von Tahar Ben Jelloun
Frankreich wird in diesen Tagen brutal aus dem Schlaf gerissen. Es erkennt, dass seine menschliche Landschaft nicht schneeweiß ist. Es erkennt, dass die Franzosen nicht nur ein bunter Haufen sind, sondern zu großen Teilen arm und vernachlässigt. Und doch: Die schwierigen Lebensbedingungen, die Arbeits- und Perspektivlosigkeit allein können den Aufstand von Clichy-sous-Bois, der längst auf andere Vororte und Städte übergegriffen hat, nicht erklären.
Diese zornige Jugend kommt von weit her, und das Problem ihrer Identität wiegt schwerer als das ihrer Armut. Diese Jugendlichen sind nicht einmal hin- und hergerissen zwischen zwei Ländern, zum Beispiel Algerien und Frankreich. Nein, sie können sich weder mit dem einen noch mit dem anderen identifizieren. Frankreich ist ihre Heimat, doch das Land erkennt sie nicht an und lässt sie nicht mit am Tisch sitzen. Sie fühlen sich ausgeschlossen und abgelehnt. Nun halten sie ihrer Heimat einen Spiegel vor, aber Frankreich will sich darin nicht wiedererkennen. Tatsächlich hat das Land nie eine ernst zu nehmende Einwanderungspolitik gehabt. Vor allem aber hat die französische Öffentlichkeit sich nie vor Augen geführt, dass Einwanderer Kinder auf die Welt bringen und dass diese Kinder keine Einwanderer, sondern waschechte Franzosen sind.
Reaktion auf eine Tragödie
Das Missverständnis ist total. Es drängen Probleme, die ihre Wurzeln in der jüngeren Geschichte haben und die nun von den Jugendlichen mit Gewalt ausgetragen werden. Ein Funke reicht, um den Aufstand in andere Wohngebiete zu tragen. Bereits im April gab es in Aubervilliers gewaltsame Aufstände und Kämpfe zwischen rivalisierenden Banden. Die Stimmung ist verseucht, und das schon seit langem. Egal, ob in Frankreich die Linke oder die Rechte an der Macht ist.
Beim geringsten Anlass rebellieren die Jugendlichen, verbrennen Autos, zerstören Einkaufszentren und zünden Mülleimer an. Dennoch sind sie keine »ziellosen Rebellen«, keine rebels without a cause. Sie wissen, was sie tun, denn sie reagieren auf eine Tragödie, auf ein offensichtliches Unrecht, wie in Clichy am 27. Oktober, als zwei Minderjährige von der Polizei verfolgt wurden und in einem Transformatorenhäuschen starben. Es war ein Unfall, sicher, doch er wäre nicht geschehen, hätten die Sicherheitskräfte die beiden nicht verfolgt.
Der Jugendarbeit das Geld gestrichen
Die Revolte, die dieser Vorfall auslöste, speist sich aus einer älteren Geschichte, die Frankreich weder wahrhaben noch anerkennen will: der zutiefst ambivalenten Beziehung zu Algerien. Doch heute haben die politischen und sozialen Spannungen, die aus dieser Geschichte erwuchsen, eine andere, gewaltsamere Dimension angenommen. Das heißt, dass Frankreich seine Arbeit nicht getan und sich nicht um jene Bevölkerungsteile geschert hat, die eigentlich nur eines wollen: in Würde und Frieden arbeiten und leben. Den Bürgerinitiativen und Vereinen, die mit jenen Jugendlichen arbeiteten, wurde das Geld gestrichen; auch die Kommunen haben immer weniger Geld für soziale und kulturelle Maßnahmen. Die Eltern sind zumeist macht- und hilflos. Ihre Kinder hören nicht mehr auf sie, und so müssen sie verzweifelt mit ansehen, wie ihre Söhne die Autos der Nachbarn anzünden.
Im Jahre 1983 organisierten Jugendliche aus Einwandererfamilien, die man auch beurs nennt, einen Marsch durch Frankreich, um Staat und Öffentlichkeit auf ihre Lebensbedingungen aufmerksam zu machen. Die Aktion wurde von SOS Racisme und Bürgerinitiativen unterstützt. Für die sozialistische Regierung war sie Ausdruck des Willens zur Integration. Einige Vertreter wurden von Ministern empfangen, es gab vollmundige Versprechungen. Die Jugendlichen kehrten in ihre Vororte zurück. Es änderte sich nichts. Die beurs erlebten eine Enttäuschung nach der anderen. Manche, die sich verlassen und ungerecht behandelt fühlten, erlagen der Versuchung des schnellen Geldes. Sie drifteten ab - an die Ränder der Gesellschaft. Ob in Vénissieux, Straßburg oder den Pariser Vororten, ein Teil dieser in der Schule gescheiterten Jugendlichen ging den Weg der Gewalt: abgebrannte Autos, Drogenhandel, Straßenschlachten mit der Polizei.
All dies hätte man wissen können. Ende der achtziger Jahre gründeten junge französische Soziologen verschiedener Herkunft die Vereinigung Banlieuscopie mit dem Ziel, die Vororte zu beobachten und zu analysieren, um den Behörden Vorschläge zur Lösung der Probleme zu machen. Doch für die Regierung stellte sich das Ganze nur als Sicherheitsproblem dar, als Störung der öffentlichen Ordnung. Ihre Antwort war und ist - Repression.

Innenminister Nicolas Sarkozy:
Mit dem Hochdruckreiniger!
Gouv.Fr. - Foto: afp
Islamisten versprechen den Jugendlichen neuen Lebenssinn
So verstaubten die Berichte von Banlieuscopie in den Aktenschränken. Unterdessen gewann die rechtsextreme Partei Front National an Zulauf und an Stimmen. Sie nutzte die Lage in den Vororten, um ihre Anhänger zu mobilisieren. Zugleich entwickelte sich ein neues Phänomen: der Islamismus. Imame gaben einer orientierungslosen Jugend ohne klare Werte und Visionen eine neue Hoffnung und eine neue Identität. Das ist der Grund, warum manche Jugendliche mit Frankreich und seinem Gesellschaftsmodell gebrochen und sich in der islamischen Bewegung engagiert haben. Sie gibt ihrer Existenz einen Sinn.
Die Vereinigung Banlieuscopie ging unter. Privatinitiativen retteten manche Jugendlichen, doch das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Rassismus und Gesetzesbruch fielen auf fruchtbaren Boden - und das in Wohnvierteln, die sich chronisch in einem heruntergekommenen Zustand befinden. Die Generation der Eltern besteht zum Großteil aus Analphabeten und lebt in einem kulturellen Vakuum. Deshalb sind die Jugendlichen, ob sie aus nord- oder schwarzafrikanischen Familien stammen, dazu verurteilt, ein Leben als ausgestoßene Rebellen zu führen.
Sarkozy: "Mit dem Hochdruckreiniger säubern"
Innenminister Nicolas Sarkozy, der die soziale und konfliktlösende Rolle der Polizei in den letzten Jahren unterminiert und durch rein repressive Aktionen ersetzt hat, will den Franzosen beweisen, dass er der Garant ihrer Sicherheit ist. Er war es, der erklärte, die Cité de la Courneuve, einen schwierigen Pariser Vorort, mit dem Hochdruckreiniger säubern zu wollen. Kurz vor den tragischen Ereignissen in Clichy bezeichnete er die zornigen Jugendlichen in Argenteuil als »Abschaum«.
Dieses Vorgehen, vor allem aber seine Ausdrucksweise zeigen, dass Sarkozy entweder die Beherrschung verloren hat oder den Wählern der extremen Rechten eine Botschaft zukommen lassen will, denn in zwei Jahren sind Präsidentschaftswahlen. Wie er so schön sagt: »Ich halte keine Reden, ich handle und begebe mich an Ort und Stelle.« Azouz Begag, der Stellvertretende Minister zur Förderung der Chancengleichheit, hat offen die Methoden und die Sprache Sarkozys kritisiert, ohne dass ihm Premierminister de Villepin daraus einen Vorwurf gemacht hätte: »Es ist nicht uninteressant zu sehen, dass die beiden Minister nicht das gleiche Frankreich im Visier haben.«
Der Schriftsteller und Soziologe Azouz Begag weiß, wovon er spricht, denn ihm sind die Jugendlichen aus den Vororten vertraut. Er wurde als Sohn algerischer Zuwanderer in der Nähe von Lyon geboren und kennt die Leiden jener jungen Leute, die Frankreich nicht als die seinen anerkennen will. Jedes Mal wenn sie demonstrieren, schickt man ihnen die Polizei auf den Hals. Manche Banden nutzen das, um Schaukämpfe gegen andere Banden zu organisieren. Inzwischen ist das Terrain fast vollständig vermint; von öffentlicher Sicherheit kann kaum mehr die Rede sein.
Plünderer und Brandstifter müssen vor Gericht gestellt werden
Noch einmal: Die randalierenden Jugendlichen sind keine Ausländer und auch keine Einwanderer. Sie sind unterprivilegierte Franzosen, deren Schicksal bestimmt wird durch Armut, ungesunde Wohnbedingungen und eine Vorgeschichte, die ihnen zum Handicap wird. Sie sind Franzosen zweiter Klasse, die in der Schule scheitern. Kaum fünf Prozent der Einwandererkinder schaffen es an die Universität. Einige wurschteln sich durch, andere führen ein Dasein als Kleinkriminelle. Sie wissen, dass sie nicht akzeptiert werden und dass Herkunft und Status ihnen den Zugang zu den Grandes Ecoles verwehren, mehr noch: ihnen nicht einmal eine normale berufliche Karriere ermöglichen.
Nun hatte Nicolas Sarkozy am 26. Oktober in seinem Ministerium eine Tagung zur »positiven Diskriminierung à la française« organisiert, um den Rassismus an den Schulen und beim Berufseinstieg zu bekämpfen. Mich hatte er um eine Einleitungsrede gebeten. Da ich das Prinzip der Diskriminierung - ob positiv oder negativ - ablehne, forderte ich, dass sich die Mentalität der Franzosen ändern müsse und sie die neue Wirklichkeit akzeptieren müssten: Frankreich sei ein Land, dessen »menschliche Landschaft« sich verändert habe. Seine Zukunft liegt in der Vermischung mehrerer Farben, Düfte und Gewürze. Aus diesem Grund bin ich auch gegen das Vorlegen anonymer Lebensläufe bei Bewerbungen. Im Gegenteil, der französische Staatsbeamte soll wissen, dass der Stellenbewerber Mohamed heißt, Franzose ist und dass allein seine Fähigkeiten und Kompetenzen zählen. Alles andere ist für mich ein
Zugeständnis an den Rassismus.
Doch der Minister hat es eilig. Er will rasche Lösungen, will die Franzosen mit seinen Auftritten vor Ort beeindrucken, denn er befindet sich bereits im Wahlkampf. Repression aber löst die Probleme der Jugendlichen nicht; sie sorgt nur für Eskalation. Stattdessen brauchen wir eine neue Politik, die die Wirklichkeit anerkennt und den revoltierenden Bevölkerungsteil in die Zukunft unseres Landes einbindet. Denn diese Jugendlichen erklären laut und deutlich, ihre Heimat sei Frankreich. Doch Frankreich hört diesen Ruf viel zu selten. Das rechtfertigt keine Gewalt. Plünderer und Brandstifter müssen vor Gericht gestellt werden - aber vor ein Gericht, dessen Urteil nicht von vornherein feststeht.
Der Autor ist der bekannteste marokkanische Schriftsteller. 1944 in Fes geboren, wanderte er Anfang der siebziger Jahre nach Paris aus. Zuletzt erschien von ihm im Rowohlt Verlag "Papa, woher kommt der Hass?"
Aus dem Französischen von Christiane Kayser
(c) DIE ZEIT 10.11.2005 Nr.46
Online-Flyer Nr. 18 vom 16.11.2005
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE