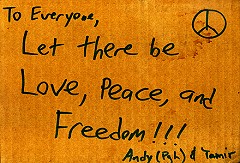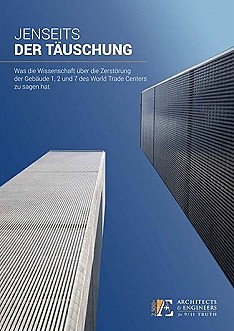SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Kultur und Wissen
Laudatio für Prof. Georg Meggle zur Verleihung der Ehrenpräsidentschaft der Gesellschaft für Analytische Philosophie (gap), Salzburg, 14. Juli 2019
Konzessionsloser Mut zur freien öffentlichen Rede
Von Reinhard Merkel
 Vom 12. bis 14. Juli 2019 fand das Salzburger Symposium "Analytische Explikationen & Interventionen" mit und für Georg Meggle statt. Zwei Tage Vorträge, ein Orgelkonzert und die Verleihung der Ehrenpräsidentschaft der Gesellschaft für Analytische Philosophie (gap) an den Philosophen Georg Meggle, der in diesem Jahr 75 geworden ist, standen auf dem Programm. Reinhard Merkel spricht von Georg Meggles konzessionslosem Mut zur freien öffentlichen Rede, vom Mut als verpflichtender Maxime alles öffentlichen Räsonierens, um dann zu betonen: "Jemanden, der ihr unbeugsamer entspräche als Georg, kenne ich nicht." Und: "Georg ist nicht nur ein Theoretiker, er ist auch ein Praktiker der Kommunikation, nämlich des offenen, von keinen disziplinären Schranken bedrängten Austauschs von Argumenten", heißt es in der Laudatio, die Reinhard Merkel, Professor em. für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg, am 14. Juli 2019 in Salzburg auf Georg Meggle hielt. Die NRhZ bringt sie nachfolgend in vollem Umfang - illustriert mit Fotos der Arbeiterfotografie.
Vom 12. bis 14. Juli 2019 fand das Salzburger Symposium "Analytische Explikationen & Interventionen" mit und für Georg Meggle statt. Zwei Tage Vorträge, ein Orgelkonzert und die Verleihung der Ehrenpräsidentschaft der Gesellschaft für Analytische Philosophie (gap) an den Philosophen Georg Meggle, der in diesem Jahr 75 geworden ist, standen auf dem Programm. Reinhard Merkel spricht von Georg Meggles konzessionslosem Mut zur freien öffentlichen Rede, vom Mut als verpflichtender Maxime alles öffentlichen Räsonierens, um dann zu betonen: "Jemanden, der ihr unbeugsamer entspräche als Georg, kenne ich nicht." Und: "Georg ist nicht nur ein Theoretiker, er ist auch ein Praktiker der Kommunikation, nämlich des offenen, von keinen disziplinären Schranken bedrängten Austauschs von Argumenten", heißt es in der Laudatio, die Reinhard Merkel, Professor em. für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg, am 14. Juli 2019 in Salzburg auf Georg Meggle hielt. Die NRhZ bringt sie nachfolgend in vollem Umfang - illustriert mit Fotos der Arbeiterfotografie.

Verleihung der Ehrenpräsidentschaft der Gesellschaft für Analytische Philosophie (gap) an den Philosophen Georg Meggle (alle Fotos: arbeiterfotografie.com)
Lieber Georg, liebe Marianne, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Festversammlung!
„Unwahr wie ein Festredner“ sagt August Strindberg einmal boshaft über seinen norwegischen Schriftsteller-Kollegen Björnson - und Sie werden jetzt denken: „Was für ein ungeschickter Anfang für eine Festrede!“. Und damit haben Sie eigentlich ganz recht. Aber wo finde ich diesen Satz? Ich finde ihn in einer Festrede – nämlich der Thomas Manns zum 200. Geburtstag Goethes. Dann wird es, denkt man sich, schon eine Bewandtnis damit haben, wenn ein so bedeutender Festredner seine Laudatio auf einen noch bedeutenderen Anderen mit einem solchen Satz beginnt. Lügen die Festredner? Man versteht den Verdacht ganz gut und findet ihn auch halbwegs plausibel. Und eigene Erfahrungen in diesem Metier habe ich, offen gestanden, bislang kaum. Kurz, so genau weiß ich das nicht. Aber ich will mir Mühe geben der Maxime zu folgen, die Thomas Mann dem Strindberg-Wort über die unwahren Festreden beigibt: „Wir wollen es“, sagt er, „nicht noch einmal wahr machen, sondern selbst am [Festtag] um Wahrheit bemüht bleiben und trachten, den Gefeierten in ihrem Licht zu sehen.“
Aber wie macht man das? „Licht der Wahrheit“ ist ein großes Wort, das Thomas Mann wohl anstehen mag, wenn er über Goethe spricht, aber uns, die wir heute nicht vermessen sein wollen, vielleicht nicht. Also will ich bei dem bescheideneren Licht meiner eigenen Möglichkeiten bleiben und sehen, wohin es fällt und was an seinem Gegenstand es erhellen mag, wenn ihm keine systematische Idee die Richtung weist, sondern nichts als der unbefangene, ganz und gar persönliche, auf drei Jahrzehnte des Einander-Kennens zurückschauende und, wenn man so will, selber neugierige Blick des sich erinnernden Freundes.
*
Im Frühjahr 1989 - ich befand mich gerade in einer etwas extravaganten Schleife meiner beruflichen Biographie, nämlich im Redaktionsbau der Hamburger ZEIT - lag auf meinem Schreibtisch eine Notiz. Ein Professor Meggle aus Saarbrücken habe angerufen: ob er mit jemandem sprechen könne, der zuständig sei für Hochschulen, Wissenschaftspolitik und dergleichen; er freue sich über einen Rückruf.

Verleihung der Ehrenpräsidentschaft
Nun war mir der Name Georg Meggle bereits ein Begriff, und mehr als das: ein Name, auf den jener exklusive Schein zeitgenössischer Aufklärung fiel, den damals (jedenfalls für mich) das Haus Suhrkamp ausstrahlte und der vor allem dessen philosophische Autoren mit einer besonderen Aura umgab. Einige Bücher, die mir den Namen Georg Meggle als den eines rechtmäßigen Insassen jener lichtvollen Sphäre nahegebracht hatten, kannte ich bereits: das mit Günther Grewendorf herausgegebene zur Metaethik, die Sammlung von Aufsätzen zur Analytischen Handlungstheorie und vor allem den Diskussionsband zu Georg Henrik von Wrights „Erklären und Verstehen“ mit Georgs Beitrag zur Theorie der Handlung. Ich hatte von Wright ein paar Jahre zuvor persönlich kennengelernt, eine Begegnung, die zu den Glücksfällen meines Lebens gehört, und kannte sein Buch in Georgs und Günther Grewendorfs Übersetzung.
Auf all das dürfte die Notiz auf meinem Schreibtisch das Streiflicht einer vorüberhuschenden Erinnerung geworfen haben. Ich bin sicher, dass ich zunächst mein Herzklopfen beruhigen musste, bevor ich mich traute, den Professor aus Saarbrücken anzurufen.
Was er mir dann erzählte, gehört in die Vorgeschichte jener Begebenheiten, die als „Singer-Affäre“ unter den jüngeren kulturhistorischen Wunderlichkeiten dieses Landes einen besonderen Rang einnehmen. Im Ganzen mögen sie hier auf sich beruhen. Den meisten der Anwesenden sind sie ohnehin bekannt; denn sie gehören ihrerseits in die Vorgeschichte der Gründung der GAP. Mir freilich, dem Zeugen und Zaungast dieser Gründung, waren sie damals - neben allem, was sie noch waren - auch der szenische Hintergrund, vor dem ich zum ersten Mal eine Linie im Charakterprofil Georg Meggles wahrnahm, ohne die ich ihn mir seither nicht denken kann: die des konzessionslosen Mutes zur freien öffentlichen Rede. Mehr als 20 Jahre später hat er selbst am Ende eines Vortrags an der Deutschen Universität in Kairo über die „Zeiten des Umbruchs“ diesen Mut als verpflichtende Maxime alles öffentlichen Räsonierens markiert. Jemanden, der ihr unbeugsamer entspräche als Georg, kenne ich nicht.

Laudator Reinhard Merkel
Es war dieser Mut, womit er damals Singers Vortrag in Saarbrücken gegen militante Störer durchsetzte und den nachfolgenden, noch hässlicheren Formen journalistischer Aggression und hochschulpolitischer Nötigung standhielt. Man wird den dramatischen Tonfall solcher Wendungen für akademische Querelen vielleicht übertrieben finden, aber für diese Querelen ist er’s nicht. Ich bewahre drei Aktenordner mit Zeitungsartikeln, Briefen, Rektoratserlassen, und dienstrechtlichen Maßregelungen von ehedem auf – ein finsteres Verließ; Zeugnisse eines öffentlichen Geisteszustands, der künftigen Kulturhistorikern hinreichend Stoff zur kopfschüttelnden Befassung böte. Hier ist ein Beispiel:
„Landtag von Baden-Württemberg, 10. Wahlperiode, Drucksache 10/6122 vom 25. Oktober 1991
Antrag der Abgeordneten XY u.a. (Fraktion der SPD). […]
Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen, zu berichten,
1. ob die Beobachtung zutrifft, daß ausgehend von den USA, insbesondere von angelsächsischen Instituten wie etwa [folgen diverse Namen], allgemein aber ausgehend von Teilen der angelsächsischen Philosophie sich eine ethische Lehre verbreitet, die […] unter Namen wie „applied ethics“, „angewandte Ethik“, „Bioethik“, „Praktische Ethik“, teilweise auch als „Angelsächsische Analytische Philosophie“ zunehmend auch an deutschen Universitäten rezipiert wird;
2. ob die Landesregierung die Auffassung teilt, daß die Grundlagen dieser Lehre mit den Normen des Grundgesetzes, insbesondere mit Art. 1 GG, nicht vereinbar sind;
3. wie unbeschadet der Freiheit der Wissenschaft verhindert werden kann, daß unter dem Einfluß dieser Lehre eine verfassungswidrige Zielvorstellung zur faktischen Grundlage von Forschung und Lehre […] werden kann.“
In der Begründung heißt es dann:
„Vertreter dieser Schule sind u.a. Prof. Georg Meggle, Saarbrücken; Prof. Ernst Tugendhat, Berlin; Prof. Ursula Wolf, Berlin […].“
Für den Herbst desselben Jahres 1991 war in Kirchberg am Wechsel das 15. Internationale Wittgenstein Symposion geplant. Monate vorher forderte der Präsident der Österreichischen Wittgenstein-Gesellschaft Adolf Hübner in einem Rundschreiben das Präsidium der Gesellschaft auf, die Philosophen Singer, Hare und Meggle, die zu dem Symposion eingeladen waren, wieder auszuladen. „Die analytische Philosophie“, heißt es da, „hat Auswüchse wie Peter Singer hervorgebracht, und von diesen muss [sie] sich abgrenzen.“ […] „Mit der Aufrechterhaltung der Einladung an Herrn Singer, Herrn Hare und Herrn Meggle könnte sich die analytische Philosophie selbst einen Schlag versetzen, von dem sie sich möglicherweise jahrzehntelang nicht mehr erholen wird.“ Nun waren freilich andere österreichische Philosophen, Rudolf Haller etwa und Edgar Morscher von der hiesigen Universität, wie man heute sagt, not convinced. Sie lehnten die Ausladung der drei Häretiker ab. Das wiederum versetzte dem geplanten Wittgenstein Symposion einen Schlag, von dem es sich nicht erholte. Es wurde abgesagt.
Ein Jahr zuvor war die GAP gegründet worden. Georg hat mir damals erzählt, die Erfahrungen in der Singer-Affäre hätten zu seinen Motiven für die Gründung der Gesellschaft gehört: ein Notwehrmotiv der Vernunft. Zur konstituierenden Versammlung im Mai 1990 in Berlin hat er mich ganz unverdient eingeladen. Vieles was damals erörtert wurde, habe ich vergessen. Unverlierbar ist mir aber die Erinnerung an die Intensität des Argumentierens, Überzeugens und manchmal auch Überredens, kurz, und in Georgs eigener Formulierung, die zielstrebige Hemdsärmeligkeit, mit der er die dreitägige Sitzung geleitet und zum Erfolg geführt hat.

Verleihung der Ehrenpräsidentschaft
Hinterher habe ich ihm gesagt, er sei gewiss eines der größten politischen Talente, die mir je begegnet seien, und ich würde auf seinen Erfolg in den einschlägigen Sphären wetten, sollte ihn je der entsprechende Ehrgeiz anwandeln. Heute weiß ich, wie falsch das war. Nicht eigentlich das Attest des politischen Talents, wohl aber die hypothetische Erfolgsprognose. Der nachgerade naive Mut des freien Denkens und Sprechens, die Unfähigkeit zum taktischen Opportunismus, die kompromisslose Renitenz des Wahrheitssuchers - sie hätten Georgs Weg in der Politik kurz und aussichtslos gemacht.
*
Er ist eben, im Gegenteil, ein Philosoph. Aber was, so hat man gut Meggleanisch nun zu fragen, ist eigentlich ein Philosoph? Das gehört bekanntlich zu den eher rätselhaften Gegenständen der Philosophie selbst. Das Spektrum möglicher Formen, das sie ihren Betreibern bietet, ist staunenswert weit. Ein Philosoph, sagt André Gide einmal, ist jemand, nach dessen Antwort auf eine ihm gestellte Frage man nicht mehr versteht, was man ihn eigentlich gefragt hat. Ein solches Selbstbild würde Georg wenig gefallen. Am Anfang seiner autobiographischen Erinnerung „Die Philosophie und ich“ heißt es lakonisch: „Ich bin analytischer Philosoph – jemand dem unter vielen Dingen, die ihm beim Philosophieren wichtig sein mögen, Klarheit und Deutlichkeit am wichtigsten sind.“
Aber stimmt das? Ist das die Maßgabe für analytisches Philosophieren? Ist Wittgensteins „Tractatus“ ein klarer und deutlicher Text? Und sind es seine „Philosophischen Untersuchungen“? In einem langen Gespräch, das ich Mitte der achtziger Jahre mit Hilary Putnam geführt habe, sagte er mir: “This is perhaps one of the bestkept secrets in philosophy: philosophy doesn’t make things clear; it makes things mysterious.“

Laudator Reinhard Merkel – im Hintergrund Marianne Manda und Georg Meggle
Wer hat recht? Nun, ich denke, beide. Philosophie, so wird man mit dem berühmten Einleitungssatz Kants zur Vorrede seiner „Kritik der Reinen Vernunft“ wohl sagen dürfen, Philosophie befasst sich mit den Fragen, von denen die menschliche Vernunft belästigt wird, ohne sie abweisen, aber auch ohne sie beantworten zu können. Ihre Aufgabe ist es, diese Fragen zu entschlüsseln, ihre dunklen Hinterländer zu erhellen, sie auch dem transparent zu machen, der sie (wie André Gide) glaubt selbst nicht mehr zu verstehen, wenn der Philosoph sie ihm beantwortet hat – kurz: die Klärung solcher Fragen und ihrer Antworten bis zu jener Grenze des Sagbaren zu treiben, hinter der erneut, und nun erst wirklich beginnt, was Putnam das Mysteriöse nennt. Sich und andere dorthin zu führen, ist das Geschäft des Philosophen, und ob man es „analytisch“ nennt oder nicht verschlägt nicht viel. „Jede gute Philosophie“, hat mir Günther Patzig einmal gesagt, „ist auch analytisch“. Putnam hätte zugestimmt. Jahre nach jener Bemerkung über das Mysteriöse als Ziel des Philosophierens hat er in seiner Münchener Kant-Lecture am Beispiel Wittgensteins eine schlagende Definition dessen gegeben, was einen großen Philosophen ausmacht, nämlich diese: „Wenn ich ihn lese, werde ich klüger; und er wird es auch – und es kommt der Moment, da er anfängt, mir meine Ideen zu stehlen.“
Das ist gewiss ein hohes Lob für das besondere Erlebnis philosophischer Klärung. Georg dürfte es gefallen. Einen Dissens zwischen ihm und Hilary Putnam über Analyse, Klarheit und Mysterien des Philosophierens können wir, glaube ich, ausschließen.
*
Welche Fragen, Probleme und Rätsel der Grenze sind es aber, über die Georg in den Jahrzehnten seines Philosophierens sich und anderen Klarheit zu verschaffen unternommen hat? Sein „philosophisches Oeuvre“, schreibt Julian Nida-Rümelin in der vor zehn Jahren erschienenen Festschrift, „umfasst drei Teile: eine an Grice orientierte Konzeption der Kommunikation, Beiträge zu Themen der angewandten Ethik sowie Gründung und Aufbau der GAP“. Das ist ein wenig knapp und grob, aber nicht verkehrt; und der Titel der Festschrift „Handeln mit Bedeutung und Handeln mit Gewalt“ überschreibt die ersten beiden Themenkreise ja anschaulich. Den dritten, die Gründung der GAP, haben wir schon inspiziert und wollen es dabei belassen. Aber in Julians Liste fehlt etwas. Im strengen Sinn zum „Oeuvre“ Georgs muss man es vielleicht nicht rechnen. Doch die Beschreibung des Philosophen selbst, des Menschen hinter dem Werk, wäre unzulänglich, fehlte ihr diese Kontur. Ihren sinnbildlichen Ausdruck finde ich im zweiten jener beiden Sätze, die Georg selbst als Wegmarken seiner philosophischen Entwicklung bezeichnet. Am Ende seines Studienjahres in Oxford, nach dem Abschiedsbesuch bei seinem Supervisor Richard Hare, begleitet ihn dessen Frau zum Omnibus, und ruft ihm, als er den Bus schon bestiegen hat, durch die sich schließende Tür nach: „Give priority to life!“. Das ist ein merkwürdiger Satz. Wir wollen ihn, wenn wir Georgs philosophisches Werk nun ein wenig genauer betrachten, nicht aus den Augen verlieren und werden später auf ihn zurückkommen.
*
„Grundbegriffe der Kommunikation“ und „Handlungstheoretische Semantik“: die Titel der Dissertation von 1979 und der Habilitationsschrift von 1984 bezeichnen den Inhalt des ersten, noch immer umfangreichsten Teils des bisherigen Meggleschen Lebenswerks. Dazu haben wir in den vergangenen Tagen manches gehört, und den meisten Anwesenden hier sind zumindest die Grundzüge von Georgs intentionalistischer Bedeutungstheorie bekannt. Mir schon auch, wenn ich das so unbescheiden sagen darf, wiewohl ich das Geständnis nachschieben muss, dass ich mit meinen Versuchen, mir die genaue Ausarbeitung dieser Grundlagen zu erschließen, halbwegs gescheitert bin. Das ist nicht Georgs Darstellung anzulasten, sondern meiner Unbeholfenheit im Umgang mit jenen formalen Instrumenten der Analyse, die manche, sei es lobend oder tadelnd, für eine differentia specifica der analytischen Philosophie halten und die jedenfalls der junge Georg Meggle mit sichtlicher Lust am Spiel der Formen und Formeln zu handhaben wusste und liebte.
Den Versuch einer genaueren Rekonstruktion von Georgs Lehre will ich daher nicht riskieren. Erinnern möchte ich aber an das Urteil berufenerer Zeugen, Franz von Kutscheras etwa oder Jonathan Bennetts: Georgs Arbeiten zur Kommunikationstheorie und Semantik seien die erste vollständige Durchführung der einschlägigen Grundprogramme, die Paul Grice und David Lewis entworfen haben. Was das bedeutet, kann auch der halbwegs ermessen, der sich nicht anmaßen darf, die Richtigkeit des Urteils zu überprüfen, aber andere gute Gründe kennt, Bennett und von Kutschera in solchen Fragen zu vertrauen.
Der Intentionalismus Megglescher Provenienz begreift menschliche Kommunikation als besondere Form zielgerichteten Handelns und ihre soziale Praxis als Quelle sprachlicher Bedeutungen: eine im Wortsinne pragmatische Semantik, im Gegensatz zu ihren realistischen Antipoden, nach deren Auffassung die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke in ihrer regelhaften Verknüpfung mit außersprachlichen Gegenständen gründet. Dass die erstere den Vorzug verdient, hat übrigens vor fast 250 Jahren schon Lichtenberg gewusst. „Ist es nicht sonderbar“, schreibt er in seinem Sudelbuch G, „daß eine wörtliche Übersetzung fast immer eine schlechte ist? Und doch lässt sich alles gut übersetzen. Man sieht hieraus, wieviel es sagen will, eine Sprache ganz verstehen; es heißt, das Volk ganz kennen, das sie spricht.“ Seit dem späten Wittgenstein sind die Vorzüge pragmatischer Semantiken oft gezeigt worden - und die ihrer intentionalistischen Variante, wenn ich recht sehe, seit Georg Meggles großem Entwurf ebenfalls.
Nun behaupten Intentionalisten wie Georg freilich eine Reichweite ihrer Konzeption weit über den speziellen Handlungstypus der Kommunikation hinaus. Alles Handeln müsse und könne nur im Modus intentionalistischer Deutungen verstanden werden. Der Gegner sind kausalistische Handlungserklärungen - nach Donald Davidsons einflussreichen Wortmeldungen in den sechziger und siebziger Jahren die heute wohl vorherrschende Auffassung in der Handlungstheorie. Knapp und grob lässt sich der Streit so skizzieren:
Beide Seiten teilen eine Prämisse: „Handlung“ kann ein Verhalten nur sein, wenn es seitens des Akteurs aus einem bestimmten Grund geschieht. Der Streit beginnt bei der Frage nach der Beziehung zwischen Grund und Handlung. Kausalisten nehmen an, handlungserklärend seien Gründe nur, wenn und soweit sie für den Vollzug der Handlung ursächlich waren. Das lehnen Intentionalisten ab: Was ein Verhalten zur Handlung mache, sei allein seine Intentionalität, seine Orientierung an dem mit ihm verfolgten Ziel. Sie sei aber logischer Bestandteil des Handlungsvollzugs selbst, in ihn integriert und schon deshalb nicht als seine Ursache begreifbar. Ein physisches Geschehen als Handlung verstehen heiße, seinen Sinn für den Handelnden erfassen. Die Feststellung kausaler Abläufe sei dazu schon prinzipiell nicht geeignet.
Warum sage ich Ihnen das? Nun, aus zwei Gründen. Zum einen, weil Georg auch zu dieser Debatte Wichtiges beigetragen hat, am eindrucksvollsten in dem meisterlichen Disput mit Georg Henrik von Wright 1987 in Münster, der zunächst in der Zeitschrift „Rechtstheorie“ und dann in von Wrights Buch „Normen, Werte und Handlungen“ im Druck erschienen ist. Und zum andern deshalb, weil handlungstheoretische Grundfragen naturgemäß den Strafrechtler auf den Plan rufen, mich zum Beispiel. Zu den Grundbegriffen des Strafrechts gehört „Handlung“ ja ersichtlich in einem noch handfesteren Sinn als zu denen des Sprachphilosophen. Und genau genommen gibt es nun noch einen dritten Grund für meine etwas unbescheidene Einmischung an dieser Stelle: Georg ist nicht nur ein Theoretiker, er ist auch ein Praktiker der Kommunikation, nämlich des offenen, von keinen disziplinären Schranken bedrängten Austauschs von Argumenten. Vor allem seine Schriften zur angewandten Ethik suchen immer wieder den Blickwechsel mit Juristen – mit Völkerrechtlern etwa, wenn es um Krieg und Frieden geht, aber auch mit Strafrechtlern, wenn Begriffe wie Notwehr und Notstand ins Spiel der Argumente kommen. Dazu später noch ein Wort.

Verleihung der Ehrenpräsidentschaft
Vorweg mag er und mögen Sie mir aber eine kleine, skeptische Marginalie zur Handlungstheorie erlauben, nämlich eine aus der Sicht des Strafrechts. Dass eine Laudatio nicht der Ort für theoretische Dispute ist, versteht sich. Aber Georg ist eben auch kein gewöhnlicher Adressat einer solchen Ehrung. Und so mag er mir die kleine Anmaßung nachsehen - als Vorschlag eines Blickwechsels über die Grenzen der Disziplinen hinweg.
Bemerkenswert an dem erwähnten Münsteraner Disput war, dass sich beide Diskutanten, bei allen Differenzen im einzelnen, in ihrer Grundorientierung einig waren: der Verpflichtung auf intentionalistische Handlungskonzeptionen als die allein plausiblen. Georg war das übrigens noch entschiedener als Georg Henrik; er verteidige, sagt er, den früheren von Wright, den Intentionalisten der reinen Lehre, gegen den späteren, den beginnenden Zweifler. Georgs Grundgedanke ist einfach: „Eine (konkrete) Handlung verstehen heißt: die mit ihr verbundene Absicht kennen.“
Hier meldet sich der Strafrechtler und sagt folgendes: „Das stimmt für die meisten Handlungen, aber nicht für alle.“ Und sein rechtsphilosophischer Einflüsterer fügt hinzu: „Hier ist eine Grenze aller intentionalistischen Handlungstheorien: Sie passen erstens nicht für jedes Handeln, und sie vertragen sich zweitens mit den kausalistischen eigentlich nicht schlecht.“
Stimmt das? Nun, wir kennen viele Handlungen, die zwar in einem bestimmten Sinn intentionale sind, mit denen der Handelnde aber keinerlei Intention verbindet: keinen Zweck, kein Ziel, keine Absicht, keinen Sinn. Das gilt etwa für viele rein expressive Handlungen. Hier ein paar Beispiele: A springt vor dem Fernseher auf, als sein Fußballverein im laufenden Spiel ein Tor schießt; B tritt wütend gegen den Tisch, nachdem er seinen Steuerbescheid gelesen hat; C wirft beim Verlassen ihrer Wohnung eine Kusshand in Richtung eines Fotos ihres Freundes; D erinnert sich an eine für ihn beschämende Situation, hebt die Hände vors Gesicht und schüttelt den Kopf.
Keine dieser Handlungen verfolgt irgendeine Absicht. Handlungen sind sie gleichwohl, und, richtig verstanden, auch intentionale, in einem nun freilich etwas anderen Sinn: ihren Akteuren bewusst, von diesen willentlich ausgelöst und in ihrem Vollzug gesteuert. In von Wrights Münsteraner Worten: sie geschehen nicht unabsichtlich. Verstehbar sind sie jedoch nicht intentionalistisch, sondern allein über ihre Beweggründe: ihre auslösenden inneren Antriebe. In diesen manifestiert sich aber keinerlei Intention. Ihr Ursprung sind Emotionen - in meinen Beispielen Freude, Wut, Liebe und Scham. Deren Wirksamkeit im Handeln ist nur als kausale verstehbar.
Für manche der schwersten Verbrechen, die wir kennen, ist das von entscheidender Bedeutung. Wer intentional einen anderen Menschen tötet, ist Totschläger. Kennen wir diese Erklärung seines Handelns, so wollen wir freilich mehr wissen: Ist er sogar Mörder? Was waren seine Beweggründe? War die Handlung vielleicht nicht nur die Verwirklichung einer Tötungsintention, sondern außerdem die expressive und damit nicht-intentionale Manifestation eines Beweggrunds, den wir „niedrig“ nennen? Wer aus Rassenhass tötet, muss neben der Intention, zu töten, überhaupt keine weitere verfolgen. Und eine, die „Rassenhass“ hieße, ist schon begrifflich unmöglich. Wir verstehen eine solche Handlung aber erst dann hinreichend, wenn wir neben ihrer tödlichen Absicht auch ihren nicht-intentionalen, kausalen Beweggrund kennen: den Hass.
Der späte von Wright hat sich, wenn ich recht sehe, im Münsteraner Disput mit Georg dieser nur noch halb-intentionalistischen Auffassung angenähert. Ob Georg das auch hat, weiß ich nicht. Es könnte immerhin sein. Denn was ich weiß ist, dass er das Gegenteil eines schulphilosophischen Philisters der Unfehlbarkeit ist. Und dass auf ihn das Bild passt, das Günther Patzig in seinem Nachwort zu Carnaps „Scheinproblemen“ skizziert.
„Wenn wir im Garten einen Maulwurfshügel sehen, so dürfen wir annehmen, hier müsse ein Maulwurf gegraben haben. Unberechtigt wäre der Schluß, hier sei noch ein Maulwurf zu finden. Den Urheber des Hügels wird man unter ihm selten antreffen; er ist inzwischen anderswo tätig […]. Philosophische Schriften haben sonst nicht sehr viel mit Maulwurfshügeln gemein […], außer in diesem einen Punkt: die Werke eines Philosophen zeigen immer nur an, wo er einmal gewesen ist, was ihm einmal als wahr und wichtig erschien. Daß er auch heute noch genau dort wäre und daß sich seine Ansichten nicht geändert hätten, - diese Voraussetzung sollte man in jedem Falle erst prüfen.“
*
Damit kommen wir plausibel zu der zweiten Sphäre, in der Georg tief gegraben und markante Spuren hinterlassen hat: zur angewandten Ethik. Drei Themenkreise vor allem sind zu nennen: Krieg, Terrorismus und Genozid. Am Ende eines Vortrags vom 11. März 2003 zitiert er Thukydides und dessen „Geschichte des peloponnesischen Krieges“:
„Nach Bedarf ändern sie die Bedeutung der Wörter. Dumme Angriffslust gilt als mutige Aufopferung, vorausdenkendes Erwägen als Deckmantel der Feigheit. Wildes Draufgängertum hält man für Mannesart, wägendes Weiterberaten für schönklingenden Vorwand der Ablehnung.“

Verleihung der Ehrenpräsidentschaft
Wenige Tage nach Georgs Vortrag begann der Krieg gegen den Irak. Was er anrichtete, weiß die Welt. Auch er ging einher mit der euphemistischen Verfälschung zentraler Begriffe. Als „humanitär“, nämlich als Befreiung eines unterdrückten Volkes von seinem Tyrannen, wurde die Intervention deklariert, nachdem sich der zunächst genannte Kriegsgrund einer präventiven Selbstverteidigung gegen weapons of mass destruction als Lüge erwiesen hatte. „Ob wir wohl“, fragt Georg drei Jahre später, „aus den letzten Kriegen“ – den angeblich humanitären im Kosovo und im Irak – „[…] etwas gelernt haben?“ Und er fügt hinzu: „Wahrscheinlich so gut wie nichts.“ Der Titel des Aufsatzes, in dem er die Frage stellt, beglaubigt seine Antwort in beklemmender Aktualität: „Bomben auf den Iran?“
Die Entscheidung über die Legitimität einer militärischen Intervention, die als „humanitäre“ ausgegeben wird, will Georg, anders als die meisten Völkerrechtler, nicht allein dem Weltsicherheitsrat überantwortet wissen. Er reklamiert eine genuine Zuständigkeit des praktischen Philosophen. Und mit Recht. Dass ein Gremium aus 15 Mitgliedern, von denen fünf ein vollkommen willkürlich handhabbares Vetorecht haben, mit einer 2/3-Mehrheitsentscheidung die normative Rechtfertigung zwischenstaatlicher Gewalt sollte erzeugen können, ist schlechterdings nicht einzusehen. Daher kann es, wie Georg sagt, auch ohne Autorisierung durch den Sicherheitsrat legitime humanitäre Interventionen geben. Die militärische Verhinderung des Völkermordes in Ruanda vor 25 Jahren wäre trotz der Blockade des Sicherheitsrats durch ein angedrohtes Veto nicht nur legitim, sie wäre geboten gewesen. Und wie die Verweigerung einer Autorisierung, so kann auch deren Erteilung durch den Rat rechtlich wie ethisch falsch sein. Dann fehlt der Gewaltanwendung trotz ihrer Legalität die materielle Legitimation. So war das bei der NATO-Intervention 2011 in Libyen. Ein solches Verdikt fällt in die Zuständigkeit der Philosophie nicht weniger als in die des Völkerrechts.
Die im Wortsinne elende Verbindung zwischen humanitärer Intervention und Völkermord liegt auf der Hand. Gewiss ist der Begriff des Genozids im Völkerrecht wie in der politischen Propaganda durch seine inflationäre Ausdehnung auf Sachverhalte, für die er schlechterdings nicht passt, bis an die Grenze des Unbrauchbaren deformiert worden. Aber seine inkriminierende Wucht bezieht er für die meisten Menschen noch immer aus der Vorstellung seines massenmörderischen Urbilds. Und für manche staatlich betriebenen Vernichtungsaktionen hat das unvermindert seine Richtigkeit. Der Genozid der Türken an den Armeniern 1915 und 16 ist ein solcher Fall. Dass sich der Bundestag 2005 zur Bestätigung des historischen Befunds, wenngleich noch ohne Verwendung des Titels „Völkermord“, durchzuringen vermochte, hat Georg als Fortschritt anerkannt. Mit mindestens gleichem Recht attackiert er heute die infame Metamorphose der vom Sicherheitsrat gebilligten Blockade des Jemen zum Völkermord. Eine Neubefassung des Rats mit diesem Sachverhalt kann man ausschließen: Sie würde von einem Veto der westlichen Vormächte verhindert. Das alles ist trostlos. Was ein wenig Mut macht, zögerlich nur, aber immerhin, ist der Umstand, dass Stimmen wie die Georg Meggles dazu nicht schweigen. Von den meisten unserer Medien lässt sich das nicht behaupten.
„Terror und der Krieg gegen ihn“: damit überschreibt Georg selbst eine weitere Sphäre der Interferenz von angewandter Ethik und Völkerrecht, die ihn eingehend beschäftigt hat. Sie ist die verworrenste – psychologisch, politisch, rechtlich und philosophisch. Nur auf einen der finsteren Gänge in diesem Labyrinth, die Georg genauer erforscht hat, will ich ein flüchtiges Streiflicht werfen.
Es gibt, sagt Georg, entgegen einer geläufigen Überzeugung auch legitime Formen des Terrors. Er demonstriert das an der Unterscheidung dreier Modi terroristischen Handelns, die er „schwachen“, „starken“ und „extremen Terrorismus“ nennt. Was den schwachen Terrorismus legitimieren könne, sei der Umstand, dass sich seine Gewalthandlungen im Unterschied zu den beiden anderen Formen allein gegen legitime Ziele richteten, etwa gegen die Akteure einer despotischen Staatsmacht. Selbst das Zutodekommen Unschuldiger berühre diese Legitimität nicht notwendig – wenn nur der Täter von der tödlichen Nebenwirkung seines Tuns vorher weder etwas gewusst habe noch auch nur hätte ahnen können. Dann seien ihm solche kollateralen Opfer, wie Georg sagt, nicht im starken Sinne normativ zurechenbar.
Die Idee eines legitimen Terrors hat etwas Beklemmendes. Aber wer sie kategorisch verwirft, möge sich an Nelson Mandela erinnern, der in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Terroranschläge dieser Art gegen Institutionen des Apartheidsregimes ausgeführt hat. Tötungen unschuldiger Dritter hat er peinlich zu vermeiden gesucht. Seit Aristoteles werden solche Taten unter dem Signum kollektiver Notwehr erörtert und in Grenzen können sie gerechtfertigt sein. Mandela ist gewiss einer der plausibelsten Laureaten des Friedensnobelpreises. Auch das darf man als Beglaubigung für Georgs Argument empfinden.
Wer dagegen zur Erreichung selbst legitimer Ziele, etwa zur Beseitigung eines Despotenregimes, Terroranschläge begeht und dabei den Tod Unbeteiligter einkalkuliert, kann dafür ersichtlich kein Notwehrrecht reklamieren. Er externalisiert die Lebens- und Leidenskosten zur Behebung eines eigenen Notstands und zwingt sie Dritten auf: als quasi-solidarisches Opfer für seine Ziele. Diese mögen so legitim sein, wie man will: dafür sein Leben herzugeben kann niemand verpflichtet sein. Mit Recht verneint Georg die Rechtfertigung solcher Taten.
*
Wir sind bei unserer letzten Blickwende angelangt: der zu dem Menschen hinter dem philosophischen Werk. Erinnern wir uns: Give priority to life! - das war Catherine Hares Mahnung an den jungen Georg. Und dass er selbst diese Mahnung zur Maßgabe für sein Leben und Denken erklärt, mag uns nun zu diesem höchstpersönlichen Blick berechtigen.
Aber was bedeutet Priority to Life? Man wird bei jemandem wie Georg Leben und Denken nicht gut als unverbundenes Nebeneinander deuten können, das in eine Rangfolge zu bringen wäre. Von welchem Leben ist die Rede? Betrachten wir die Frage einmal nicht metaphysisch, sondern rein sprachlich. Catherine Hare hat nicht etwa gesagt: Give priority to living. Das wäre ein recht banaler Satz gewesen. Was lässt „life“ so gänzlich anders klingen? Wir sagen „das Kommen“ und „das Gehen“ und noch in „das Sterben“ bleibt der Infinitiv durch die Substantivierung hindurch hörbar. In „das Leben“ nicht mehr. Es ist ein Hauptwort im profundesten Sinn. Es hat den Infinitiv des Verbums, aus dem es entstanden ist, so vollständig absorbiert, dass er nicht mehr nachklingt. Das ist ein bemerkenswerter Vorgang. Und er mag als Signum des Rätselhaften genommen werden, das sich mit der Frage nach dem Leben und vor allem mit der berühmten nach dessen Sinn vor unseren Augen auftut.
Das ist nun freilich, wie man so sagt, ein weites Feld, und wir wollen es heute nicht mehr betreten. Aber das schönste Panorama davon, das ich kenne, ist der Band „Der Sinn des Lebens“, den Georg zusammen mit Ulla Wessels und Christoph Fehige vor fast 20 Jahren herausgegeben hat. Die zahlreichen Antworten, die er versammelt, scheinen mir den Sinn des Buchs in die Auskunft zu legen, dass der des Lebens ein Rätsel bleibt. „Der Mensch“, schreibt Hugo von Hofmannsthal drei Jahre vor seinem Tod, „lebt und wartet immerfort auf den Moment, der das Zweideutige und Vergängliche seines Lebens endgültig aufhebt, dann kommt der Tod.“ Vielleicht ist das so. Wir wollen es dabei belassen.
Aber vor dem Tod kommt – das Leben, und bildet den Charakter der Person, der es gehört. Und eine bestimmte Linie im Profil von Georgs Charakter nachzuzeichnen mögen Sie mir nun noch erlauben. Ich nenne sie, ein wenig riskant, die der Freundschaft. Das ist ein großes Wort und spätestens seit Platon ein großes Thema der Philosophie. Für Aristoteles ist Freundschaft bedeutsam genug, um als Komplement der Gerechtigkeit zu gelten. Kant sah in ihr „eine bloße, (aber doch praktisch-nothwendige Idee“, nach der zu streben „ehrenvolle Pflicht sei“. Und in Schopenhauers „Parerga und Paralipomena“ steht, „wahre Freundschaft“ gehöre zu den Dingen, von denen man „wie von den kolossalen Seeschlangen nicht weiß, ob sie fabelhaft sind, oder irgendwo existieren“. Lassen wir die Frage offen. Was ich aber kenne und erfahren habe, ist Georg Meggles – nun, nicht einfach Fähigkeit, sondern: genuine Disposition, lebendig-unmittelbare Neigung, ja, wenn ich recht sehe, seine charakterliche Bestimmung zur Freundschaft. Und da die allermeisten hier im Saal wissen, wovon dabei die Rede ist, bedarf es keiner weiteren Erläuterung. Sie würde zu weit führen und zu nah.
Aber auf ein Element, das zur wirklichen Freundschaft gehört, und auf seine dreifache Manifestation in Georgs Leben will ich hinweisen. Es heißt Treue. Auch das ist ein großes Wort und in seinen zahlreichen Bedeutungen seit eh und je ein veritabler Gegenstand philosophischen Räsonierens. Drei besondere Destinatäre kenne ich, denen Georg seine freundschaftliche Treue bewahrt hat und - ich habe keinen Zweifel - bewahren wird. Der erste Destinatär ist ein Plural, nämlich seine Freunde und Freundinnen wie Sie und ich. Der zweite ist nach Georgs eigenem Bekunden seine Allgäuer Heimat, und ich, dessen Heimat die oberfränkische Provinz ist, kann nur sagen, dass ich ihn hier genau verstehe. Der dritte ist seine Vision eines künftigen Eurabiens: die endliche Versöhnung der drei abrahamitischen Kulturen des Judentums, Christentums und Islams. Georg ist, Sie wissen es, auch ein großer Brückenbauer, einer zwischen Abend- und Morgenland, wenn der ehrwürdige Titel noch gestattet ist. Ich wüsste dafür kein schöneres Epitheton als die erste Strophe in Goethes Gedicht über die „Talismane“ in seinem Westöstlichen Divan, und ob man ihr und ihm einen religiösen Unterton abhören mag oder nicht, ist ganz gleichgültig:
Gottes ist der Orient! Gottes ist der Okzident! Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände.

Marianne Manda und Georg Meggle – dahinter Thomas Grundmann (gap-Präsident von 2015 bis 2018)
Lassen Sie mich schließen mit einem Sinnbild dessen, was sich hier zu Freundschaft und Treue nur andeuten, nicht wirklich sagen lässt. Es ist ein winziges Prosastück meines alten Freundes Werner Kraft, deutsch-jüdischer Dichter, Freund Walter Benjamins und Gershom Scholems, 1933 vor Hitler nach Palästina geflohen und 1991 dort, fast hundertjährig, gestorben. Es heißt „Treue“:
Ich habe vor vielen Jahren in einer Zeitung eine kleine chinesische Geschichte gelesen, deren Autor ich vergessen habe. […] Ein deutscher Kaufmann in Tsingtau mußte zu Beginn des Ersten Weltkriegs plötzlich das Land verlassen und alle seine Habe einem chinesischen Diener anvertrauen. Als er nach dem Kriege zurückkommt, sieht er am Hafen den Diener sitzen und ihn begrüßen. Er ist maßlos erstaunt und fragt ihn, was er hier tue. Der Diener sagt: „Ich warte auf dich.“ Der Herr fragt ihn, wie er denn wissen konnte, wann er komme. Der Diener sagt: „Aber du bist ja gekommen, Herr!“
Dieser Diener war in einem erhabenen Sinne treu. Er wußte nicht, was die Zeit ist, er wußte, was die Sprache ist, und diese streicht alles Unwesentliche aus. Wir könnten von ihr, wir könnten von ihm lernen, wenn wir nur wüßten, wie das anzufangen sei. Dieser Diener fing an und hörte nicht auf treu zu sein. Er stellte keine Frage. Er gab die Antwort.
Haben Sie vielen Dank!
Zu Reinhard Merkel
.jpg)
Reinhard Merkel (*1950), Professor em. für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg. Nach dem Studium Assistent am Institut für Rechtsphilosophie der Universität München, dann eineinhalb Jahre Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit (1988-1990); danach Rückkehr an die Universität. 1996 Habilitation an der Universität Frankfurt/M. Forschungsschwerpunkte: Dogmatik des Strafrechts; Rechtsphilosophische Grundlagenforschung; Recht und Ethik in der Medizin und in den Neurowissenschaften; Philosophie des Geistes; rechtsethische und völkerrechtliche Grundfragen von Krieg und Frieden. Seit 2010 Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften „Leopoldina“, seit 2012 auf Vorschlag der Bundesregierung Mitglied im Deutschen Ethikrat.
Siehe auch:
Fotografische Interventionen für den Philosophen Georg Meggle
Zwischen Realität und Fiktion
Von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann
NRhZ 713 vom 18.07.2019
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=26079
Filmclip
Symposium für und mit Georg Meggle, Salzburg, 12. bis 14. Juli 2019
Was hat Wert? Gedanken zur Freundschaft, Kommunikation und dem Ziel der Philosophie
Von Arbeiterfotografie
NRhZ 713 vom 18.07.2019
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=26081
Online-Flyer Nr. 713 vom 17.07.2019
Druckversion
Kultur und Wissen
Laudatio für Prof. Georg Meggle zur Verleihung der Ehrenpräsidentschaft der Gesellschaft für Analytische Philosophie (gap), Salzburg, 14. Juli 2019
Konzessionsloser Mut zur freien öffentlichen Rede
Von Reinhard Merkel
 Vom 12. bis 14. Juli 2019 fand das Salzburger Symposium "Analytische Explikationen & Interventionen" mit und für Georg Meggle statt. Zwei Tage Vorträge, ein Orgelkonzert und die Verleihung der Ehrenpräsidentschaft der Gesellschaft für Analytische Philosophie (gap) an den Philosophen Georg Meggle, der in diesem Jahr 75 geworden ist, standen auf dem Programm. Reinhard Merkel spricht von Georg Meggles konzessionslosem Mut zur freien öffentlichen Rede, vom Mut als verpflichtender Maxime alles öffentlichen Räsonierens, um dann zu betonen: "Jemanden, der ihr unbeugsamer entspräche als Georg, kenne ich nicht." Und: "Georg ist nicht nur ein Theoretiker, er ist auch ein Praktiker der Kommunikation, nämlich des offenen, von keinen disziplinären Schranken bedrängten Austauschs von Argumenten", heißt es in der Laudatio, die Reinhard Merkel, Professor em. für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg, am 14. Juli 2019 in Salzburg auf Georg Meggle hielt. Die NRhZ bringt sie nachfolgend in vollem Umfang - illustriert mit Fotos der Arbeiterfotografie.
Vom 12. bis 14. Juli 2019 fand das Salzburger Symposium "Analytische Explikationen & Interventionen" mit und für Georg Meggle statt. Zwei Tage Vorträge, ein Orgelkonzert und die Verleihung der Ehrenpräsidentschaft der Gesellschaft für Analytische Philosophie (gap) an den Philosophen Georg Meggle, der in diesem Jahr 75 geworden ist, standen auf dem Programm. Reinhard Merkel spricht von Georg Meggles konzessionslosem Mut zur freien öffentlichen Rede, vom Mut als verpflichtender Maxime alles öffentlichen Räsonierens, um dann zu betonen: "Jemanden, der ihr unbeugsamer entspräche als Georg, kenne ich nicht." Und: "Georg ist nicht nur ein Theoretiker, er ist auch ein Praktiker der Kommunikation, nämlich des offenen, von keinen disziplinären Schranken bedrängten Austauschs von Argumenten", heißt es in der Laudatio, die Reinhard Merkel, Professor em. für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg, am 14. Juli 2019 in Salzburg auf Georg Meggle hielt. Die NRhZ bringt sie nachfolgend in vollem Umfang - illustriert mit Fotos der Arbeiterfotografie.
Verleihung der Ehrenpräsidentschaft der Gesellschaft für Analytische Philosophie (gap) an den Philosophen Georg Meggle (alle Fotos: arbeiterfotografie.com)
Lieber Georg, liebe Marianne, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Festversammlung!
„Unwahr wie ein Festredner“ sagt August Strindberg einmal boshaft über seinen norwegischen Schriftsteller-Kollegen Björnson - und Sie werden jetzt denken: „Was für ein ungeschickter Anfang für eine Festrede!“. Und damit haben Sie eigentlich ganz recht. Aber wo finde ich diesen Satz? Ich finde ihn in einer Festrede – nämlich der Thomas Manns zum 200. Geburtstag Goethes. Dann wird es, denkt man sich, schon eine Bewandtnis damit haben, wenn ein so bedeutender Festredner seine Laudatio auf einen noch bedeutenderen Anderen mit einem solchen Satz beginnt. Lügen die Festredner? Man versteht den Verdacht ganz gut und findet ihn auch halbwegs plausibel. Und eigene Erfahrungen in diesem Metier habe ich, offen gestanden, bislang kaum. Kurz, so genau weiß ich das nicht. Aber ich will mir Mühe geben der Maxime zu folgen, die Thomas Mann dem Strindberg-Wort über die unwahren Festreden beigibt: „Wir wollen es“, sagt er, „nicht noch einmal wahr machen, sondern selbst am [Festtag] um Wahrheit bemüht bleiben und trachten, den Gefeierten in ihrem Licht zu sehen.“
Aber wie macht man das? „Licht der Wahrheit“ ist ein großes Wort, das Thomas Mann wohl anstehen mag, wenn er über Goethe spricht, aber uns, die wir heute nicht vermessen sein wollen, vielleicht nicht. Also will ich bei dem bescheideneren Licht meiner eigenen Möglichkeiten bleiben und sehen, wohin es fällt und was an seinem Gegenstand es erhellen mag, wenn ihm keine systematische Idee die Richtung weist, sondern nichts als der unbefangene, ganz und gar persönliche, auf drei Jahrzehnte des Einander-Kennens zurückschauende und, wenn man so will, selber neugierige Blick des sich erinnernden Freundes.
*
Im Frühjahr 1989 - ich befand mich gerade in einer etwas extravaganten Schleife meiner beruflichen Biographie, nämlich im Redaktionsbau der Hamburger ZEIT - lag auf meinem Schreibtisch eine Notiz. Ein Professor Meggle aus Saarbrücken habe angerufen: ob er mit jemandem sprechen könne, der zuständig sei für Hochschulen, Wissenschaftspolitik und dergleichen; er freue sich über einen Rückruf.

Verleihung der Ehrenpräsidentschaft
Nun war mir der Name Georg Meggle bereits ein Begriff, und mehr als das: ein Name, auf den jener exklusive Schein zeitgenössischer Aufklärung fiel, den damals (jedenfalls für mich) das Haus Suhrkamp ausstrahlte und der vor allem dessen philosophische Autoren mit einer besonderen Aura umgab. Einige Bücher, die mir den Namen Georg Meggle als den eines rechtmäßigen Insassen jener lichtvollen Sphäre nahegebracht hatten, kannte ich bereits: das mit Günther Grewendorf herausgegebene zur Metaethik, die Sammlung von Aufsätzen zur Analytischen Handlungstheorie und vor allem den Diskussionsband zu Georg Henrik von Wrights „Erklären und Verstehen“ mit Georgs Beitrag zur Theorie der Handlung. Ich hatte von Wright ein paar Jahre zuvor persönlich kennengelernt, eine Begegnung, die zu den Glücksfällen meines Lebens gehört, und kannte sein Buch in Georgs und Günther Grewendorfs Übersetzung.
Auf all das dürfte die Notiz auf meinem Schreibtisch das Streiflicht einer vorüberhuschenden Erinnerung geworfen haben. Ich bin sicher, dass ich zunächst mein Herzklopfen beruhigen musste, bevor ich mich traute, den Professor aus Saarbrücken anzurufen.
Was er mir dann erzählte, gehört in die Vorgeschichte jener Begebenheiten, die als „Singer-Affäre“ unter den jüngeren kulturhistorischen Wunderlichkeiten dieses Landes einen besonderen Rang einnehmen. Im Ganzen mögen sie hier auf sich beruhen. Den meisten der Anwesenden sind sie ohnehin bekannt; denn sie gehören ihrerseits in die Vorgeschichte der Gründung der GAP. Mir freilich, dem Zeugen und Zaungast dieser Gründung, waren sie damals - neben allem, was sie noch waren - auch der szenische Hintergrund, vor dem ich zum ersten Mal eine Linie im Charakterprofil Georg Meggles wahrnahm, ohne die ich ihn mir seither nicht denken kann: die des konzessionslosen Mutes zur freien öffentlichen Rede. Mehr als 20 Jahre später hat er selbst am Ende eines Vortrags an der Deutschen Universität in Kairo über die „Zeiten des Umbruchs“ diesen Mut als verpflichtende Maxime alles öffentlichen Räsonierens markiert. Jemanden, der ihr unbeugsamer entspräche als Georg, kenne ich nicht.

Laudator Reinhard Merkel
Es war dieser Mut, womit er damals Singers Vortrag in Saarbrücken gegen militante Störer durchsetzte und den nachfolgenden, noch hässlicheren Formen journalistischer Aggression und hochschulpolitischer Nötigung standhielt. Man wird den dramatischen Tonfall solcher Wendungen für akademische Querelen vielleicht übertrieben finden, aber für diese Querelen ist er’s nicht. Ich bewahre drei Aktenordner mit Zeitungsartikeln, Briefen, Rektoratserlassen, und dienstrechtlichen Maßregelungen von ehedem auf – ein finsteres Verließ; Zeugnisse eines öffentlichen Geisteszustands, der künftigen Kulturhistorikern hinreichend Stoff zur kopfschüttelnden Befassung böte. Hier ist ein Beispiel:
„Landtag von Baden-Württemberg, 10. Wahlperiode, Drucksache 10/6122 vom 25. Oktober 1991
Antrag der Abgeordneten XY u.a. (Fraktion der SPD). […]
Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen, zu berichten,
1. ob die Beobachtung zutrifft, daß ausgehend von den USA, insbesondere von angelsächsischen Instituten wie etwa [folgen diverse Namen], allgemein aber ausgehend von Teilen der angelsächsischen Philosophie sich eine ethische Lehre verbreitet, die […] unter Namen wie „applied ethics“, „angewandte Ethik“, „Bioethik“, „Praktische Ethik“, teilweise auch als „Angelsächsische Analytische Philosophie“ zunehmend auch an deutschen Universitäten rezipiert wird;
2. ob die Landesregierung die Auffassung teilt, daß die Grundlagen dieser Lehre mit den Normen des Grundgesetzes, insbesondere mit Art. 1 GG, nicht vereinbar sind;
3. wie unbeschadet der Freiheit der Wissenschaft verhindert werden kann, daß unter dem Einfluß dieser Lehre eine verfassungswidrige Zielvorstellung zur faktischen Grundlage von Forschung und Lehre […] werden kann.“
In der Begründung heißt es dann:
„Vertreter dieser Schule sind u.a. Prof. Georg Meggle, Saarbrücken; Prof. Ernst Tugendhat, Berlin; Prof. Ursula Wolf, Berlin […].“
Für den Herbst desselben Jahres 1991 war in Kirchberg am Wechsel das 15. Internationale Wittgenstein Symposion geplant. Monate vorher forderte der Präsident der Österreichischen Wittgenstein-Gesellschaft Adolf Hübner in einem Rundschreiben das Präsidium der Gesellschaft auf, die Philosophen Singer, Hare und Meggle, die zu dem Symposion eingeladen waren, wieder auszuladen. „Die analytische Philosophie“, heißt es da, „hat Auswüchse wie Peter Singer hervorgebracht, und von diesen muss [sie] sich abgrenzen.“ […] „Mit der Aufrechterhaltung der Einladung an Herrn Singer, Herrn Hare und Herrn Meggle könnte sich die analytische Philosophie selbst einen Schlag versetzen, von dem sie sich möglicherweise jahrzehntelang nicht mehr erholen wird.“ Nun waren freilich andere österreichische Philosophen, Rudolf Haller etwa und Edgar Morscher von der hiesigen Universität, wie man heute sagt, not convinced. Sie lehnten die Ausladung der drei Häretiker ab. Das wiederum versetzte dem geplanten Wittgenstein Symposion einen Schlag, von dem es sich nicht erholte. Es wurde abgesagt.
Ein Jahr zuvor war die GAP gegründet worden. Georg hat mir damals erzählt, die Erfahrungen in der Singer-Affäre hätten zu seinen Motiven für die Gründung der Gesellschaft gehört: ein Notwehrmotiv der Vernunft. Zur konstituierenden Versammlung im Mai 1990 in Berlin hat er mich ganz unverdient eingeladen. Vieles was damals erörtert wurde, habe ich vergessen. Unverlierbar ist mir aber die Erinnerung an die Intensität des Argumentierens, Überzeugens und manchmal auch Überredens, kurz, und in Georgs eigener Formulierung, die zielstrebige Hemdsärmeligkeit, mit der er die dreitägige Sitzung geleitet und zum Erfolg geführt hat.

Verleihung der Ehrenpräsidentschaft
Hinterher habe ich ihm gesagt, er sei gewiss eines der größten politischen Talente, die mir je begegnet seien, und ich würde auf seinen Erfolg in den einschlägigen Sphären wetten, sollte ihn je der entsprechende Ehrgeiz anwandeln. Heute weiß ich, wie falsch das war. Nicht eigentlich das Attest des politischen Talents, wohl aber die hypothetische Erfolgsprognose. Der nachgerade naive Mut des freien Denkens und Sprechens, die Unfähigkeit zum taktischen Opportunismus, die kompromisslose Renitenz des Wahrheitssuchers - sie hätten Georgs Weg in der Politik kurz und aussichtslos gemacht.
*
Er ist eben, im Gegenteil, ein Philosoph. Aber was, so hat man gut Meggleanisch nun zu fragen, ist eigentlich ein Philosoph? Das gehört bekanntlich zu den eher rätselhaften Gegenständen der Philosophie selbst. Das Spektrum möglicher Formen, das sie ihren Betreibern bietet, ist staunenswert weit. Ein Philosoph, sagt André Gide einmal, ist jemand, nach dessen Antwort auf eine ihm gestellte Frage man nicht mehr versteht, was man ihn eigentlich gefragt hat. Ein solches Selbstbild würde Georg wenig gefallen. Am Anfang seiner autobiographischen Erinnerung „Die Philosophie und ich“ heißt es lakonisch: „Ich bin analytischer Philosoph – jemand dem unter vielen Dingen, die ihm beim Philosophieren wichtig sein mögen, Klarheit und Deutlichkeit am wichtigsten sind.“
Aber stimmt das? Ist das die Maßgabe für analytisches Philosophieren? Ist Wittgensteins „Tractatus“ ein klarer und deutlicher Text? Und sind es seine „Philosophischen Untersuchungen“? In einem langen Gespräch, das ich Mitte der achtziger Jahre mit Hilary Putnam geführt habe, sagte er mir: “This is perhaps one of the bestkept secrets in philosophy: philosophy doesn’t make things clear; it makes things mysterious.“

Laudator Reinhard Merkel – im Hintergrund Marianne Manda und Georg Meggle
Wer hat recht? Nun, ich denke, beide. Philosophie, so wird man mit dem berühmten Einleitungssatz Kants zur Vorrede seiner „Kritik der Reinen Vernunft“ wohl sagen dürfen, Philosophie befasst sich mit den Fragen, von denen die menschliche Vernunft belästigt wird, ohne sie abweisen, aber auch ohne sie beantworten zu können. Ihre Aufgabe ist es, diese Fragen zu entschlüsseln, ihre dunklen Hinterländer zu erhellen, sie auch dem transparent zu machen, der sie (wie André Gide) glaubt selbst nicht mehr zu verstehen, wenn der Philosoph sie ihm beantwortet hat – kurz: die Klärung solcher Fragen und ihrer Antworten bis zu jener Grenze des Sagbaren zu treiben, hinter der erneut, und nun erst wirklich beginnt, was Putnam das Mysteriöse nennt. Sich und andere dorthin zu führen, ist das Geschäft des Philosophen, und ob man es „analytisch“ nennt oder nicht verschlägt nicht viel. „Jede gute Philosophie“, hat mir Günther Patzig einmal gesagt, „ist auch analytisch“. Putnam hätte zugestimmt. Jahre nach jener Bemerkung über das Mysteriöse als Ziel des Philosophierens hat er in seiner Münchener Kant-Lecture am Beispiel Wittgensteins eine schlagende Definition dessen gegeben, was einen großen Philosophen ausmacht, nämlich diese: „Wenn ich ihn lese, werde ich klüger; und er wird es auch – und es kommt der Moment, da er anfängt, mir meine Ideen zu stehlen.“
Das ist gewiss ein hohes Lob für das besondere Erlebnis philosophischer Klärung. Georg dürfte es gefallen. Einen Dissens zwischen ihm und Hilary Putnam über Analyse, Klarheit und Mysterien des Philosophierens können wir, glaube ich, ausschließen.
*
Welche Fragen, Probleme und Rätsel der Grenze sind es aber, über die Georg in den Jahrzehnten seines Philosophierens sich und anderen Klarheit zu verschaffen unternommen hat? Sein „philosophisches Oeuvre“, schreibt Julian Nida-Rümelin in der vor zehn Jahren erschienenen Festschrift, „umfasst drei Teile: eine an Grice orientierte Konzeption der Kommunikation, Beiträge zu Themen der angewandten Ethik sowie Gründung und Aufbau der GAP“. Das ist ein wenig knapp und grob, aber nicht verkehrt; und der Titel der Festschrift „Handeln mit Bedeutung und Handeln mit Gewalt“ überschreibt die ersten beiden Themenkreise ja anschaulich. Den dritten, die Gründung der GAP, haben wir schon inspiziert und wollen es dabei belassen. Aber in Julians Liste fehlt etwas. Im strengen Sinn zum „Oeuvre“ Georgs muss man es vielleicht nicht rechnen. Doch die Beschreibung des Philosophen selbst, des Menschen hinter dem Werk, wäre unzulänglich, fehlte ihr diese Kontur. Ihren sinnbildlichen Ausdruck finde ich im zweiten jener beiden Sätze, die Georg selbst als Wegmarken seiner philosophischen Entwicklung bezeichnet. Am Ende seines Studienjahres in Oxford, nach dem Abschiedsbesuch bei seinem Supervisor Richard Hare, begleitet ihn dessen Frau zum Omnibus, und ruft ihm, als er den Bus schon bestiegen hat, durch die sich schließende Tür nach: „Give priority to life!“. Das ist ein merkwürdiger Satz. Wir wollen ihn, wenn wir Georgs philosophisches Werk nun ein wenig genauer betrachten, nicht aus den Augen verlieren und werden später auf ihn zurückkommen.
*
„Grundbegriffe der Kommunikation“ und „Handlungstheoretische Semantik“: die Titel der Dissertation von 1979 und der Habilitationsschrift von 1984 bezeichnen den Inhalt des ersten, noch immer umfangreichsten Teils des bisherigen Meggleschen Lebenswerks. Dazu haben wir in den vergangenen Tagen manches gehört, und den meisten Anwesenden hier sind zumindest die Grundzüge von Georgs intentionalistischer Bedeutungstheorie bekannt. Mir schon auch, wenn ich das so unbescheiden sagen darf, wiewohl ich das Geständnis nachschieben muss, dass ich mit meinen Versuchen, mir die genaue Ausarbeitung dieser Grundlagen zu erschließen, halbwegs gescheitert bin. Das ist nicht Georgs Darstellung anzulasten, sondern meiner Unbeholfenheit im Umgang mit jenen formalen Instrumenten der Analyse, die manche, sei es lobend oder tadelnd, für eine differentia specifica der analytischen Philosophie halten und die jedenfalls der junge Georg Meggle mit sichtlicher Lust am Spiel der Formen und Formeln zu handhaben wusste und liebte.
Den Versuch einer genaueren Rekonstruktion von Georgs Lehre will ich daher nicht riskieren. Erinnern möchte ich aber an das Urteil berufenerer Zeugen, Franz von Kutscheras etwa oder Jonathan Bennetts: Georgs Arbeiten zur Kommunikationstheorie und Semantik seien die erste vollständige Durchführung der einschlägigen Grundprogramme, die Paul Grice und David Lewis entworfen haben. Was das bedeutet, kann auch der halbwegs ermessen, der sich nicht anmaßen darf, die Richtigkeit des Urteils zu überprüfen, aber andere gute Gründe kennt, Bennett und von Kutschera in solchen Fragen zu vertrauen.
Der Intentionalismus Megglescher Provenienz begreift menschliche Kommunikation als besondere Form zielgerichteten Handelns und ihre soziale Praxis als Quelle sprachlicher Bedeutungen: eine im Wortsinne pragmatische Semantik, im Gegensatz zu ihren realistischen Antipoden, nach deren Auffassung die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke in ihrer regelhaften Verknüpfung mit außersprachlichen Gegenständen gründet. Dass die erstere den Vorzug verdient, hat übrigens vor fast 250 Jahren schon Lichtenberg gewusst. „Ist es nicht sonderbar“, schreibt er in seinem Sudelbuch G, „daß eine wörtliche Übersetzung fast immer eine schlechte ist? Und doch lässt sich alles gut übersetzen. Man sieht hieraus, wieviel es sagen will, eine Sprache ganz verstehen; es heißt, das Volk ganz kennen, das sie spricht.“ Seit dem späten Wittgenstein sind die Vorzüge pragmatischer Semantiken oft gezeigt worden - und die ihrer intentionalistischen Variante, wenn ich recht sehe, seit Georg Meggles großem Entwurf ebenfalls.
Nun behaupten Intentionalisten wie Georg freilich eine Reichweite ihrer Konzeption weit über den speziellen Handlungstypus der Kommunikation hinaus. Alles Handeln müsse und könne nur im Modus intentionalistischer Deutungen verstanden werden. Der Gegner sind kausalistische Handlungserklärungen - nach Donald Davidsons einflussreichen Wortmeldungen in den sechziger und siebziger Jahren die heute wohl vorherrschende Auffassung in der Handlungstheorie. Knapp und grob lässt sich der Streit so skizzieren:
Beide Seiten teilen eine Prämisse: „Handlung“ kann ein Verhalten nur sein, wenn es seitens des Akteurs aus einem bestimmten Grund geschieht. Der Streit beginnt bei der Frage nach der Beziehung zwischen Grund und Handlung. Kausalisten nehmen an, handlungserklärend seien Gründe nur, wenn und soweit sie für den Vollzug der Handlung ursächlich waren. Das lehnen Intentionalisten ab: Was ein Verhalten zur Handlung mache, sei allein seine Intentionalität, seine Orientierung an dem mit ihm verfolgten Ziel. Sie sei aber logischer Bestandteil des Handlungsvollzugs selbst, in ihn integriert und schon deshalb nicht als seine Ursache begreifbar. Ein physisches Geschehen als Handlung verstehen heiße, seinen Sinn für den Handelnden erfassen. Die Feststellung kausaler Abläufe sei dazu schon prinzipiell nicht geeignet.
Warum sage ich Ihnen das? Nun, aus zwei Gründen. Zum einen, weil Georg auch zu dieser Debatte Wichtiges beigetragen hat, am eindrucksvollsten in dem meisterlichen Disput mit Georg Henrik von Wright 1987 in Münster, der zunächst in der Zeitschrift „Rechtstheorie“ und dann in von Wrights Buch „Normen, Werte und Handlungen“ im Druck erschienen ist. Und zum andern deshalb, weil handlungstheoretische Grundfragen naturgemäß den Strafrechtler auf den Plan rufen, mich zum Beispiel. Zu den Grundbegriffen des Strafrechts gehört „Handlung“ ja ersichtlich in einem noch handfesteren Sinn als zu denen des Sprachphilosophen. Und genau genommen gibt es nun noch einen dritten Grund für meine etwas unbescheidene Einmischung an dieser Stelle: Georg ist nicht nur ein Theoretiker, er ist auch ein Praktiker der Kommunikation, nämlich des offenen, von keinen disziplinären Schranken bedrängten Austauschs von Argumenten. Vor allem seine Schriften zur angewandten Ethik suchen immer wieder den Blickwechsel mit Juristen – mit Völkerrechtlern etwa, wenn es um Krieg und Frieden geht, aber auch mit Strafrechtlern, wenn Begriffe wie Notwehr und Notstand ins Spiel der Argumente kommen. Dazu später noch ein Wort.

Verleihung der Ehrenpräsidentschaft
Vorweg mag er und mögen Sie mir aber eine kleine, skeptische Marginalie zur Handlungstheorie erlauben, nämlich eine aus der Sicht des Strafrechts. Dass eine Laudatio nicht der Ort für theoretische Dispute ist, versteht sich. Aber Georg ist eben auch kein gewöhnlicher Adressat einer solchen Ehrung. Und so mag er mir die kleine Anmaßung nachsehen - als Vorschlag eines Blickwechsels über die Grenzen der Disziplinen hinweg.
Bemerkenswert an dem erwähnten Münsteraner Disput war, dass sich beide Diskutanten, bei allen Differenzen im einzelnen, in ihrer Grundorientierung einig waren: der Verpflichtung auf intentionalistische Handlungskonzeptionen als die allein plausiblen. Georg war das übrigens noch entschiedener als Georg Henrik; er verteidige, sagt er, den früheren von Wright, den Intentionalisten der reinen Lehre, gegen den späteren, den beginnenden Zweifler. Georgs Grundgedanke ist einfach: „Eine (konkrete) Handlung verstehen heißt: die mit ihr verbundene Absicht kennen.“
Hier meldet sich der Strafrechtler und sagt folgendes: „Das stimmt für die meisten Handlungen, aber nicht für alle.“ Und sein rechtsphilosophischer Einflüsterer fügt hinzu: „Hier ist eine Grenze aller intentionalistischen Handlungstheorien: Sie passen erstens nicht für jedes Handeln, und sie vertragen sich zweitens mit den kausalistischen eigentlich nicht schlecht.“
Stimmt das? Nun, wir kennen viele Handlungen, die zwar in einem bestimmten Sinn intentionale sind, mit denen der Handelnde aber keinerlei Intention verbindet: keinen Zweck, kein Ziel, keine Absicht, keinen Sinn. Das gilt etwa für viele rein expressive Handlungen. Hier ein paar Beispiele: A springt vor dem Fernseher auf, als sein Fußballverein im laufenden Spiel ein Tor schießt; B tritt wütend gegen den Tisch, nachdem er seinen Steuerbescheid gelesen hat; C wirft beim Verlassen ihrer Wohnung eine Kusshand in Richtung eines Fotos ihres Freundes; D erinnert sich an eine für ihn beschämende Situation, hebt die Hände vors Gesicht und schüttelt den Kopf.
Keine dieser Handlungen verfolgt irgendeine Absicht. Handlungen sind sie gleichwohl, und, richtig verstanden, auch intentionale, in einem nun freilich etwas anderen Sinn: ihren Akteuren bewusst, von diesen willentlich ausgelöst und in ihrem Vollzug gesteuert. In von Wrights Münsteraner Worten: sie geschehen nicht unabsichtlich. Verstehbar sind sie jedoch nicht intentionalistisch, sondern allein über ihre Beweggründe: ihre auslösenden inneren Antriebe. In diesen manifestiert sich aber keinerlei Intention. Ihr Ursprung sind Emotionen - in meinen Beispielen Freude, Wut, Liebe und Scham. Deren Wirksamkeit im Handeln ist nur als kausale verstehbar.
Für manche der schwersten Verbrechen, die wir kennen, ist das von entscheidender Bedeutung. Wer intentional einen anderen Menschen tötet, ist Totschläger. Kennen wir diese Erklärung seines Handelns, so wollen wir freilich mehr wissen: Ist er sogar Mörder? Was waren seine Beweggründe? War die Handlung vielleicht nicht nur die Verwirklichung einer Tötungsintention, sondern außerdem die expressive und damit nicht-intentionale Manifestation eines Beweggrunds, den wir „niedrig“ nennen? Wer aus Rassenhass tötet, muss neben der Intention, zu töten, überhaupt keine weitere verfolgen. Und eine, die „Rassenhass“ hieße, ist schon begrifflich unmöglich. Wir verstehen eine solche Handlung aber erst dann hinreichend, wenn wir neben ihrer tödlichen Absicht auch ihren nicht-intentionalen, kausalen Beweggrund kennen: den Hass.
Der späte von Wright hat sich, wenn ich recht sehe, im Münsteraner Disput mit Georg dieser nur noch halb-intentionalistischen Auffassung angenähert. Ob Georg das auch hat, weiß ich nicht. Es könnte immerhin sein. Denn was ich weiß ist, dass er das Gegenteil eines schulphilosophischen Philisters der Unfehlbarkeit ist. Und dass auf ihn das Bild passt, das Günther Patzig in seinem Nachwort zu Carnaps „Scheinproblemen“ skizziert.
„Wenn wir im Garten einen Maulwurfshügel sehen, so dürfen wir annehmen, hier müsse ein Maulwurf gegraben haben. Unberechtigt wäre der Schluß, hier sei noch ein Maulwurf zu finden. Den Urheber des Hügels wird man unter ihm selten antreffen; er ist inzwischen anderswo tätig […]. Philosophische Schriften haben sonst nicht sehr viel mit Maulwurfshügeln gemein […], außer in diesem einen Punkt: die Werke eines Philosophen zeigen immer nur an, wo er einmal gewesen ist, was ihm einmal als wahr und wichtig erschien. Daß er auch heute noch genau dort wäre und daß sich seine Ansichten nicht geändert hätten, - diese Voraussetzung sollte man in jedem Falle erst prüfen.“
*
Damit kommen wir plausibel zu der zweiten Sphäre, in der Georg tief gegraben und markante Spuren hinterlassen hat: zur angewandten Ethik. Drei Themenkreise vor allem sind zu nennen: Krieg, Terrorismus und Genozid. Am Ende eines Vortrags vom 11. März 2003 zitiert er Thukydides und dessen „Geschichte des peloponnesischen Krieges“:
„Nach Bedarf ändern sie die Bedeutung der Wörter. Dumme Angriffslust gilt als mutige Aufopferung, vorausdenkendes Erwägen als Deckmantel der Feigheit. Wildes Draufgängertum hält man für Mannesart, wägendes Weiterberaten für schönklingenden Vorwand der Ablehnung.“

Verleihung der Ehrenpräsidentschaft
Wenige Tage nach Georgs Vortrag begann der Krieg gegen den Irak. Was er anrichtete, weiß die Welt. Auch er ging einher mit der euphemistischen Verfälschung zentraler Begriffe. Als „humanitär“, nämlich als Befreiung eines unterdrückten Volkes von seinem Tyrannen, wurde die Intervention deklariert, nachdem sich der zunächst genannte Kriegsgrund einer präventiven Selbstverteidigung gegen weapons of mass destruction als Lüge erwiesen hatte. „Ob wir wohl“, fragt Georg drei Jahre später, „aus den letzten Kriegen“ – den angeblich humanitären im Kosovo und im Irak – „[…] etwas gelernt haben?“ Und er fügt hinzu: „Wahrscheinlich so gut wie nichts.“ Der Titel des Aufsatzes, in dem er die Frage stellt, beglaubigt seine Antwort in beklemmender Aktualität: „Bomben auf den Iran?“
Die Entscheidung über die Legitimität einer militärischen Intervention, die als „humanitäre“ ausgegeben wird, will Georg, anders als die meisten Völkerrechtler, nicht allein dem Weltsicherheitsrat überantwortet wissen. Er reklamiert eine genuine Zuständigkeit des praktischen Philosophen. Und mit Recht. Dass ein Gremium aus 15 Mitgliedern, von denen fünf ein vollkommen willkürlich handhabbares Vetorecht haben, mit einer 2/3-Mehrheitsentscheidung die normative Rechtfertigung zwischenstaatlicher Gewalt sollte erzeugen können, ist schlechterdings nicht einzusehen. Daher kann es, wie Georg sagt, auch ohne Autorisierung durch den Sicherheitsrat legitime humanitäre Interventionen geben. Die militärische Verhinderung des Völkermordes in Ruanda vor 25 Jahren wäre trotz der Blockade des Sicherheitsrats durch ein angedrohtes Veto nicht nur legitim, sie wäre geboten gewesen. Und wie die Verweigerung einer Autorisierung, so kann auch deren Erteilung durch den Rat rechtlich wie ethisch falsch sein. Dann fehlt der Gewaltanwendung trotz ihrer Legalität die materielle Legitimation. So war das bei der NATO-Intervention 2011 in Libyen. Ein solches Verdikt fällt in die Zuständigkeit der Philosophie nicht weniger als in die des Völkerrechts.
Die im Wortsinne elende Verbindung zwischen humanitärer Intervention und Völkermord liegt auf der Hand. Gewiss ist der Begriff des Genozids im Völkerrecht wie in der politischen Propaganda durch seine inflationäre Ausdehnung auf Sachverhalte, für die er schlechterdings nicht passt, bis an die Grenze des Unbrauchbaren deformiert worden. Aber seine inkriminierende Wucht bezieht er für die meisten Menschen noch immer aus der Vorstellung seines massenmörderischen Urbilds. Und für manche staatlich betriebenen Vernichtungsaktionen hat das unvermindert seine Richtigkeit. Der Genozid der Türken an den Armeniern 1915 und 16 ist ein solcher Fall. Dass sich der Bundestag 2005 zur Bestätigung des historischen Befunds, wenngleich noch ohne Verwendung des Titels „Völkermord“, durchzuringen vermochte, hat Georg als Fortschritt anerkannt. Mit mindestens gleichem Recht attackiert er heute die infame Metamorphose der vom Sicherheitsrat gebilligten Blockade des Jemen zum Völkermord. Eine Neubefassung des Rats mit diesem Sachverhalt kann man ausschließen: Sie würde von einem Veto der westlichen Vormächte verhindert. Das alles ist trostlos. Was ein wenig Mut macht, zögerlich nur, aber immerhin, ist der Umstand, dass Stimmen wie die Georg Meggles dazu nicht schweigen. Von den meisten unserer Medien lässt sich das nicht behaupten.
„Terror und der Krieg gegen ihn“: damit überschreibt Georg selbst eine weitere Sphäre der Interferenz von angewandter Ethik und Völkerrecht, die ihn eingehend beschäftigt hat. Sie ist die verworrenste – psychologisch, politisch, rechtlich und philosophisch. Nur auf einen der finsteren Gänge in diesem Labyrinth, die Georg genauer erforscht hat, will ich ein flüchtiges Streiflicht werfen.
Es gibt, sagt Georg, entgegen einer geläufigen Überzeugung auch legitime Formen des Terrors. Er demonstriert das an der Unterscheidung dreier Modi terroristischen Handelns, die er „schwachen“, „starken“ und „extremen Terrorismus“ nennt. Was den schwachen Terrorismus legitimieren könne, sei der Umstand, dass sich seine Gewalthandlungen im Unterschied zu den beiden anderen Formen allein gegen legitime Ziele richteten, etwa gegen die Akteure einer despotischen Staatsmacht. Selbst das Zutodekommen Unschuldiger berühre diese Legitimität nicht notwendig – wenn nur der Täter von der tödlichen Nebenwirkung seines Tuns vorher weder etwas gewusst habe noch auch nur hätte ahnen können. Dann seien ihm solche kollateralen Opfer, wie Georg sagt, nicht im starken Sinne normativ zurechenbar.
Die Idee eines legitimen Terrors hat etwas Beklemmendes. Aber wer sie kategorisch verwirft, möge sich an Nelson Mandela erinnern, der in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Terroranschläge dieser Art gegen Institutionen des Apartheidsregimes ausgeführt hat. Tötungen unschuldiger Dritter hat er peinlich zu vermeiden gesucht. Seit Aristoteles werden solche Taten unter dem Signum kollektiver Notwehr erörtert und in Grenzen können sie gerechtfertigt sein. Mandela ist gewiss einer der plausibelsten Laureaten des Friedensnobelpreises. Auch das darf man als Beglaubigung für Georgs Argument empfinden.
Wer dagegen zur Erreichung selbst legitimer Ziele, etwa zur Beseitigung eines Despotenregimes, Terroranschläge begeht und dabei den Tod Unbeteiligter einkalkuliert, kann dafür ersichtlich kein Notwehrrecht reklamieren. Er externalisiert die Lebens- und Leidenskosten zur Behebung eines eigenen Notstands und zwingt sie Dritten auf: als quasi-solidarisches Opfer für seine Ziele. Diese mögen so legitim sein, wie man will: dafür sein Leben herzugeben kann niemand verpflichtet sein. Mit Recht verneint Georg die Rechtfertigung solcher Taten.
*
Wir sind bei unserer letzten Blickwende angelangt: der zu dem Menschen hinter dem philosophischen Werk. Erinnern wir uns: Give priority to life! - das war Catherine Hares Mahnung an den jungen Georg. Und dass er selbst diese Mahnung zur Maßgabe für sein Leben und Denken erklärt, mag uns nun zu diesem höchstpersönlichen Blick berechtigen.
Aber was bedeutet Priority to Life? Man wird bei jemandem wie Georg Leben und Denken nicht gut als unverbundenes Nebeneinander deuten können, das in eine Rangfolge zu bringen wäre. Von welchem Leben ist die Rede? Betrachten wir die Frage einmal nicht metaphysisch, sondern rein sprachlich. Catherine Hare hat nicht etwa gesagt: Give priority to living. Das wäre ein recht banaler Satz gewesen. Was lässt „life“ so gänzlich anders klingen? Wir sagen „das Kommen“ und „das Gehen“ und noch in „das Sterben“ bleibt der Infinitiv durch die Substantivierung hindurch hörbar. In „das Leben“ nicht mehr. Es ist ein Hauptwort im profundesten Sinn. Es hat den Infinitiv des Verbums, aus dem es entstanden ist, so vollständig absorbiert, dass er nicht mehr nachklingt. Das ist ein bemerkenswerter Vorgang. Und er mag als Signum des Rätselhaften genommen werden, das sich mit der Frage nach dem Leben und vor allem mit der berühmten nach dessen Sinn vor unseren Augen auftut.
Das ist nun freilich, wie man so sagt, ein weites Feld, und wir wollen es heute nicht mehr betreten. Aber das schönste Panorama davon, das ich kenne, ist der Band „Der Sinn des Lebens“, den Georg zusammen mit Ulla Wessels und Christoph Fehige vor fast 20 Jahren herausgegeben hat. Die zahlreichen Antworten, die er versammelt, scheinen mir den Sinn des Buchs in die Auskunft zu legen, dass der des Lebens ein Rätsel bleibt. „Der Mensch“, schreibt Hugo von Hofmannsthal drei Jahre vor seinem Tod, „lebt und wartet immerfort auf den Moment, der das Zweideutige und Vergängliche seines Lebens endgültig aufhebt, dann kommt der Tod.“ Vielleicht ist das so. Wir wollen es dabei belassen.
Aber vor dem Tod kommt – das Leben, und bildet den Charakter der Person, der es gehört. Und eine bestimmte Linie im Profil von Georgs Charakter nachzuzeichnen mögen Sie mir nun noch erlauben. Ich nenne sie, ein wenig riskant, die der Freundschaft. Das ist ein großes Wort und spätestens seit Platon ein großes Thema der Philosophie. Für Aristoteles ist Freundschaft bedeutsam genug, um als Komplement der Gerechtigkeit zu gelten. Kant sah in ihr „eine bloße, (aber doch praktisch-nothwendige Idee“, nach der zu streben „ehrenvolle Pflicht sei“. Und in Schopenhauers „Parerga und Paralipomena“ steht, „wahre Freundschaft“ gehöre zu den Dingen, von denen man „wie von den kolossalen Seeschlangen nicht weiß, ob sie fabelhaft sind, oder irgendwo existieren“. Lassen wir die Frage offen. Was ich aber kenne und erfahren habe, ist Georg Meggles – nun, nicht einfach Fähigkeit, sondern: genuine Disposition, lebendig-unmittelbare Neigung, ja, wenn ich recht sehe, seine charakterliche Bestimmung zur Freundschaft. Und da die allermeisten hier im Saal wissen, wovon dabei die Rede ist, bedarf es keiner weiteren Erläuterung. Sie würde zu weit führen und zu nah.
Aber auf ein Element, das zur wirklichen Freundschaft gehört, und auf seine dreifache Manifestation in Georgs Leben will ich hinweisen. Es heißt Treue. Auch das ist ein großes Wort und in seinen zahlreichen Bedeutungen seit eh und je ein veritabler Gegenstand philosophischen Räsonierens. Drei besondere Destinatäre kenne ich, denen Georg seine freundschaftliche Treue bewahrt hat und - ich habe keinen Zweifel - bewahren wird. Der erste Destinatär ist ein Plural, nämlich seine Freunde und Freundinnen wie Sie und ich. Der zweite ist nach Georgs eigenem Bekunden seine Allgäuer Heimat, und ich, dessen Heimat die oberfränkische Provinz ist, kann nur sagen, dass ich ihn hier genau verstehe. Der dritte ist seine Vision eines künftigen Eurabiens: die endliche Versöhnung der drei abrahamitischen Kulturen des Judentums, Christentums und Islams. Georg ist, Sie wissen es, auch ein großer Brückenbauer, einer zwischen Abend- und Morgenland, wenn der ehrwürdige Titel noch gestattet ist. Ich wüsste dafür kein schöneres Epitheton als die erste Strophe in Goethes Gedicht über die „Talismane“ in seinem Westöstlichen Divan, und ob man ihr und ihm einen religiösen Unterton abhören mag oder nicht, ist ganz gleichgültig:
Gottes ist der Orient! Gottes ist der Okzident! Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände.

Marianne Manda und Georg Meggle – dahinter Thomas Grundmann (gap-Präsident von 2015 bis 2018)
Lassen Sie mich schließen mit einem Sinnbild dessen, was sich hier zu Freundschaft und Treue nur andeuten, nicht wirklich sagen lässt. Es ist ein winziges Prosastück meines alten Freundes Werner Kraft, deutsch-jüdischer Dichter, Freund Walter Benjamins und Gershom Scholems, 1933 vor Hitler nach Palästina geflohen und 1991 dort, fast hundertjährig, gestorben. Es heißt „Treue“:
Ich habe vor vielen Jahren in einer Zeitung eine kleine chinesische Geschichte gelesen, deren Autor ich vergessen habe. […] Ein deutscher Kaufmann in Tsingtau mußte zu Beginn des Ersten Weltkriegs plötzlich das Land verlassen und alle seine Habe einem chinesischen Diener anvertrauen. Als er nach dem Kriege zurückkommt, sieht er am Hafen den Diener sitzen und ihn begrüßen. Er ist maßlos erstaunt und fragt ihn, was er hier tue. Der Diener sagt: „Ich warte auf dich.“ Der Herr fragt ihn, wie er denn wissen konnte, wann er komme. Der Diener sagt: „Aber du bist ja gekommen, Herr!“
Dieser Diener war in einem erhabenen Sinne treu. Er wußte nicht, was die Zeit ist, er wußte, was die Sprache ist, und diese streicht alles Unwesentliche aus. Wir könnten von ihr, wir könnten von ihm lernen, wenn wir nur wüßten, wie das anzufangen sei. Dieser Diener fing an und hörte nicht auf treu zu sein. Er stellte keine Frage. Er gab die Antwort.
Haben Sie vielen Dank!
Zu Reinhard Merkel
.jpg)
Reinhard Merkel (*1950), Professor em. für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg. Nach dem Studium Assistent am Institut für Rechtsphilosophie der Universität München, dann eineinhalb Jahre Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit (1988-1990); danach Rückkehr an die Universität. 1996 Habilitation an der Universität Frankfurt/M. Forschungsschwerpunkte: Dogmatik des Strafrechts; Rechtsphilosophische Grundlagenforschung; Recht und Ethik in der Medizin und in den Neurowissenschaften; Philosophie des Geistes; rechtsethische und völkerrechtliche Grundfragen von Krieg und Frieden. Seit 2010 Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften „Leopoldina“, seit 2012 auf Vorschlag der Bundesregierung Mitglied im Deutschen Ethikrat.
Siehe auch:
Fotografische Interventionen für den Philosophen Georg Meggle
Zwischen Realität und Fiktion
Von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann
NRhZ 713 vom 18.07.2019
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=26079
Filmclip
Symposium für und mit Georg Meggle, Salzburg, 12. bis 14. Juli 2019
Was hat Wert? Gedanken zur Freundschaft, Kommunikation und dem Ziel der Philosophie
Von Arbeiterfotografie
NRhZ 713 vom 18.07.2019
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=26081
Online-Flyer Nr. 713 vom 17.07.2019
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE