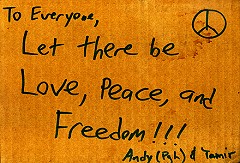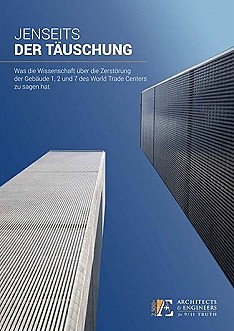SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Literatur
Historische Dokumente von 1944 und 1945
Die Hitlerjugend in Danzig (3)
Von Gerhard Jeske
 Der gebürtige Danziger, Gerhard Jeske, beschreibt in seinem Buch nicht nur seine persönlichen Erlebnisse als Jungscharführer in der Hitlerjugend. Er gibt auch Einblick in die historischen Begebenheiten der damaligen Hitlerjugend zum Ende des zweiten Weltkrieges in Danzig. Nur wenige Zeitzeugen haben es geschafft, sich objektiv mit der eigenen Vergangenheit und der damit verbundenen deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Dieses Buch ist ein einzigartiger Zeuge deutscher Geschichte, wie man sie selten in gebundener Form wiederfindet. Die NRhZ bringt - wie in den vergangenen zwei Wochen - einen Textauszug.
Der gebürtige Danziger, Gerhard Jeske, beschreibt in seinem Buch nicht nur seine persönlichen Erlebnisse als Jungscharführer in der Hitlerjugend. Er gibt auch Einblick in die historischen Begebenheiten der damaligen Hitlerjugend zum Ende des zweiten Weltkrieges in Danzig. Nur wenige Zeitzeugen haben es geschafft, sich objektiv mit der eigenen Vergangenheit und der damit verbundenen deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Dieses Buch ist ein einzigartiger Zeuge deutscher Geschichte, wie man sie selten in gebundener Form wiederfindet. Die NRhZ bringt - wie in den vergangenen zwei Wochen - einen Textauszug.
Beim Pudding-Vertreter
Der Junge blieb in der Tür stehen. Schnell musterte er das Büro. Die große Landkarte von Russland war verschwunden, an ihrer Stelle hing an der Wand eine Alpenlandschaft. 0hne Umschweife erklärte der Chef ihm, dass dieser Brief noch heute am Postschalter aufgegeben werden müsse, und dass der Brief sofort abgestempelt werde solle. Schnell verließ Gerd das Geschäft. Draußen nieselte es. Die Dunkelheit zwang ihn das Gesicht hochzuhalten, um besser sehen zu können. Kalter Regen benetzte die Haut und kühlte sie unangenehm ab. Nach zehn Minuten Fußweg trat er in die Post ein. Gelbliches mattes Licht verbreitete eine trübe Stimmung. Feuchte Wärme umhüllte ihn. Er stellte sich an. Nachdem er den Umschlag aus der Tasche genommen hatte, las er die Anschrift. Adressiert war der Brief an das Wirtschaftshauptamt in Berlin. Brennend gern hätte er gewusst, was Herr Michelsen dem Amt mitteilen wollte.
Eventuell handelte es sich um die polnischen Büromöbel und ihre Überführung an einen sicheren Ort im Reich. Oder sollte die Dienstverpflichtung der Verkäuferinnen aufgehoben werden? Überall wurden jetzt die letzten Menschenreserven ausgesiebt. Manche Betriebe konnten nur einen Notdienst aufrecht erhalten. In der Schlange kam er nur langsam voran. Es wurden täglich mehr und mehr Telegramme und Eilbriefe aufgegeben. Die Ungewissheiten, besonders nach den Bombenangriffen, ließen dieses Informationsmittel zur wichtigsten Quelle der Kontakte werden. Am Schalter blickte ihn eine völlig überarbeitete Frau an. Er kannte sie. Die Beamtin hatte vorher als Zustellerin im Außendienst gearbeitet. Seine Mutter war zu dieser Zeit auch Postbotin im Nachbarbezirk gewesen. Öfters, wenn er seiner Mutter am Sonntagvormittag beim Postaustragen geholfen hatte, trafen sich die beiden Frauen in einer Eckkneipe, wo ihnen der Wirt eine heiße Brühe spendierte. Ein mildes Lächeln erhellte ihr Gesicht als sie Gerd sah. Sie nickte ihm zu. Er wusste, dass sie sich für seine Mutter eingesetzt hatte, damit sie in den Innendienst übernommen wurde.
Er nahm den quittierten Einschreibezettel entgegen, dabei erfasste sie seine Hand und drückte sie einen Augenblick länger, als erlaubt. Langsam ging er durch die Halle zum Ausgang. Beziehungslos standen die Menschen in der Warteschlange. Stumm ertrugen sie alle ihr gemeinsames Schicksal und dazu gehörte, dass ihnen der Mund verschlossen worden war. „Schweigen ist Gold, Reden konnte das KZ oder den Tod bedeuten.“ So hatte das alte Sprichwort einen neuen und schrecklichen Sinn bekommen. Draußen war es duster und so unangenehm, dass man keinen Hund in die Gasse geschickt hätte. Er schlich am Hauptbahnhof vorbei und folgte von dort den Schienen in Richtung Hansaplatz. Gegenüber der Oberschule St. Petri bog er in die Schichau-Gasse ein. Die alte Villa stand am Ende der Gasse, in der Nähe des Werftgeländes. Früher soll sie einem Juden gehört haben. Schon vor 1939 brachte der Danziger NS-Senat durch eine schleichende Enteignung das Vermögen der jüdischen Mitbürger in den städtischen Besitz. Die auswanderungswilligen Juden mussten billigst ihre Häuser und Unternehmen verkaufen. Auch diese Villa gehörte wohl zur Konkursmasse eines jüdischen Emigranten.
Das Gespräch
Er stieg die Stufen zur Haustür hinauf, öffnete sie, betrat einen Flur und von dort steuerte er auf das Dienstzimmer zu. Ohne anzuklopfen trat er ein. Der Tür gegenüber saß hinter dem großen Schreibtisch ein Jungzugführer. „Der Dicke“, so wurde er genannt. Er litt an überhöhter Drüsenfunktion, und wog beinahe einhundertachtzig Pfund. Mit diesem Übergewicht kam er in kein Segelflugzeug hinein. Von ärztlicher Seite war ihm das Fliegen überhaupt verboten worden. Er schlug die Verwaltungslaufbahn ein. Mit seiner hellen, harten Stimme spulte er seine Antworten auf die Fragen des Jungchen ab.
Natürlich fielen wegen Mangel an Führungskräften viele Gruppenabende aus. Nur die Bastelkurse liefen weiter. Weil einige Handwerker von der Werft vom Kriegsdienst befreit waren, konnte dieser Dienst aufrechterhalten werden. Der Junge unter-brach seinen Redefluss. Er wies auf einen weißen Fleck an der Wand hin. „Ist dort das Foto heruntergefallen?“, fragte er. Früher hing an der Stelle das Bild des Fliegergenerals Udet.
„Nicht direkt“, meinte der Jungzugführer. „Aha, du spielst auf seinen Tod an. Na ja, trotz Staatsbegräbnis gibt es immer noch diese Gerüchte. Also abgeschossen ist der auf keinen Fall. Ob es ein Unfall war? Genaues weiß ich nicht .Vergessen wir es.“ Der Junge wusste es besser. Der englische Rundfunk berichtete davon. Der General Udet hatte Selbstmord begangen, weil er die Unterlegenheit der Deutschen Luftwaffe erkannt hatte. Dass die Masse der deutschen Generäle das Theater mit dem Staatsbegräbnis mitmachte, zeigte, wie ehrlos sie geworden waren. Ihre hündische Treue zu Hitler konnte er nicht verstehen. Der Lagerarbeiter im Geschäft, Ewald, brachte ihn auf die richtige Spur. „Dieser Krieg", so meinte er, „ist ein Raubzug .Wie Verbrecher in eine Villa einsteigen, so sind wir in fremde Länder eingebrochen. Die deutschen Kapitalisten reißen die fremden Industrien an sich und die Gutsbesitzer stehlen sich ihr zweites und drittes Gut zusammen. Die fremde Bevölkerung wird zu einem Teil ausgerottet und zum anderen Teil zu Arbeitssklaven verwendet. Und leider wollen die meisten Deutschen am Untergang der anderen Völker profitieren. Aber mit diesem Krieg haben sie sich ins eigene Fleisch geschnitten, der Aderlass wird immer stärker.“
„Die verbluten so langsam“, stimmte Gerd ihm zu.
„Ja, das ist richtig, wir aber mit ihnen“, meinte der Arbeiter Ewald. Gerd sah sich nun den HJ-Führer genauer an. Ein Arbeiterjunge war der bestimmt nicht. Ihm fiel auf, dass in der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei und in der Hitlerjugend fast alle Führungskräfte aus dem Bürgertum kamen. Die Arbeiter und ihre Kinder hatten zu kuschen und stramm zu stehen. Gerd bohrte weiter.
„Warst du auch zum Schippen?“, fragte er den Dicken leise. Der näselte, wie wenn er sich entschuldigen wollte.
„Hör‘ mal, der Arzt hat mir solche Arbeiten verboten. Jeder an seinen Platz.“ Er kam nicht weiter, das Jungchen fuhr ihn an. „Auf das Telefon aufpassen, wie?“
„Was soll das?“, brauste der Dicke auf. „Das mach‘ ich so nebenbei, schließlich habe ich Wichtigeres zu tun. Mein Abitur, das kannst du mir nicht abnehmen, das muss ich selber machen. Danach komme ich später auf die Verwaltungsschule. Fachleute werden immer knapper.“ Beinahe akrobatisch fand der Junge den Übergang zu seinem. Thema. „Die sind schon so knapp, dass selbst der Gauleiter den Panzergraben bauen muss. Er soll neulich hinter dem Bischofsberg mit dem Spaten in den Händen gesehen worden sein", warf er schnell ein. Der Jungzugführer zuckte zusammen, wie wenn ein Pfeil ihn getroffen hätte.
„Ich weiß schon worauf du es abgesehen hast. Da gab es während des Schippens diesen unangenehmen Zwischenfall mit dem Gauleiter. Wir sind dabei die Sache aufzuklären.“
Diese Antwort bestätigte ihm, dass da etwas im Busch war. „Die Kripo wird das schon machen“, sagte Gerd. Der Jungzugführer ordnete die Bleistifte, er legte sie ausgerichtet vor sich hin. Schließlich begann er weiter zu reden: „Die Sauerei ist, dass es sich wahrscheinlich um eine organisierte Störung handelte. Eine von diesen illegalen kommunistischen Gruppen muss das gewesen sein. Kurz vorher bedrohten sie mit ihren Spaten einen Amtsleiter.“ Der Junge merkte, wie sein Herz kräftiger zu schlagen begann. „Wieso kommunistische Gruppen, gibt es die überhaupt noch?“, fragte er gleich weiter. „Das ist es ja!“, entfuhr es dem Jungzugführer. „Jetzt kommen sie aus ihren Löchern hervor. Uns wirft man von oben vor, dass wir immer mehr die Kontrolle über die Jugend verlieren. Der Bannführer hat uns angewiesen diese Gruppen aufzuspüren und ihnen das Handwerk zu legen.“ Das hat jetzt Kreise gezogen“, dachte das Jungchen. Laut aber fragte er, was denen blüht, wenn sie geschnappt würden. „Aufhängen!“, kreischte der Jungzugführer.
Inzwischen hatte er die Karteikarte gefunden, er zog sie aus dem Kasten hervor. „Also, du bist Gerhard Jeske, Lehrling, KLV- Lager Adolfsdorf in Westpreußen. Zwei Starts mit dem Schulgleiter. Du hast Untergewicht. Siehst du, was ich zu viel an Gewicht habe, das hast du zu wenig. Wer hat dich eigentlich hierher bestellt?“, fuhr er plötzlich hoch. Sollte er antworten, dass es sein Instinkt war? „Der spinnt wohl“, dachte das Jungchen. Abwarten und den anderen kommen lassen, war seine Devise. „Oder hast du den Brief von deinem Jungscharführer erhalten?“, fragte er im Befehlston weiter. „Gefällt dir daran etwas nicht?“ Diese Neuigkeit elektrisierte Gerd. Da war also doch etwas im Gange! Da er den Brief nicht kannte, vielleicht lag der schon zu Hause auf dem Tisch, wollte er das Gespräch beenden. „Ich soll einen Brief bekommen haben? Nein davon weiß ich nichts“, erklärte er. Ich bin wegen einer anderen Sache gekommen. Ich möchte wissen, ob ich statt Pilot Funker werden kann?“ Der Dicke war baff. „Junge, warum sagst du das nicht gleich? Das ist prima! Funker werden gesucht, wie die Nadel im Heuhaufen. Das melde ich weiter, dann wirst du gleich zum Morsenüben angemeldet.“ Er machte sich eine Notiz. Die Erfolgsmeldung stimmte ihn froh. Er meinte noch, dass das Heer ihnen alle Funker abspenstig mache. Beim Heer kann man nicht aus den Wolken fallen, deshalb melden sich die Freiwilligen lieber dorthin, Der Junge hörte seine letzten Worte zwischen Tür und Angel. Mit einem zackigen „Heiiil“ verabschiedete er sich. Schnell sprang er von der Haustreppe auf die Straße. Schnuppernd prüfte er die Wetterlage. Es regnete nicht mehr. Durch treibende Wolkenfetzen blinkten Sterne. „Heute könnte der Tommy kommen, das abziehende Tief begünstigt einen Luftangriff“, stellte er fest. Über den breiten Schlüsseldamm schlug er den Weg zum Hafen ein. Er ging mitten auf der Fahrbahn. Autos fuhren kaum noch in der Stadt, aber Radfahrer und die abgedunkelte Straßenbahn musste er beachten.
Das Gespräch ging ihm nach. Eines war sicher: Die Ermittlungen zu den frechen Pimpfen, in Sachen – Gauleiter Forster - hatten bisher keinen Erfolg gehabt. Es wäre kein Kunststück heraus- zubekommen, welche Firma an dem Abschnitt des Panzergrabens gearbeitet hatte, an dem die Pimpfe den Amtsleiter und der Arbeiter den Gauleiter beleidigt hatten. Eine Anfrage von der Kripo, im Büro bei Michelsen, hätte ergeben, dass in der Firma keine fünf Jungens beschäftigt wurden. Daraus würde die Kripo schließen, dass die Jungens absichtlich zusammen mit dem alten Arbeiter an dieser Stelle postiert worden waren. Klar, der Alte und die Jungen, die passten in ihrer Theorie zusammen. Dadurch lief ihre Untersuchung in die falsche Richtung. Der Prokurist Knorr, als ehemaliger Sozialdemokrat, hielt sich zurück. „Der singt nicht“, hatte der Lagerarbeiter Ewald ihm bestätigt. Der Brief, den der Jungzugführer ins Gespräch gebracht hatte, musste eine andere Angelegenheit zum Inhalt haben, sonst wäre er nicht so ungeschoren davon gekommen. In den kleinen Gassen zwischen dem Altstätischen Graben und dem Dritten Damm verfranzte er sich, bis er zufällig er auf den Damm gelangte. Hier kannte er sich aus. An der Ecke bei Michelsen bog er in die Johannisgasse ein, spurtete bis zum Johannistor, stürzte zum Bollwerk vor und umarmte die Reling an der Mottlau. Hier am Wasser fühlte er sich freier. Langsam spazierte er auf dem Kai zum Krantor hin. Dort blieb er ein Weilchen stehen, lehnte sich über die Reling und spuckte kräftig im hohen Bogen ins Wasser. Dunkle Stille lag über der Mottlau. Kein Laut lärmte aus irgendeiner Kneipe. Langsam erstarb die Stadt. Hier, an ihrer großen Aorta, war ihr Puls kaum noch zu fühlen. Die Zeiten waren längst vorbei, als in den Kaschemmen gezecht, gesungen und geschwoft wurde. Als geborener Mottlauspucker spie er der Zeit seufzend hinterher. Er konnte nicht wissen, dass das alles endgültig der Vergangenheit angehören sollte. So schön und romantisch er den Augenblick empfand, so ängstigte ihn die tote Kulisse am Hafen. Bevor er weiterging witterte er gegen die Häuserwände. Zunehmend häuften sich die Überfälle auf Passanten in der Dunkelheit. Untergetauchte Flüchtlinge besorgten sich leider auf diese Art das, was sie notwendig zum Leben brauchten. Aus dem Stand rannte er los, auf der Grünen Brücke blieb er stehen. Er verschnaufte. Die kühle Wasserluft tat ihm wohl .Er atmete tief durch. Plötzlich stockte sein Atem. Angespannt hörte er hin. Da war dieser tödliche Ton am nächtlichen Himmel zu vernehmen. Er zweifelte nicht. Das auf und abschwellende Motorbrummen war ein englischer Bomber. Der Tommy war da! Ihre Bomber flogen immer von der See an, sie verminten die Danziger Bucht. Nacht für Nacht wurde so die Bevölkerung in die Keller getrieben. Erschöpfung machte sich bei ihnen bemerkbar. Besonders die Kinder litten unter dem unterbrochenen Schlaf. Gesundheitliche Störungen folgten diesem unnatürlichen Leben. Warum sie keinen Alarm gaben? Hofften sie, dass die Flugzeuge vorbeiflogen? Es war soweit. Die Sirenen heulten auf.
Schmerzhaft zerriss ihr schwingender Ton die Stille. Die tödliche Gefahr erweckte die Stadt zum Leben. Flak-Scheinwerfer blendeten auf. Türen klappten. Menschen hasteten zu den Bunkern. Der Junge hetzte am Ufer der Mattenbuden entlang. dann an seiner alten Schule in der Almodengasse vorbei, peeste er bis zum Thornschen Weg, rannte nach links zum Hühnerberg bis zum Stadtrand. Vor ihm lag der Festungswall an der Bastion Aussprung. Von hier konnte er über eine vierzig Meter lange Holzbrücke über den Mottlau-Umfluter auf die andere Seite nach Groß Walddorf gelangen. Der Weg dorthin wurde ihm versperrt, Luftschutzmänner hielten ihn auf, sie wiesen ihn in einen ebenerdigen Luftschutzbunker ein. Im Splittergraben, vor dem Eingang, blieb er stehen. Von dort aus konnte er das schaurige und aufregende Kriegsschauspiel über der Stadt erleben. Wie glühende runde Stäbe bewegten sich die Scheinwerfer hin und her, überkreuzten sich, beleuchteten einen Fesselballon, der gleich einem großen Insekt zwischen Himmel und Erde hing. Die schwere Flak begann ihr dröhnendes Konzert. Ihre donnernden Paukenschläge ließen das Zwerchfell vibrieren. Die Höllenmaschine war angesprungen. Vor ihrer Gewalt kuschten die Menschen ängstlich zusammen. Feuerbälle zerplatzten zwischen den Sternen. Die Druckwellen vertrieben die Wolken. „Die Sterne explodieren“, phantasierte eine Frau den grellen Blitzen nach. „Mein Gott, wieso holen sie den Tommy nicht runter!“, rief dagegen der Luftschutzwart neben ihm aus. Steil erhob sich ein sprühender, feuriger Vorhang über dem Hafen. Die kleinen Kaliber der Schiffsgeschütze schossen mit Leuchtspurmunition Sperrfeuer. „Der fliegt verdammt niedrig“, erklärte der Luftschutzwart die Lage. Um das tödliche Feuerwerk besser verfolgen zu können, schritt Gerd die Treppe hoch und blieb dort auf der ersten Stufe stehen. Ein heller Blitz zuckte über die Grabentreppe in den Bunker hinein. Eine gewaltige und dumpfe Explosion erschütterte die Stadt. Der nachfolgende Luftdruck bebte hinterher. Dachziegel klapperten auf die Straße. Erschrocken sprang ein Mann die Treppe herab. „Die Mine ist aufs Land gebummst!“, keuchte er atemlos vor sich hin. „Wenn das Ei in die Stadt gefallen ist, na dann gute Nacht Marie.“ Der Hintergrund kannte viele Stimmen und so ließ sich jemand hören, kurz und lakonisch: „Was nicht ist, kann ja noch werden!“ Schlagartig hörte das Schießen auf. Nicht die Mine war es gewesen, das Flugzeug wurde getroffen und explodierte. Einige Leute verließen schon den Bunker. Niemand hielt sie zurück. Die größte Gefahr war vorbei. „Bist du nicht vom Goldrutenweg aus Groß Walddorf?“, fragte ihn die Frau an seiner Seite. Ohne eine Antwort abzuwarten redete sie weiter, dass sie nun unbedingt nach Hause müsse, schon der Kinder wegen. „Gehst du mit?“, fragte sie fordernd. Das Jungchen merkte, dass sie Angst hatte. Er wartete nicht lange ab, kletterte die Treppe hoch und verließ den Bunker .Die Frau folgte ihm nach. Weißer Nebel waberte gegen die Stadt. Der Chemiequalm sollte sie unsichtbar machen. Auf den Festungswällen waren die Nebeltonnen aufgebaut worden. Ihren ätzenden Gestank verbreiteten sie über die Niederstadt. Bei der Brücke wurde der Nebel so dicht, dass sie sich ihre Taschentücher vor die Nase pressten. Auf der Brücke konnten sie keine zwei Meter weit sehen. Er hakte sich bei der Frau unter. Mit dem linken Arm strich er am Holzgeländer entlang, dadurch konnte er die Richtung einhalten, zügig kamen sie voran. Auf der anderen Seite des Mottlau-Umfluters lichtete sich der Tarnnebel. Der Wind trieb ihn nach Südwest. Als sie den Schilfgürtel durchquerten, wurde die Luft frisch und klar. Sie waren in der Siedlung angekommen. „Die bringen uns mit dem Giftgas um!“, röchelte die Frau. Mehrmals blieb sie stehen hustete und spuckte aus. Durch Groß Walddorf führten schmale Sandwege, flankiert von Zäunen und Hecken. Gerd begleitete die Nachbarin bis zur Gartenpforte. Sie bat ihn, einen Moment zu warten, bis sie die Tür des Hauses erreicht hatte. Er zählte bis zehn und lief dann los. Keine hundert Meter weiter erreichte er das eigene Grundstück. Der Bohlensteg polterte unter seinen Schritten. Mutter Jeske hörte ihn kommen und öffnete die Tür. Etwas besorgt fragte sie, wo er während des Alarms sich aufgehalten habe. Er berichtete von seinem Besuch in der Dienststelle.
„Hast du etwas ausgefressen?“, fragte sie misstrauisch.
„Überhaupt nicht. Ich habe mich heute als Pilot ab und als Funker angemeldet.“ Sie atmete auf.
„Das ist nicht verkehrt“, meinte sie. „Der Funker sitzt an der Quelle, er weiß zuerst Bescheid, wie der Haase läuft.“ Mutter Jeske war besonders erpicht auf Meldungen, die das Ende des Krieges andeuteten. Die seitenlangen Todeskreuze der Gefallenen in den Danziger Zeitungen signalisierten ihr, dass in zwei bis drei Jahren auch ihre Söhne unter den Todesanzeigen sein könnten. Je eher dieses Deutschland den Krieg verlor, desto mehr stiegen die Chancen zu überleben. So einfach war die Rechnung einer Mutter. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass sie nach zweiundzwanzig Uhr Radio London einschaltete. Die von der deutschen Abwehr gestörten Sendungen mussten im Ton so hochgedreht werden, dass die dumpfen Paukenschläge des drahtlosen englischen Rundfunks bis in den Garten zu hören waren. Das konnte Kopf und Kragen kosten. Neulich, als er später nach Hause kam, hörte er den Paukenschlag des Senders durch den Fensterladen. Mit der Faust klopfte er dagegen. Sofort verstummte der Peilton.
„Ich bin es!“, rief er der Mutter zu.
„Hast du mich verjagt“, fuhr sie ihn an.
„Es wäre besser, wenn einer von uns draußen Schmiere stehen würde“, schlug er vor. Vor den Nachbarn brauchten sie sich nicht zu fürchten, die meisten von ihnen waren früher Sozialdemokraten gewesen und ihr Nachbar zur Linken arbeitet in der illegalen KPD-Werftgruppe weiter. Keiner von ihnen würde den anderen verraten. Selbst die NS-Ortgruppe war fest in der Hand der alten Sozis. Aber, seitdem ausgebombte Familien aus dem Ruhrgebiet in die leer stehenden Gartenhäuser eingezogen waren, mussten sie vorsichtig sein. „Der Teufel trägt viele Masken“, orakelte der Deutschrusse Lucht ihnen zu.
So nebenbei erkundigte sich Gerd nach dem Brief.
„Der kam heute an, er liegt auf der Kommode“, antwortete seine Mutter. Sie ging in die Küche, um. das Abendessen reinzuholen. Er wog den Brief auf der Handfläche. Teufel noch mal, was hatte das zu bedeuten? Schnell machte er sich über das karge Essen her, dabei hielt er ständig den Brief im Auge. Endlich war es soweit: der Tisch wurde abgeräumt! Er öffnete den Umschlag. Noch nie hatte er so einen eindrucksvollen Brief erhalten. Oben links war der Absender aufgedruckt. Nicht der Jungscharführer hatte ihm geschrieben, sondern dessen Vater. Er las „Bevollmächtigter der Dr. Oetker Werke Danzig“ usw.
„Lieber Gerd, diesen Brief schreibe ich dir, weil mein Sohn erkrankt und deshalb verhindert ist, Ich entspreche seiner Bitte, dich morgen, gegen 17 Uhr, zu einem wichtigen Gespräch bei obiger Adresse einzuladen. Alles andere werden wir mündlich regeln.“
Ohne Gruß folgte die Unterschrift. Das war's! Die Angelegenheit blieb genauso unklar wie vorher. Der Pudding Doktor wollte ihm wohl eine unruhige Nacht bescheren.
„Halt dort den Mund!“, riet ihm die Mutter, „bei diesen Herren weiß man nie, woran man ist.“ Am nächsten Nachmittag, zur vorgesehen Zeit, konnte Gerd den Besuch nicht antreten, da war er noch im Geschäft. Er erreichte das Wohnhaus an der Ecke Thornscher Weg Ecke Steindamm, gegenüber der Mottlau, gegen 18.30 Uhr. Das hohe Etagenhaus, in dem der Pudding- General-bevollmächtigter wohnte, war ihm bekannt. Im Erdgeschoß befand sich die Knochenhauersche Apotheke. Im ersten Stockwerk lag die Praxis ihres Hausarztes. Dass in dem Haus aus der Wilhelminischen Zeit auch sein Jungscharführer wohnte, war ihm bisher entgangen. Er stieg die Treppe hoch. Auf der vierten Etage glänzte auf dem Messingschild, groß und verschnörkelt, der Name des Pudding-Vertreters. Er klingelte. Der Bevollmächtigte des Oetker-Konzerns öffnete persönlich die Tür.
Wie es sich für ein so hohes Tier gehörte, kanzelte er den Jungen gleich ab.
„Wir essen jetzt. Ich hatte dich zu 17 Uhr bestellt“, schimpfte er los.
„Ich habe erst nach 18 Uhr Feierabend“, erklärte Gerd ruhig die Verspätung. Der Herr Doktor. gab sich damit zufrieden. Er ließ ihn eintreten. Durch den Korridor führte er ihn in einen Empfangsraum. An einem runden Tisch durfte er Platz nehmen. Hinter einer halboffenen Schiebetür verschwand der Hausherr in den hinteren Teil der Wohnung.
Der Junge hatte Zeit die Zimmereinrichtung zu mustern. Gesten und das persönliche Eigentum offenbarten ihm viel vom Charakter und Geschmack der Menschen. Das Zimmer war sparsam möbliert. An der Wand stand eine hellgraues Chaiselongue, drei Stühle umstanden einen zierlichen Teetisch. Dieser Teil des Zimmers war für Damenbesuche vorgesehen. Die Herren saßen auf den braungepolsterten Stühlen am runden Tisch. Die Spielkarten neben dem großen gläsernen Aschenbecher deuteten darauf hin, dass hier Skat gedroschen wurde. Ein farbiges .Foto zeigte die Oetker-Werke in Bielefeld aus der Vogelperspektive. Bücher oder Zeitschriften konnte er nirgendwo entdecken. Die Dielen knarrten, er schloss daraus, dass der Jungscharführer erscheinen müsste. Aber er hatte sich geirrt, wieder war es sein Vater. Der setzte sich zu ihm an den Tisch. Er bewegte den Aschenbecher hin und her, dann hatte er den Faden gefunden. „Ich gratuliere dir! Du bist zum Jungscharführer ernannt worden. Freust du dich?“ Gerd war erstaunt.
„Davon weiß ich nichts, es hatte mich ja auch niemand gefragt.“ Der Doktor räusperte sich.
„Das ist mir verständlich“, fuhr er fort. „Dies sollte eine kleine Überraschung und Anerkennung für dich werden. Wegen des Abiturs, und der vielen Hausaufgaben, muss mein Sohn jetzt kürzer treten. Er hatte dich in der Banndienststelle für die Beförderung zum Jungscharführer vorgeschlagen und sie haben das sofort akzeptiert. Die schriftliche Bestätigung wird dir noch zugestellt werden. So, und hier ist die Adressenliste.“
Er legte sie vor Gerd auf die Tischplatte. Der zögerte sie an sich zunehmen.
„Der will mich über den Tisch ziehen“, dachte Gerd. Dann besann er sich, ergriff die Liste und verließ wortlos die Wohnung. Unten atmete er auf. Diese Straße war ihm bestens bekannt, Jahrelang war er über die Thornsche Brücke zur Schule gelaufen, mitunter im Hundertmetertempo, um nicht zu spät zu kommen,. Oft hatten sie den Apotheker Knochenhauer geärgert. Durch die offene Tür riefen sie ihm zu: „Bitte, einen Provisor mit Glasauge!“ Dabei wussten sie nicht mal was ein Provisor war. Der Apotheker schimpfte vor sich hin oder tat nur so, und damit war der Zweck erreicht.
„So sichern sich die Bürger ab“, fluchte er in den Abendwind hinein. „Die steigen bei den Nazis aus und ich soll die Prügel bekommen. Ganz schön hinterlistig, die können mich mal.“
Eilig ging er nach Hause.
„Was willst du nun machen?“, fragte ihn die Mutter. Mit einem Schritt stand er vor dem Kachelofen, öffnete die Feuerklappe und legte das Heft auf die Glut. Mit einer Stichflamme brannte es auf. „Die Ratten verlassen das Schiff!", antwortete er.
Vor ein paar Tagen hatten die Russen ihre Offensive gegen Ostpreußen begonnen. Wilde Gerüchte schossen wie Unkraut aus dem Boden. Panik und Nervosität überkam die Bewohner. Krampfhaft versuchten die begüterten Bürger Fahrkarten nach dem Westen zu erhalten. In dieses Geschehen passte der Ausstieg des Jungscharführers hinein.
„Bestimmt haben sie schon ihre Koffer gepackt“, setzte er hinzu. Das Ende der Hitlerjugend in Danzig Groß Walddorf.
Gerhard Jeske: Die Hitlerjugend in Danzig - Taschenkalender 1945

Edition Lumen 2018, 240 Seiten, deutsch und polnisch, ISBN 978-3-943518-38-2, 12,95 Euro
Über den Autor
Gerhard Jeske, geboren 1929 in Danzig, lebt heute in Hamburg. Theologe von der Ausbildung, Fotograf vom Beruf, Grafiker, Publizist und politischer Schriftsteller.
Die Erinnerungen seiner Jugend in Danzig sind die spezifische Krönung seiner publizistischen Tätigkeit. Sie haben einen besonderen historischen Wert und sind Form seiner literarischen Erzählungen, die das tägliche Leben in der Freien Stadt Danzig wiedergeben – vor allem der Arbeiterfamilien in der Zeit des unruhigen Friedens und des tragischen Krieges.
Als Fotograf hatte er aktiv im gesellschaftlichen Leben teilgenommen und sich auf Enthüllungen und Bekämpfung von Nazismus eingelassen. Seit den siebziger Jahren arbeitete er mit Menschen aus Danzig zusammen, die für eine deutsch-polnische Annäherung tätig waren. Als Fotograf hatte er unter anderen mit Hans Georg Siegler (1920 – 1997), Autor diverser Werke über Geschichte und Kultur von Danzig und Oliva, zusammengearbeitet. In seinen Album-Büchern „Danzig erleben. Ein Kulturhistorischer Reisebegleiter durch Danzig” (Düsseldorf 1985) und „Von Danzig aus. Reisewege in Westpreussen, Pommern und Ostpreussen heute” (Düsseldorf 1987), die ein Reisebegleiter für Danzig Umgebung und Kaschuben sind, so wie im Buch „Danzig. Chronik eines Jahrtausends” (Düsseldorf 1990), finden wir so wertvolle Texte und Bilder von Gerhard Jeske. Dem Droste Verlag hatte er Bilder auch für andere Werke geliefert.
Während seiner vielen Reisen nach Polen - nach Danzig, den Kaschuben und auf die Danziger Niederung - hatte er Architekturdenkmäler und das tägliches Leben der Einwohner dokumentiert. Er arbeitete mit der Kunstakademie in Danzig und dem Freilichtmuseum Wdzydze zusammen, wo er Ergebnisse seiner Reisen in diese Region. in Fotoausstellungen präsentiert hatte. Er machte Aufzeichnungen von Zeitzeugen wie dem “alten Danziger” Gerard Knoff oder Pelagia Zmuda-Trzebiatowska aus Czarna Dabrowa, wo während des Krieges der Pfarrer-Oberst Józef Wrycz versteckt wurde und hielt die Aussagen in Interviews fest.
Weitere Bücher des Autors
Engel mit Trompete – Danziger Moritaten bis 1945 (Biografie)
Taschenbuch, 308 Seiten, ISBN 978-3943518-01-6, 14,95 Euro
Skizzen aus dem Innenleben – Grafiken und Lyrik
Taschenbuch, 152 Seiten, ISBN 978-3943518-11-5, 16,80 Euro
Erzählungen und Kommentare – Von Danzig nach Hamburg
Taschenbuch, 236 Seiten, ISBN 978-3943518177, 13,95 Euro
Danziger Architektur – Bildband I – Was von Danzig übrig blieb
Sonderformat, 260 Seiten, ISBN 978-3943518276, 39,95 Euro
Danziger Architektur – Bildband II – Was von Danzig übrig blieb
Sonderformat, 236 Seiten, ISBN 978-3943518283, 39,95 Euro
Siehe auch:
Textauszug 1
Vorwort
Nachtrag zum Vorwort
Die Wölflinge: Vorstufe der Hitlerjugend
NRhZ 693 vom 20.02.2019
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=25663
Textauszug 2
Besuch beim polnischen Schuster
NRhZ 694 vom 27.02.2019
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=25671
Online-Flyer Nr. 695 vom 06.03.2019
Druckversion
Literatur
Historische Dokumente von 1944 und 1945
Die Hitlerjugend in Danzig (3)
Von Gerhard Jeske
 Der gebürtige Danziger, Gerhard Jeske, beschreibt in seinem Buch nicht nur seine persönlichen Erlebnisse als Jungscharführer in der Hitlerjugend. Er gibt auch Einblick in die historischen Begebenheiten der damaligen Hitlerjugend zum Ende des zweiten Weltkrieges in Danzig. Nur wenige Zeitzeugen haben es geschafft, sich objektiv mit der eigenen Vergangenheit und der damit verbundenen deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Dieses Buch ist ein einzigartiger Zeuge deutscher Geschichte, wie man sie selten in gebundener Form wiederfindet. Die NRhZ bringt - wie in den vergangenen zwei Wochen - einen Textauszug.
Der gebürtige Danziger, Gerhard Jeske, beschreibt in seinem Buch nicht nur seine persönlichen Erlebnisse als Jungscharführer in der Hitlerjugend. Er gibt auch Einblick in die historischen Begebenheiten der damaligen Hitlerjugend zum Ende des zweiten Weltkrieges in Danzig. Nur wenige Zeitzeugen haben es geschafft, sich objektiv mit der eigenen Vergangenheit und der damit verbundenen deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Dieses Buch ist ein einzigartiger Zeuge deutscher Geschichte, wie man sie selten in gebundener Form wiederfindet. Die NRhZ bringt - wie in den vergangenen zwei Wochen - einen Textauszug.Beim Pudding-Vertreter
Der Junge blieb in der Tür stehen. Schnell musterte er das Büro. Die große Landkarte von Russland war verschwunden, an ihrer Stelle hing an der Wand eine Alpenlandschaft. 0hne Umschweife erklärte der Chef ihm, dass dieser Brief noch heute am Postschalter aufgegeben werden müsse, und dass der Brief sofort abgestempelt werde solle. Schnell verließ Gerd das Geschäft. Draußen nieselte es. Die Dunkelheit zwang ihn das Gesicht hochzuhalten, um besser sehen zu können. Kalter Regen benetzte die Haut und kühlte sie unangenehm ab. Nach zehn Minuten Fußweg trat er in die Post ein. Gelbliches mattes Licht verbreitete eine trübe Stimmung. Feuchte Wärme umhüllte ihn. Er stellte sich an. Nachdem er den Umschlag aus der Tasche genommen hatte, las er die Anschrift. Adressiert war der Brief an das Wirtschaftshauptamt in Berlin. Brennend gern hätte er gewusst, was Herr Michelsen dem Amt mitteilen wollte.
Eventuell handelte es sich um die polnischen Büromöbel und ihre Überführung an einen sicheren Ort im Reich. Oder sollte die Dienstverpflichtung der Verkäuferinnen aufgehoben werden? Überall wurden jetzt die letzten Menschenreserven ausgesiebt. Manche Betriebe konnten nur einen Notdienst aufrecht erhalten. In der Schlange kam er nur langsam voran. Es wurden täglich mehr und mehr Telegramme und Eilbriefe aufgegeben. Die Ungewissheiten, besonders nach den Bombenangriffen, ließen dieses Informationsmittel zur wichtigsten Quelle der Kontakte werden. Am Schalter blickte ihn eine völlig überarbeitete Frau an. Er kannte sie. Die Beamtin hatte vorher als Zustellerin im Außendienst gearbeitet. Seine Mutter war zu dieser Zeit auch Postbotin im Nachbarbezirk gewesen. Öfters, wenn er seiner Mutter am Sonntagvormittag beim Postaustragen geholfen hatte, trafen sich die beiden Frauen in einer Eckkneipe, wo ihnen der Wirt eine heiße Brühe spendierte. Ein mildes Lächeln erhellte ihr Gesicht als sie Gerd sah. Sie nickte ihm zu. Er wusste, dass sie sich für seine Mutter eingesetzt hatte, damit sie in den Innendienst übernommen wurde.
Er nahm den quittierten Einschreibezettel entgegen, dabei erfasste sie seine Hand und drückte sie einen Augenblick länger, als erlaubt. Langsam ging er durch die Halle zum Ausgang. Beziehungslos standen die Menschen in der Warteschlange. Stumm ertrugen sie alle ihr gemeinsames Schicksal und dazu gehörte, dass ihnen der Mund verschlossen worden war. „Schweigen ist Gold, Reden konnte das KZ oder den Tod bedeuten.“ So hatte das alte Sprichwort einen neuen und schrecklichen Sinn bekommen. Draußen war es duster und so unangenehm, dass man keinen Hund in die Gasse geschickt hätte. Er schlich am Hauptbahnhof vorbei und folgte von dort den Schienen in Richtung Hansaplatz. Gegenüber der Oberschule St. Petri bog er in die Schichau-Gasse ein. Die alte Villa stand am Ende der Gasse, in der Nähe des Werftgeländes. Früher soll sie einem Juden gehört haben. Schon vor 1939 brachte der Danziger NS-Senat durch eine schleichende Enteignung das Vermögen der jüdischen Mitbürger in den städtischen Besitz. Die auswanderungswilligen Juden mussten billigst ihre Häuser und Unternehmen verkaufen. Auch diese Villa gehörte wohl zur Konkursmasse eines jüdischen Emigranten.
Das Gespräch
Er stieg die Stufen zur Haustür hinauf, öffnete sie, betrat einen Flur und von dort steuerte er auf das Dienstzimmer zu. Ohne anzuklopfen trat er ein. Der Tür gegenüber saß hinter dem großen Schreibtisch ein Jungzugführer. „Der Dicke“, so wurde er genannt. Er litt an überhöhter Drüsenfunktion, und wog beinahe einhundertachtzig Pfund. Mit diesem Übergewicht kam er in kein Segelflugzeug hinein. Von ärztlicher Seite war ihm das Fliegen überhaupt verboten worden. Er schlug die Verwaltungslaufbahn ein. Mit seiner hellen, harten Stimme spulte er seine Antworten auf die Fragen des Jungchen ab.
Natürlich fielen wegen Mangel an Führungskräften viele Gruppenabende aus. Nur die Bastelkurse liefen weiter. Weil einige Handwerker von der Werft vom Kriegsdienst befreit waren, konnte dieser Dienst aufrechterhalten werden. Der Junge unter-brach seinen Redefluss. Er wies auf einen weißen Fleck an der Wand hin. „Ist dort das Foto heruntergefallen?“, fragte er. Früher hing an der Stelle das Bild des Fliegergenerals Udet.
„Nicht direkt“, meinte der Jungzugführer. „Aha, du spielst auf seinen Tod an. Na ja, trotz Staatsbegräbnis gibt es immer noch diese Gerüchte. Also abgeschossen ist der auf keinen Fall. Ob es ein Unfall war? Genaues weiß ich nicht .Vergessen wir es.“ Der Junge wusste es besser. Der englische Rundfunk berichtete davon. Der General Udet hatte Selbstmord begangen, weil er die Unterlegenheit der Deutschen Luftwaffe erkannt hatte. Dass die Masse der deutschen Generäle das Theater mit dem Staatsbegräbnis mitmachte, zeigte, wie ehrlos sie geworden waren. Ihre hündische Treue zu Hitler konnte er nicht verstehen. Der Lagerarbeiter im Geschäft, Ewald, brachte ihn auf die richtige Spur. „Dieser Krieg", so meinte er, „ist ein Raubzug .Wie Verbrecher in eine Villa einsteigen, so sind wir in fremde Länder eingebrochen. Die deutschen Kapitalisten reißen die fremden Industrien an sich und die Gutsbesitzer stehlen sich ihr zweites und drittes Gut zusammen. Die fremde Bevölkerung wird zu einem Teil ausgerottet und zum anderen Teil zu Arbeitssklaven verwendet. Und leider wollen die meisten Deutschen am Untergang der anderen Völker profitieren. Aber mit diesem Krieg haben sie sich ins eigene Fleisch geschnitten, der Aderlass wird immer stärker.“
„Die verbluten so langsam“, stimmte Gerd ihm zu.
„Ja, das ist richtig, wir aber mit ihnen“, meinte der Arbeiter Ewald. Gerd sah sich nun den HJ-Führer genauer an. Ein Arbeiterjunge war der bestimmt nicht. Ihm fiel auf, dass in der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei und in der Hitlerjugend fast alle Führungskräfte aus dem Bürgertum kamen. Die Arbeiter und ihre Kinder hatten zu kuschen und stramm zu stehen. Gerd bohrte weiter.
„Warst du auch zum Schippen?“, fragte er den Dicken leise. Der näselte, wie wenn er sich entschuldigen wollte.
„Hör‘ mal, der Arzt hat mir solche Arbeiten verboten. Jeder an seinen Platz.“ Er kam nicht weiter, das Jungchen fuhr ihn an. „Auf das Telefon aufpassen, wie?“
„Was soll das?“, brauste der Dicke auf. „Das mach‘ ich so nebenbei, schließlich habe ich Wichtigeres zu tun. Mein Abitur, das kannst du mir nicht abnehmen, das muss ich selber machen. Danach komme ich später auf die Verwaltungsschule. Fachleute werden immer knapper.“ Beinahe akrobatisch fand der Junge den Übergang zu seinem. Thema. „Die sind schon so knapp, dass selbst der Gauleiter den Panzergraben bauen muss. Er soll neulich hinter dem Bischofsberg mit dem Spaten in den Händen gesehen worden sein", warf er schnell ein. Der Jungzugführer zuckte zusammen, wie wenn ein Pfeil ihn getroffen hätte.
„Ich weiß schon worauf du es abgesehen hast. Da gab es während des Schippens diesen unangenehmen Zwischenfall mit dem Gauleiter. Wir sind dabei die Sache aufzuklären.“
Diese Antwort bestätigte ihm, dass da etwas im Busch war. „Die Kripo wird das schon machen“, sagte Gerd. Der Jungzugführer ordnete die Bleistifte, er legte sie ausgerichtet vor sich hin. Schließlich begann er weiter zu reden: „Die Sauerei ist, dass es sich wahrscheinlich um eine organisierte Störung handelte. Eine von diesen illegalen kommunistischen Gruppen muss das gewesen sein. Kurz vorher bedrohten sie mit ihren Spaten einen Amtsleiter.“ Der Junge merkte, wie sein Herz kräftiger zu schlagen begann. „Wieso kommunistische Gruppen, gibt es die überhaupt noch?“, fragte er gleich weiter. „Das ist es ja!“, entfuhr es dem Jungzugführer. „Jetzt kommen sie aus ihren Löchern hervor. Uns wirft man von oben vor, dass wir immer mehr die Kontrolle über die Jugend verlieren. Der Bannführer hat uns angewiesen diese Gruppen aufzuspüren und ihnen das Handwerk zu legen.“ Das hat jetzt Kreise gezogen“, dachte das Jungchen. Laut aber fragte er, was denen blüht, wenn sie geschnappt würden. „Aufhängen!“, kreischte der Jungzugführer.
Inzwischen hatte er die Karteikarte gefunden, er zog sie aus dem Kasten hervor. „Also, du bist Gerhard Jeske, Lehrling, KLV- Lager Adolfsdorf in Westpreußen. Zwei Starts mit dem Schulgleiter. Du hast Untergewicht. Siehst du, was ich zu viel an Gewicht habe, das hast du zu wenig. Wer hat dich eigentlich hierher bestellt?“, fuhr er plötzlich hoch. Sollte er antworten, dass es sein Instinkt war? „Der spinnt wohl“, dachte das Jungchen. Abwarten und den anderen kommen lassen, war seine Devise. „Oder hast du den Brief von deinem Jungscharführer erhalten?“, fragte er im Befehlston weiter. „Gefällt dir daran etwas nicht?“ Diese Neuigkeit elektrisierte Gerd. Da war also doch etwas im Gange! Da er den Brief nicht kannte, vielleicht lag der schon zu Hause auf dem Tisch, wollte er das Gespräch beenden. „Ich soll einen Brief bekommen haben? Nein davon weiß ich nichts“, erklärte er. Ich bin wegen einer anderen Sache gekommen. Ich möchte wissen, ob ich statt Pilot Funker werden kann?“ Der Dicke war baff. „Junge, warum sagst du das nicht gleich? Das ist prima! Funker werden gesucht, wie die Nadel im Heuhaufen. Das melde ich weiter, dann wirst du gleich zum Morsenüben angemeldet.“ Er machte sich eine Notiz. Die Erfolgsmeldung stimmte ihn froh. Er meinte noch, dass das Heer ihnen alle Funker abspenstig mache. Beim Heer kann man nicht aus den Wolken fallen, deshalb melden sich die Freiwilligen lieber dorthin, Der Junge hörte seine letzten Worte zwischen Tür und Angel. Mit einem zackigen „Heiiil“ verabschiedete er sich. Schnell sprang er von der Haustreppe auf die Straße. Schnuppernd prüfte er die Wetterlage. Es regnete nicht mehr. Durch treibende Wolkenfetzen blinkten Sterne. „Heute könnte der Tommy kommen, das abziehende Tief begünstigt einen Luftangriff“, stellte er fest. Über den breiten Schlüsseldamm schlug er den Weg zum Hafen ein. Er ging mitten auf der Fahrbahn. Autos fuhren kaum noch in der Stadt, aber Radfahrer und die abgedunkelte Straßenbahn musste er beachten.
Das Gespräch ging ihm nach. Eines war sicher: Die Ermittlungen zu den frechen Pimpfen, in Sachen – Gauleiter Forster - hatten bisher keinen Erfolg gehabt. Es wäre kein Kunststück heraus- zubekommen, welche Firma an dem Abschnitt des Panzergrabens gearbeitet hatte, an dem die Pimpfe den Amtsleiter und der Arbeiter den Gauleiter beleidigt hatten. Eine Anfrage von der Kripo, im Büro bei Michelsen, hätte ergeben, dass in der Firma keine fünf Jungens beschäftigt wurden. Daraus würde die Kripo schließen, dass die Jungens absichtlich zusammen mit dem alten Arbeiter an dieser Stelle postiert worden waren. Klar, der Alte und die Jungen, die passten in ihrer Theorie zusammen. Dadurch lief ihre Untersuchung in die falsche Richtung. Der Prokurist Knorr, als ehemaliger Sozialdemokrat, hielt sich zurück. „Der singt nicht“, hatte der Lagerarbeiter Ewald ihm bestätigt. Der Brief, den der Jungzugführer ins Gespräch gebracht hatte, musste eine andere Angelegenheit zum Inhalt haben, sonst wäre er nicht so ungeschoren davon gekommen. In den kleinen Gassen zwischen dem Altstätischen Graben und dem Dritten Damm verfranzte er sich, bis er zufällig er auf den Damm gelangte. Hier kannte er sich aus. An der Ecke bei Michelsen bog er in die Johannisgasse ein, spurtete bis zum Johannistor, stürzte zum Bollwerk vor und umarmte die Reling an der Mottlau. Hier am Wasser fühlte er sich freier. Langsam spazierte er auf dem Kai zum Krantor hin. Dort blieb er ein Weilchen stehen, lehnte sich über die Reling und spuckte kräftig im hohen Bogen ins Wasser. Dunkle Stille lag über der Mottlau. Kein Laut lärmte aus irgendeiner Kneipe. Langsam erstarb die Stadt. Hier, an ihrer großen Aorta, war ihr Puls kaum noch zu fühlen. Die Zeiten waren längst vorbei, als in den Kaschemmen gezecht, gesungen und geschwoft wurde. Als geborener Mottlauspucker spie er der Zeit seufzend hinterher. Er konnte nicht wissen, dass das alles endgültig der Vergangenheit angehören sollte. So schön und romantisch er den Augenblick empfand, so ängstigte ihn die tote Kulisse am Hafen. Bevor er weiterging witterte er gegen die Häuserwände. Zunehmend häuften sich die Überfälle auf Passanten in der Dunkelheit. Untergetauchte Flüchtlinge besorgten sich leider auf diese Art das, was sie notwendig zum Leben brauchten. Aus dem Stand rannte er los, auf der Grünen Brücke blieb er stehen. Er verschnaufte. Die kühle Wasserluft tat ihm wohl .Er atmete tief durch. Plötzlich stockte sein Atem. Angespannt hörte er hin. Da war dieser tödliche Ton am nächtlichen Himmel zu vernehmen. Er zweifelte nicht. Das auf und abschwellende Motorbrummen war ein englischer Bomber. Der Tommy war da! Ihre Bomber flogen immer von der See an, sie verminten die Danziger Bucht. Nacht für Nacht wurde so die Bevölkerung in die Keller getrieben. Erschöpfung machte sich bei ihnen bemerkbar. Besonders die Kinder litten unter dem unterbrochenen Schlaf. Gesundheitliche Störungen folgten diesem unnatürlichen Leben. Warum sie keinen Alarm gaben? Hofften sie, dass die Flugzeuge vorbeiflogen? Es war soweit. Die Sirenen heulten auf.
Schmerzhaft zerriss ihr schwingender Ton die Stille. Die tödliche Gefahr erweckte die Stadt zum Leben. Flak-Scheinwerfer blendeten auf. Türen klappten. Menschen hasteten zu den Bunkern. Der Junge hetzte am Ufer der Mattenbuden entlang. dann an seiner alten Schule in der Almodengasse vorbei, peeste er bis zum Thornschen Weg, rannte nach links zum Hühnerberg bis zum Stadtrand. Vor ihm lag der Festungswall an der Bastion Aussprung. Von hier konnte er über eine vierzig Meter lange Holzbrücke über den Mottlau-Umfluter auf die andere Seite nach Groß Walddorf gelangen. Der Weg dorthin wurde ihm versperrt, Luftschutzmänner hielten ihn auf, sie wiesen ihn in einen ebenerdigen Luftschutzbunker ein. Im Splittergraben, vor dem Eingang, blieb er stehen. Von dort aus konnte er das schaurige und aufregende Kriegsschauspiel über der Stadt erleben. Wie glühende runde Stäbe bewegten sich die Scheinwerfer hin und her, überkreuzten sich, beleuchteten einen Fesselballon, der gleich einem großen Insekt zwischen Himmel und Erde hing. Die schwere Flak begann ihr dröhnendes Konzert. Ihre donnernden Paukenschläge ließen das Zwerchfell vibrieren. Die Höllenmaschine war angesprungen. Vor ihrer Gewalt kuschten die Menschen ängstlich zusammen. Feuerbälle zerplatzten zwischen den Sternen. Die Druckwellen vertrieben die Wolken. „Die Sterne explodieren“, phantasierte eine Frau den grellen Blitzen nach. „Mein Gott, wieso holen sie den Tommy nicht runter!“, rief dagegen der Luftschutzwart neben ihm aus. Steil erhob sich ein sprühender, feuriger Vorhang über dem Hafen. Die kleinen Kaliber der Schiffsgeschütze schossen mit Leuchtspurmunition Sperrfeuer. „Der fliegt verdammt niedrig“, erklärte der Luftschutzwart die Lage. Um das tödliche Feuerwerk besser verfolgen zu können, schritt Gerd die Treppe hoch und blieb dort auf der ersten Stufe stehen. Ein heller Blitz zuckte über die Grabentreppe in den Bunker hinein. Eine gewaltige und dumpfe Explosion erschütterte die Stadt. Der nachfolgende Luftdruck bebte hinterher. Dachziegel klapperten auf die Straße. Erschrocken sprang ein Mann die Treppe herab. „Die Mine ist aufs Land gebummst!“, keuchte er atemlos vor sich hin. „Wenn das Ei in die Stadt gefallen ist, na dann gute Nacht Marie.“ Der Hintergrund kannte viele Stimmen und so ließ sich jemand hören, kurz und lakonisch: „Was nicht ist, kann ja noch werden!“ Schlagartig hörte das Schießen auf. Nicht die Mine war es gewesen, das Flugzeug wurde getroffen und explodierte. Einige Leute verließen schon den Bunker. Niemand hielt sie zurück. Die größte Gefahr war vorbei. „Bist du nicht vom Goldrutenweg aus Groß Walddorf?“, fragte ihn die Frau an seiner Seite. Ohne eine Antwort abzuwarten redete sie weiter, dass sie nun unbedingt nach Hause müsse, schon der Kinder wegen. „Gehst du mit?“, fragte sie fordernd. Das Jungchen merkte, dass sie Angst hatte. Er wartete nicht lange ab, kletterte die Treppe hoch und verließ den Bunker .Die Frau folgte ihm nach. Weißer Nebel waberte gegen die Stadt. Der Chemiequalm sollte sie unsichtbar machen. Auf den Festungswällen waren die Nebeltonnen aufgebaut worden. Ihren ätzenden Gestank verbreiteten sie über die Niederstadt. Bei der Brücke wurde der Nebel so dicht, dass sie sich ihre Taschentücher vor die Nase pressten. Auf der Brücke konnten sie keine zwei Meter weit sehen. Er hakte sich bei der Frau unter. Mit dem linken Arm strich er am Holzgeländer entlang, dadurch konnte er die Richtung einhalten, zügig kamen sie voran. Auf der anderen Seite des Mottlau-Umfluters lichtete sich der Tarnnebel. Der Wind trieb ihn nach Südwest. Als sie den Schilfgürtel durchquerten, wurde die Luft frisch und klar. Sie waren in der Siedlung angekommen. „Die bringen uns mit dem Giftgas um!“, röchelte die Frau. Mehrmals blieb sie stehen hustete und spuckte aus. Durch Groß Walddorf führten schmale Sandwege, flankiert von Zäunen und Hecken. Gerd begleitete die Nachbarin bis zur Gartenpforte. Sie bat ihn, einen Moment zu warten, bis sie die Tür des Hauses erreicht hatte. Er zählte bis zehn und lief dann los. Keine hundert Meter weiter erreichte er das eigene Grundstück. Der Bohlensteg polterte unter seinen Schritten. Mutter Jeske hörte ihn kommen und öffnete die Tür. Etwas besorgt fragte sie, wo er während des Alarms sich aufgehalten habe. Er berichtete von seinem Besuch in der Dienststelle.
„Hast du etwas ausgefressen?“, fragte sie misstrauisch.
„Überhaupt nicht. Ich habe mich heute als Pilot ab und als Funker angemeldet.“ Sie atmete auf.
„Das ist nicht verkehrt“, meinte sie. „Der Funker sitzt an der Quelle, er weiß zuerst Bescheid, wie der Haase läuft.“ Mutter Jeske war besonders erpicht auf Meldungen, die das Ende des Krieges andeuteten. Die seitenlangen Todeskreuze der Gefallenen in den Danziger Zeitungen signalisierten ihr, dass in zwei bis drei Jahren auch ihre Söhne unter den Todesanzeigen sein könnten. Je eher dieses Deutschland den Krieg verlor, desto mehr stiegen die Chancen zu überleben. So einfach war die Rechnung einer Mutter. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass sie nach zweiundzwanzig Uhr Radio London einschaltete. Die von der deutschen Abwehr gestörten Sendungen mussten im Ton so hochgedreht werden, dass die dumpfen Paukenschläge des drahtlosen englischen Rundfunks bis in den Garten zu hören waren. Das konnte Kopf und Kragen kosten. Neulich, als er später nach Hause kam, hörte er den Paukenschlag des Senders durch den Fensterladen. Mit der Faust klopfte er dagegen. Sofort verstummte der Peilton.
„Ich bin es!“, rief er der Mutter zu.
„Hast du mich verjagt“, fuhr sie ihn an.
„Es wäre besser, wenn einer von uns draußen Schmiere stehen würde“, schlug er vor. Vor den Nachbarn brauchten sie sich nicht zu fürchten, die meisten von ihnen waren früher Sozialdemokraten gewesen und ihr Nachbar zur Linken arbeitet in der illegalen KPD-Werftgruppe weiter. Keiner von ihnen würde den anderen verraten. Selbst die NS-Ortgruppe war fest in der Hand der alten Sozis. Aber, seitdem ausgebombte Familien aus dem Ruhrgebiet in die leer stehenden Gartenhäuser eingezogen waren, mussten sie vorsichtig sein. „Der Teufel trägt viele Masken“, orakelte der Deutschrusse Lucht ihnen zu.
So nebenbei erkundigte sich Gerd nach dem Brief.
„Der kam heute an, er liegt auf der Kommode“, antwortete seine Mutter. Sie ging in die Küche, um. das Abendessen reinzuholen. Er wog den Brief auf der Handfläche. Teufel noch mal, was hatte das zu bedeuten? Schnell machte er sich über das karge Essen her, dabei hielt er ständig den Brief im Auge. Endlich war es soweit: der Tisch wurde abgeräumt! Er öffnete den Umschlag. Noch nie hatte er so einen eindrucksvollen Brief erhalten. Oben links war der Absender aufgedruckt. Nicht der Jungscharführer hatte ihm geschrieben, sondern dessen Vater. Er las „Bevollmächtigter der Dr. Oetker Werke Danzig“ usw.
„Lieber Gerd, diesen Brief schreibe ich dir, weil mein Sohn erkrankt und deshalb verhindert ist, Ich entspreche seiner Bitte, dich morgen, gegen 17 Uhr, zu einem wichtigen Gespräch bei obiger Adresse einzuladen. Alles andere werden wir mündlich regeln.“
Ohne Gruß folgte die Unterschrift. Das war's! Die Angelegenheit blieb genauso unklar wie vorher. Der Pudding Doktor wollte ihm wohl eine unruhige Nacht bescheren.
„Halt dort den Mund!“, riet ihm die Mutter, „bei diesen Herren weiß man nie, woran man ist.“ Am nächsten Nachmittag, zur vorgesehen Zeit, konnte Gerd den Besuch nicht antreten, da war er noch im Geschäft. Er erreichte das Wohnhaus an der Ecke Thornscher Weg Ecke Steindamm, gegenüber der Mottlau, gegen 18.30 Uhr. Das hohe Etagenhaus, in dem der Pudding- General-bevollmächtigter wohnte, war ihm bekannt. Im Erdgeschoß befand sich die Knochenhauersche Apotheke. Im ersten Stockwerk lag die Praxis ihres Hausarztes. Dass in dem Haus aus der Wilhelminischen Zeit auch sein Jungscharführer wohnte, war ihm bisher entgangen. Er stieg die Treppe hoch. Auf der vierten Etage glänzte auf dem Messingschild, groß und verschnörkelt, der Name des Pudding-Vertreters. Er klingelte. Der Bevollmächtigte des Oetker-Konzerns öffnete persönlich die Tür.
Wie es sich für ein so hohes Tier gehörte, kanzelte er den Jungen gleich ab.
„Wir essen jetzt. Ich hatte dich zu 17 Uhr bestellt“, schimpfte er los.
„Ich habe erst nach 18 Uhr Feierabend“, erklärte Gerd ruhig die Verspätung. Der Herr Doktor. gab sich damit zufrieden. Er ließ ihn eintreten. Durch den Korridor führte er ihn in einen Empfangsraum. An einem runden Tisch durfte er Platz nehmen. Hinter einer halboffenen Schiebetür verschwand der Hausherr in den hinteren Teil der Wohnung.
Der Junge hatte Zeit die Zimmereinrichtung zu mustern. Gesten und das persönliche Eigentum offenbarten ihm viel vom Charakter und Geschmack der Menschen. Das Zimmer war sparsam möbliert. An der Wand stand eine hellgraues Chaiselongue, drei Stühle umstanden einen zierlichen Teetisch. Dieser Teil des Zimmers war für Damenbesuche vorgesehen. Die Herren saßen auf den braungepolsterten Stühlen am runden Tisch. Die Spielkarten neben dem großen gläsernen Aschenbecher deuteten darauf hin, dass hier Skat gedroschen wurde. Ein farbiges .Foto zeigte die Oetker-Werke in Bielefeld aus der Vogelperspektive. Bücher oder Zeitschriften konnte er nirgendwo entdecken. Die Dielen knarrten, er schloss daraus, dass der Jungscharführer erscheinen müsste. Aber er hatte sich geirrt, wieder war es sein Vater. Der setzte sich zu ihm an den Tisch. Er bewegte den Aschenbecher hin und her, dann hatte er den Faden gefunden. „Ich gratuliere dir! Du bist zum Jungscharführer ernannt worden. Freust du dich?“ Gerd war erstaunt.
„Davon weiß ich nichts, es hatte mich ja auch niemand gefragt.“ Der Doktor räusperte sich.
„Das ist mir verständlich“, fuhr er fort. „Dies sollte eine kleine Überraschung und Anerkennung für dich werden. Wegen des Abiturs, und der vielen Hausaufgaben, muss mein Sohn jetzt kürzer treten. Er hatte dich in der Banndienststelle für die Beförderung zum Jungscharführer vorgeschlagen und sie haben das sofort akzeptiert. Die schriftliche Bestätigung wird dir noch zugestellt werden. So, und hier ist die Adressenliste.“
Er legte sie vor Gerd auf die Tischplatte. Der zögerte sie an sich zunehmen.
„Der will mich über den Tisch ziehen“, dachte Gerd. Dann besann er sich, ergriff die Liste und verließ wortlos die Wohnung. Unten atmete er auf. Diese Straße war ihm bestens bekannt, Jahrelang war er über die Thornsche Brücke zur Schule gelaufen, mitunter im Hundertmetertempo, um nicht zu spät zu kommen,. Oft hatten sie den Apotheker Knochenhauer geärgert. Durch die offene Tür riefen sie ihm zu: „Bitte, einen Provisor mit Glasauge!“ Dabei wussten sie nicht mal was ein Provisor war. Der Apotheker schimpfte vor sich hin oder tat nur so, und damit war der Zweck erreicht.
„So sichern sich die Bürger ab“, fluchte er in den Abendwind hinein. „Die steigen bei den Nazis aus und ich soll die Prügel bekommen. Ganz schön hinterlistig, die können mich mal.“
Eilig ging er nach Hause.
„Was willst du nun machen?“, fragte ihn die Mutter. Mit einem Schritt stand er vor dem Kachelofen, öffnete die Feuerklappe und legte das Heft auf die Glut. Mit einer Stichflamme brannte es auf. „Die Ratten verlassen das Schiff!", antwortete er.
Vor ein paar Tagen hatten die Russen ihre Offensive gegen Ostpreußen begonnen. Wilde Gerüchte schossen wie Unkraut aus dem Boden. Panik und Nervosität überkam die Bewohner. Krampfhaft versuchten die begüterten Bürger Fahrkarten nach dem Westen zu erhalten. In dieses Geschehen passte der Ausstieg des Jungscharführers hinein.
„Bestimmt haben sie schon ihre Koffer gepackt“, setzte er hinzu. Das Ende der Hitlerjugend in Danzig Groß Walddorf.
Gerhard Jeske: Die Hitlerjugend in Danzig - Taschenkalender 1945

Edition Lumen 2018, 240 Seiten, deutsch und polnisch, ISBN 978-3-943518-38-2, 12,95 Euro
Über den Autor
Gerhard Jeske, geboren 1929 in Danzig, lebt heute in Hamburg. Theologe von der Ausbildung, Fotograf vom Beruf, Grafiker, Publizist und politischer Schriftsteller.
Die Erinnerungen seiner Jugend in Danzig sind die spezifische Krönung seiner publizistischen Tätigkeit. Sie haben einen besonderen historischen Wert und sind Form seiner literarischen Erzählungen, die das tägliche Leben in der Freien Stadt Danzig wiedergeben – vor allem der Arbeiterfamilien in der Zeit des unruhigen Friedens und des tragischen Krieges.
Als Fotograf hatte er aktiv im gesellschaftlichen Leben teilgenommen und sich auf Enthüllungen und Bekämpfung von Nazismus eingelassen. Seit den siebziger Jahren arbeitete er mit Menschen aus Danzig zusammen, die für eine deutsch-polnische Annäherung tätig waren. Als Fotograf hatte er unter anderen mit Hans Georg Siegler (1920 – 1997), Autor diverser Werke über Geschichte und Kultur von Danzig und Oliva, zusammengearbeitet. In seinen Album-Büchern „Danzig erleben. Ein Kulturhistorischer Reisebegleiter durch Danzig” (Düsseldorf 1985) und „Von Danzig aus. Reisewege in Westpreussen, Pommern und Ostpreussen heute” (Düsseldorf 1987), die ein Reisebegleiter für Danzig Umgebung und Kaschuben sind, so wie im Buch „Danzig. Chronik eines Jahrtausends” (Düsseldorf 1990), finden wir so wertvolle Texte und Bilder von Gerhard Jeske. Dem Droste Verlag hatte er Bilder auch für andere Werke geliefert.
Während seiner vielen Reisen nach Polen - nach Danzig, den Kaschuben und auf die Danziger Niederung - hatte er Architekturdenkmäler und das tägliches Leben der Einwohner dokumentiert. Er arbeitete mit der Kunstakademie in Danzig und dem Freilichtmuseum Wdzydze zusammen, wo er Ergebnisse seiner Reisen in diese Region. in Fotoausstellungen präsentiert hatte. Er machte Aufzeichnungen von Zeitzeugen wie dem “alten Danziger” Gerard Knoff oder Pelagia Zmuda-Trzebiatowska aus Czarna Dabrowa, wo während des Krieges der Pfarrer-Oberst Józef Wrycz versteckt wurde und hielt die Aussagen in Interviews fest.
Weitere Bücher des Autors
Engel mit Trompete – Danziger Moritaten bis 1945 (Biografie)
Taschenbuch, 308 Seiten, ISBN 978-3943518-01-6, 14,95 Euro
Skizzen aus dem Innenleben – Grafiken und Lyrik
Taschenbuch, 152 Seiten, ISBN 978-3943518-11-5, 16,80 Euro
Erzählungen und Kommentare – Von Danzig nach Hamburg
Taschenbuch, 236 Seiten, ISBN 978-3943518177, 13,95 Euro
Danziger Architektur – Bildband I – Was von Danzig übrig blieb
Sonderformat, 260 Seiten, ISBN 978-3943518276, 39,95 Euro
Danziger Architektur – Bildband II – Was von Danzig übrig blieb
Sonderformat, 236 Seiten, ISBN 978-3943518283, 39,95 Euro
Siehe auch:
Textauszug 1
Vorwort
Nachtrag zum Vorwort
Die Wölflinge: Vorstufe der Hitlerjugend
NRhZ 693 vom 20.02.2019
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=25663
Textauszug 2
Besuch beim polnischen Schuster
NRhZ 694 vom 27.02.2019
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=25671
Online-Flyer Nr. 695 vom 06.03.2019
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE