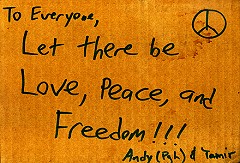SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Globales
9. Juli 1990 - Erster Weltwirtschaftsgipfel - Zeitworte Folge 4
G 7 im Siegestaumel
Von Gerhard Klas
Aber das war 1990 noch anders. Weil der gemeinsame Feind nicht mehr existierte, traten die Meinungsverschiedenheiten der G7-Staaten erstmals offen zu Tage. Vor allem die Vertreter der französischen und der deutschen Regierung wollten ihren wirtschaftspolitischen Einfluss auf die Gemeinschaft der Unabhängigen Staaten ausdehnen. 15 Milliarden US-Dollar sollten die großen Sieben insgesamt locker machen, um in der ehemaligen Sowjetunion einen Kapitalismus westlicher Prägung zu installieren. Eine kostspielige Angelegenheit.

Karikatur: Kostas Koufogiorgos
www.koufogiorgos.de
Der alte George Bush, Vater des heutigen Präsidenten, konnte sich dafür nicht erwärmen. Es gebe "wichtigere Probleme", bügelte schnoddrig George Bush senior das Begehr der Europäer ab. Wichtiger war ihm zum Beispiel eine gesamtamerikanische Freihandelszone von Feuerland bis Alaska, die er in Houston erstmals öffentlich anpries. Gleichzeitig attackierte er die Agrarsubventionen der Europäischen Gemeinschaft. Seine Handelsbeauftragte behauptete immer wieder, dass es ihr nur um das Wohl der Bauern in der Dritten Welt gehe. Die Landwirtschaft dort leide unter den großzügigen finanziellen Zuwendungen an die Bauern in der EU. Denn die überschwemmten mit ihren subventionierten Produkten die Weltmärkte und zerstörten so die heimischen Märkte in der Dritten Welt. Über die Steuerpolitik der USA, mit denen sie ihre eigenen Landwirte auf dem Weltmarkt unterstützen, verloren wohlweislich weder Bush noch seine Handelsbeauftragte ein Wort.
Wirklich geändert hat sich seit Houston nichts. Mit hohen Subventionszahlungen sichern beide Supermächte bis heute ihre privilegierte Stellung auf dem Weltmarkt. Zwar verkündeten damals in Texas die Regierungschefs vollmundig: "Wir lehnen den Protektionismus in all seinen Formen ab". Aber wer die Außenwirtschaftspolitik der G7 und ihre Propaganda des Freihandels kennt, weiß, dass sie damit vor allem die Schutzzölle der anderen Staaten meinen. Das zeichnete sich besonders deutlich ab, als sie in Houston über das Internationale Handels- und Zollabkommen verhandelten, den Vorläufer der heutigen Welthandelsorganisation WTO. Das Abkommen sollte für die Banken und Konzerne der Industrieländer alle Handelsbarrieren in der Dritten Welt niederreißen. Die fatalen Auswirkungen dieser feindlichen Übernahmen waren den Regierungschefs in Houston keine zwei Sätze wert.
Kritik an dieser Ausbeutung wurde hingegen auf einer Gegenveranstaltung formuliert: Auf dem Alternativen Wirtschaftsgipfel, einer seit 1984 ständigen, aber bis dahin kaum wahrgenommenen Begleitveranstaltung des offiziellen G7-Treffens. Hier diskutierten die von dem Gipfel der G7 Ausgeschlossenen: Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und politische Parteien, vor allem aus der Dritten Welt. Bisher hatte sich das internationale Handelsabkommen auf Güter beschränkt. Nun sollte es auf Investitionen, Dienstleistungen und geistiges Eigentum erweitert werden. Der Alternative Weltwirtschaftsgipfel kritisierte diese Zwangsöffnung für ausländisches Kapital heftig. Denn die Länder der Dritten Welt, so Martin Khor, ein Kritiker aus Malaysia, würden dadurch "immer tiefer und tiefer in den Whirlpool der Weltwirtschaft hineingezogen".
Er sollte Recht behalten. Sieben Jahre später geriet mit der Asienkrise auch Malaysia in den Sog des Strudels. Zuvor war es zu Kursschwankungen an den Finanzmärkten Ostasiens gekommen. Internationale Geldanleger zogen daraufhin innerhalb kürzester Zeit 110 Milliarden US Dollar aus der Region ab. In Ostasien gingen tausende von einheimischen Firmen Pleite, und eine rapide anwachsende Zahl von Menschen sah sich mit Erwerbslosigkeit, Armut und Hunger konfrontiert. Selbst der finanzstarke Internationale Währungsfonds konnte nur mit den höchsten Kreditzahlungen in seiner Geschichte die Wirtschaftslage der Region auf niedrigem Niveau stabilisieren. Mit den Stützungskrediten an die Regierungen in den ostasiatischen Ländern konnte der IWF eben noch verhindern, das die Asienkrise und ihre galoppierende Inflation nicht mit ebensolcher Wucht auf die Staaten der G7 übergriff.
Doch 1990 in Houston wähnten sich die Regierungschefs noch im Siegestaumel. "Politische Freiheit und die Freiheit der Wirtschaft bedingen sich gegenseitig - wir feiern heute den historischen Sieg der Demokratie", tönte der damalige US-amerikanische Außenminister James Baker. Acht Jahre später, mitten in der Asienkrise, sah der stellvertretende Finanzminister Japans die globale Krise des Kapitalismus heraufziehen.
Gerhard Klas arbeitet im Rheinischen JournalistInnenbüro Köln rjb-koeln@t-online.de
Sein Beitrag wurde in der Redaktion Zeitwort im SWR, Redaktion Marie-Elisabeth Müller, gesendet.
Online-Flyer Nr. 52 vom 12.07.2006
Druckversion
Globales
9. Juli 1990 - Erster Weltwirtschaftsgipfel - Zeitworte Folge 4
G 7 im Siegestaumel
Von Gerhard Klas
Aber das war 1990 noch anders. Weil der gemeinsame Feind nicht mehr existierte, traten die Meinungsverschiedenheiten der G7-Staaten erstmals offen zu Tage. Vor allem die Vertreter der französischen und der deutschen Regierung wollten ihren wirtschaftspolitischen Einfluss auf die Gemeinschaft der Unabhängigen Staaten ausdehnen. 15 Milliarden US-Dollar sollten die großen Sieben insgesamt locker machen, um in der ehemaligen Sowjetunion einen Kapitalismus westlicher Prägung zu installieren. Eine kostspielige Angelegenheit.

Karikatur: Kostas Koufogiorgos
www.koufogiorgos.de
Der alte George Bush, Vater des heutigen Präsidenten, konnte sich dafür nicht erwärmen. Es gebe "wichtigere Probleme", bügelte schnoddrig George Bush senior das Begehr der Europäer ab. Wichtiger war ihm zum Beispiel eine gesamtamerikanische Freihandelszone von Feuerland bis Alaska, die er in Houston erstmals öffentlich anpries. Gleichzeitig attackierte er die Agrarsubventionen der Europäischen Gemeinschaft. Seine Handelsbeauftragte behauptete immer wieder, dass es ihr nur um das Wohl der Bauern in der Dritten Welt gehe. Die Landwirtschaft dort leide unter den großzügigen finanziellen Zuwendungen an die Bauern in der EU. Denn die überschwemmten mit ihren subventionierten Produkten die Weltmärkte und zerstörten so die heimischen Märkte in der Dritten Welt. Über die Steuerpolitik der USA, mit denen sie ihre eigenen Landwirte auf dem Weltmarkt unterstützen, verloren wohlweislich weder Bush noch seine Handelsbeauftragte ein Wort.
Wirklich geändert hat sich seit Houston nichts. Mit hohen Subventionszahlungen sichern beide Supermächte bis heute ihre privilegierte Stellung auf dem Weltmarkt. Zwar verkündeten damals in Texas die Regierungschefs vollmundig: "Wir lehnen den Protektionismus in all seinen Formen ab". Aber wer die Außenwirtschaftspolitik der G7 und ihre Propaganda des Freihandels kennt, weiß, dass sie damit vor allem die Schutzzölle der anderen Staaten meinen. Das zeichnete sich besonders deutlich ab, als sie in Houston über das Internationale Handels- und Zollabkommen verhandelten, den Vorläufer der heutigen Welthandelsorganisation WTO. Das Abkommen sollte für die Banken und Konzerne der Industrieländer alle Handelsbarrieren in der Dritten Welt niederreißen. Die fatalen Auswirkungen dieser feindlichen Übernahmen waren den Regierungschefs in Houston keine zwei Sätze wert.
Kritik an dieser Ausbeutung wurde hingegen auf einer Gegenveranstaltung formuliert: Auf dem Alternativen Wirtschaftsgipfel, einer seit 1984 ständigen, aber bis dahin kaum wahrgenommenen Begleitveranstaltung des offiziellen G7-Treffens. Hier diskutierten die von dem Gipfel der G7 Ausgeschlossenen: Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und politische Parteien, vor allem aus der Dritten Welt. Bisher hatte sich das internationale Handelsabkommen auf Güter beschränkt. Nun sollte es auf Investitionen, Dienstleistungen und geistiges Eigentum erweitert werden. Der Alternative Weltwirtschaftsgipfel kritisierte diese Zwangsöffnung für ausländisches Kapital heftig. Denn die Länder der Dritten Welt, so Martin Khor, ein Kritiker aus Malaysia, würden dadurch "immer tiefer und tiefer in den Whirlpool der Weltwirtschaft hineingezogen".
Er sollte Recht behalten. Sieben Jahre später geriet mit der Asienkrise auch Malaysia in den Sog des Strudels. Zuvor war es zu Kursschwankungen an den Finanzmärkten Ostasiens gekommen. Internationale Geldanleger zogen daraufhin innerhalb kürzester Zeit 110 Milliarden US Dollar aus der Region ab. In Ostasien gingen tausende von einheimischen Firmen Pleite, und eine rapide anwachsende Zahl von Menschen sah sich mit Erwerbslosigkeit, Armut und Hunger konfrontiert. Selbst der finanzstarke Internationale Währungsfonds konnte nur mit den höchsten Kreditzahlungen in seiner Geschichte die Wirtschaftslage der Region auf niedrigem Niveau stabilisieren. Mit den Stützungskrediten an die Regierungen in den ostasiatischen Ländern konnte der IWF eben noch verhindern, das die Asienkrise und ihre galoppierende Inflation nicht mit ebensolcher Wucht auf die Staaten der G7 übergriff.
Doch 1990 in Houston wähnten sich die Regierungschefs noch im Siegestaumel. "Politische Freiheit und die Freiheit der Wirtschaft bedingen sich gegenseitig - wir feiern heute den historischen Sieg der Demokratie", tönte der damalige US-amerikanische Außenminister James Baker. Acht Jahre später, mitten in der Asienkrise, sah der stellvertretende Finanzminister Japans die globale Krise des Kapitalismus heraufziehen.
Gerhard Klas arbeitet im Rheinischen JournalistInnenbüro Köln rjb-koeln@t-online.de
Sein Beitrag wurde in der Redaktion Zeitwort im SWR, Redaktion Marie-Elisabeth Müller, gesendet.
Online-Flyer Nr. 52 vom 12.07.2006
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE