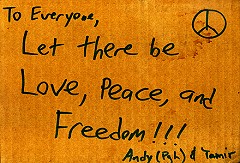SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Literatur
Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 4
"Niemandsland"
von Wolfgang Bittner
IV
Als der Krieg zu Ende war
Gestern habe ich die Schreibtische gewechselt, die Korrespondenz, Fachbücher, Examensarbeiten, Prüfungsprotokolle und Notizzettel auf den linken Tisch geräumt, den rechten freigemacht. Er ist leer, bis auf die Kladde. Schreibe ich hinein, überkommt mich eine große Gelassenheit. Die Verwirrung läßt nach; auch das tiefe Entsetzen, das ich erst jetzt, im Rückblick, zu orten vermag. Ich lese, was ich bis in die Nacht hinein notiert habe, und der helle Tag vermittelt mir ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit.
Mein Vater war sehr streng. Mit vollem Munde spricht man nicht, und wer nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen. Bei Tisch hatte man aufrecht zu sitzen, die linke Hand leicht aufgestützt, und den Löffel oder die Gabel geradeaus zum Mund zu führen. Er war Hauptfeldwebel bei der Luftwaffe gewesen, in der Fallschirmjägertruppe. Den Krieg hatte er von Anfang bis Ende mitgemacht: in Rußland, auf Kreta, in Italien, Frankreich, Belgien und Holland. In der Gegend von Kleve hatte ihm Anfang 1945 ein kanadischer Spähtrupp eine Handgranate vor die Füße geworfen, als er mit seiner Kompanie einen Straßenabschnitt verteidigte. Das Glück, das ihn den Krieg bis dahin hatte heil überstehen lassen, ließ ihn auch dabei nicht im Stich; ein Bein hing nur noch an den Muskeln, aber es brauchte nicht amputiert zu werden.
Die erste Zeit nach dem Krieg ging er an Krücken, während die Knochen langsam wieder zusammenheilten. Rente bekam er nicht, weil der Vertrauensarzt des Versorgungsamtes, ein ehemaliger Oberstabsarzt, die Verwundungen als zu leicht einstufte. Lange Zeit eiterten Metallsplitter heraus. Mein Vater freute sich, daß ihm das Bein nicht abgenommen wurde.
Mehrere Jahre war er arbeitslos und kümmerte sich ehrenamtlich um den Aufbau eines Kreisverbandes der Gewerkschaft Bau?Steine?Erden, bis ein hauptamtlicher Sekretär eingestellt wurde. Ich glaube, er war damals todunglücklich. Einmal wehrte ich mich gegen seine Schläge mit einer Gabel, die ich zum Essen in der Hand hielt, und er verletzte sich am Handgelenk. Ich schlag´ dich tot, du Hund!« schrie er, hieb mir seinen Stuhl über den Rücken und stieß meine Mutter beiseite, die dazwischensprang. Ich flüchtete in die Weißdornbüsche hinter der Baracke und wagte mich erst abends wieder hinein.
Hinterher bastelte er mir einen Bauernhof aus Sperrholz. Die Tiere sägte er mit der Laubsäge aus, malte sie an und befestigte sie mit stehengelassenen Fußzapfen auf der Holzunterlage. Er spielte gut Mundharmonika, aber Lieder sangen wir selten. Im Winter saßen wir oft um den Ofen herum und hörten stundenlang Radio. Mehrmals in der Woche gab es Hörspiele, schon am frühen Nachmittag Schulfunk. Wenn die Eltern fortgingen, hatte ich auf meine kleine Schwester aufzupassen. Wir spielten mit meinem Bauernhof und ihrer Puppe, die meine Mutter aus einem alten Strumpf genäht hatte. lm Sommer gingen wir an den Feuerlöschteich, aus dem man Weißfische und sogar Hechte und Aale angeln konnte. Zweimal am Tag fuhr jenseits der Landstraße die Kleinbahn vorbei, die später, als der Autoverkehr zunahm, stillgelegt wurde.
Wir sammelten Brennesseln und Löwenzahnblätter zum Essen und Holzabfälle zum Feuern. Die Arbeitslosenunterstützung betrug für vier Personen 24,40 Mark in der Woche; die Miete kostete monatlich zwanzig Mark, ein Brot achtundneunzig Pfennige. Eines Abends klopfte es an die Tür, und als ich öffnete, stand ein fremder Mann mit zwei großen Koffern draußen. Es war mein Onkel, der jüngere Bruder meines Vaters, der unsere Adresse vom Suchdienst erfahren hatte. In den Koffern befanden sich Kleidung, Konservendosen, Hartwurst, sogar Zigaretten und ein halbes Pfund Tee. Der Onkel erzählte, daß er gleich nach Kriegsende vorübergehend Arbeit bei der kanadischen Besatzungsarmee in Osnabrück gefunden hatte. Bevor die Kanadier ihr Militärlager den Engländern übergaben, die sehr hochnäsig auftraten, hatten sie säckeweise schwarzen Tee verbrannt, um ihn nicht den ihnen unsympathischen Verbündeten zu überlassen. Da wußte mein Onkel noch nicht, daß man für Tee, ein Nationalgetränk in unseren Breiten, eintauschen konnte, was man wollte. Unser Pech; denn für ein, zwei Säcke Tee hätte man damals ein ganzes Haus bekommen können, und mein Onkel stand auf gutem Fuß mit dem kanadischen Kommandeur.
Nebenan wohnte Walter Kosinski, ein Junge in meinem Alter. Sein Vater war Trinker und saß an heißen Sommerabenden auf einem Stuhl vor der Baracke, eine Flasche Fusel in der Hand. Am Oberkörper war er nackt, und die Hosenträger hingen seitwärts herunter, oder er trug ein schmuddeliges Unterhemd. Durch die offenen Fenster war die kreischende Stimme der Frau zu hören, die sechs Kinder zu versorgen hatte und mit dem siebten schwanger ging. Ab und zu steckte sie den Kopf heraus und schrie mit schriller Stimme die Namen der Älteren, die noch draußen waren und ins Bett sollten. Darauf knurrte ihr Mann: »Hoffentlich ist da bald Ruhe!« und nahm einen Schluck aus seiner Flasche.
Meistens rief Frau Kosinski vergeblich. Ihre Kinder kamen aber von allein, sobald es dunkel wurde. Manchmal kam die Polizei und nahm Kosinski mit; dann dauerte es einige Zeit, bis er wieder auftauchte.
Wir hielten uns abends hinter den Baracken auf und fingen in einem Abzugsgraben Frösche, mit denen wir Wetthüpfen veranstalteten. Um unseren Frosch zu Höchstleistungen anzuspornen, kitzelten wir ihn mit einem Halm, der zugleich dazu diente, die Richtung zum Ziel anzugeben. So vertrieben wir uns die Zeit. »Wenn man einen Strohhalm nimmt, kann man sie aufblasen bis zum Platzen«, sagte Walter und schnappte sich seinen Frosch. Mir war das eklig. »Wenn du es tust, haue ich dir eine runter«, warnte ich ihn. »Ist doch nur zum Spaß«, erwiderte er grinsend und begann zu blasen. Ich sprang auf ihn zu, und er warf mir den Frosch ins Gesicht. Im Nu hatte ich ihn im Schwitzkasten, aber er zog mir die Beine weg und wir purzelten die Böschung hinunter in den Graben. Meine Hand blutete aus einer Schürfwunde. »Zeig mal her«, sagte Walter versöhnlich, nahm meine Hand und spuckte kräftig auf die Verletzung. Ich riß die Hand fort und stieß ihn in den Magen, daß ihm die Luft wegblieb. »Du Schwein!« schrie ich grimmig, »ich schlag´ dich zu Brei!« Walter hielt sich den Magen. »Warum denn?« fragte er keuchend und mit schmerzverzerrtem Gesicht, »mein Vater macht das auch immer.« Er begann mir zu erklären, daß Spucke eine heilkräftige Wirkung habe.
Wir schlugen uns und vertrugen uns, wie es gerade so paßte. Nasenbluten, blaue Augen oder ausgerissene Haare waren keine Seltenheit. In erster Linie zählte körperliche Gewalt, deren Wirksamkeit sich durch Wendigkeit und heimtückisches Verhalten noch steigern ließ. Ich lernte mit der Zeit die Finte nach oben und den Boxhieb in die Magengrube, auch »finnischen Kopfstoß« oder Rückenwurf. Bei manchen ging es einige Jahre später in den Gaststätten und Tanzdielen weiter. Gewöhnlich siegte aber über jede Art der Feindschaft untereinander die Langeweile.
»Guck mal, die Holschen vom Gerd«, sagte Walter und zeigte auf die Holzpantinen eines anderen Jungen, der im Graben herumwatete und Stichlinge fing. »Was ist damit?« Er nahm die Frösche aus unserer Blechdose, steckte sie in die Pantinen und stopfte die Socken davor. Kurz darauf ging Gerd Oremek mit nassen Füßen nach Hause, sein Einweckglas mit den Stichlingen in der einen Hand, die Pantinen in der anderen. Wir schlichen hinterher und warteten, bis wir die spitzen Schreie von Frau Oremek hörten, die in der Küche die Pantinen ausgeschüttelt hatte. Danach setzten wir uns in der Dämmerung hinter den Wall und ahmten das klagende Miauen der Katze von Frau Guse nach, die sich bald zum Fenster herausbeugte und ihren Liebling rief, der irgendwo in der Feldmark herumstromerte und Vogelnester ausraubte.
Am liebsten neckten wir den alten Zielinski, der von der Fürsorge lebte, wie die meisten im Lager, und regelmäßig am späten Nachmittag mit schlurfenden Schritten zu einer freistehenden Toilettenbude ging, eine alte Zeitung in der Hand. Uns fielen immer neue Streiche ein, die wir ihm spielen konnten. Ließ er sein Fahrrad draußen stehen, stand der Sattel bald verkehrt herum. Oder wir befestigten eine Schnur am hinteren Schutzblech, so daß er beim Wegfahren plötzlich ruckartig und mit einem Krach stehenblieb. Mehrfach bauten wir auf dem Weg zu seinem Abtritt kunstvolle Fallgruben, die wir mit Wasser füllten und mit Ästen und Sand überdeckten. Einmal nagelten wir sogar die Tür zu seinem Bedürfnishäuschen zu und amüsierten uns köstlich, wie er an der Klinke riß und laut nach der Polizei schrie. Er hängte sich später im Baum hinter dem Transformatorenhaus auf, weil durch einen ortsansässigen Seemann herausgekommen war, daß seine Tochter als Prostituierte auf Sankt Pauli arbeitete.
Peter Koralla und Hans Weiß tauchten auf. Plötzlich waren sie da und wohnten bei ihrer Tante. Sie berichteten abends am Wall von ihren Erlebnissen im besetzten Breslau, und ich erfuhr, daß fette Ratten einen durchaus schmackhaften Braten abgeben können. Auch ein Dietrich, aus einem dicken Stück Draht gebogen, war neu für mich. Man konnte damit bei Dunkelheit Albert Hoffmanns Hühnerstall aufschließen, einige Eier verschwinden lassen und wieder zuschließen. Peter war außerdem ein Meister im Schlingenlegen. In den Dornenhecken und Gebüschen der näheren Umgebung fing er mit viel Geschick Kaninchen, Rebhühner und Amseln, die bei seiner Tante in den Kochtopf wanderten.
Hans, der Größere, hinkte und zeigte gern eine vernarbte Schußwunde am rechten Oberschenkel, die er bei der Besetzung Schlesiens davongetragen hatte. »Aus einer MPi«, erklärte er mit unterschwelligem Stolz. »Glaubt bloß nicht, daß der Kerl, der auf mich geschossen hat, noch lebt.« Er hatte, wie er berichtete, zusammen mit Peter in den letzten Kriegstagen noch im Volkssturm gekämpft und, wenn man seinen Worten glauben durfte, einen russischen Tank mit der Panzerfaust abgeschossen. »Ein Deutscher reicht für fünf Amis«, erklärte er, »und für zehn Ruskis.« Hinterher waren alle aus der Familie tot und die beiden in den Großstadttrümmern untergekrochen, bis sich eine Gelegenheit ergab, in den Westen zu gelangen.
Sie kannten eine Unmenge von Kniffen und Schlichen, die zumeist dazu dienten, an Nahrungsmittel heranzukommen. Mehrmals war die Polizei da, um Hausdurchsuchungen zu machen, es wurde jedoch nie etwas Belastendes zutage gefördert. Bei den gemeinsamen Unternehmungen gab Peter den Ton an, obwohl er kleiner war. In seiner Wendigkeit erinnerte er mich an ein Wiesel, das ich manchmal hinter den Baracken beobachtete. Ein bißchen ähnelte er auch dem »Franzosen«, einem hübschen feingliedrigen Mann in mittlerem Alter mit schwarzem lockigen Haar, schönen braunen Augen und schmalem Oberlippenbärtchen, dessen Namen niemand kannte.
Der Franzose, der ständig einen ölverschmierten blauen Monteuranzug trug, reparierte in einem Schuppen des Lagers Fahrräder, Motorräder, Nähmaschinen und allerlei elektrische Geräte wie Bügeleisen, Kochplatten und Lampen. Er stammte aus dem französischen Lothringen, war als Verwundeter gefangen genommen worden und nach dem Krieg zurückgeblieben. Jetzt lebte er mit einer ehemaligen Krankenschwester, einer schlanken blonden Frau zusammen, das war wohl der Hauptgrund seines verlängerten Lageraufenthalts. Peter hätte sein Sohn sein können, war es aber mit Sicherheit nicht, Peters Vorfahren waren polnischer Abstammung. Mein Vater sagte oft, zwischen Polen und Franzosen gäbe es »mentalitätsmäßige Übereinstimmungen«. Was er damit ausdrücken wollte, war mir unklar; ich verstand bloß, daß er es negativ meinte.
Peter Koralla war unter den Jungen des Lagers bald der Anführer, sozusagen der Kopf. Er plante mit uns regelrechte Kriegszüge gegen die Einheimischen, die uns ständig drangsalierten, weil sie - und in erster Linie ihre Eltern - sich von den Flüchtlingen beeinträchtigt fühlten. Er verstand sich auch aufs Zaubern. Gab man ihm einen Groschen, legte er ihn auf die ausgestreckte flache Hand, schloß sie zur Faust und förderte beim Öffnen einen Pfennig zum Vorschein, den er zurückgab. Wenn man protestierte, sagte er grinsend. »Stell dich nicht so an, auch Künstler müssen leben.«
Die Streifzüge durch die Umgebung wurden immer ausgedehnter. Vom Feld brachte ich im Herbst Rüben mit, aus dem Wald Feuerholz, Brombeeren, Blaubeeren und Pilze. Da hingen die Bäume in der Nachbarschaft voller Obst. Aber als meine Mutter bei einem Bauern nach Falläpfeln fragte, wurden wir mit der Mistgabel vom Hof gejagt. »Verdammtes Rucksackgesindel!« Das war schon nach der Währungsreform.
Als ich zehn Jahre alt war, pachteten meine Eltern in der Nähe einen Acker: zwanzig Meter lang und zehn Meter breit. Wir gruben die Erde tief um, und mein Vater zeigte mir, wie die Beete anzulegen und Kartoffeln zu pflanzen waren. Erdbeerableger stahl ich aus den Gärten am Stadtrand, eine Rhabarberstaude bekam ich geschenkt. Die Einsaat von Gemüse, Suppenkräutern, Bohnen und Kohl guckte ich bei den Nachbarn ab, für die Gurkenbeete suchte ich auf den Straßen nach Pferdemist. Jeden Tag war ich sofort nach dem Mittagessen im Garten.
Tatsächlich reichten die Kartoffeln den ganzen Winter, und unser Nachbar zur Rechten, der etwas von Landwirtschaft verstand, meinte: »Aus dir wird noch ein richtiger Bauer.« Er lief tagaus, tagein in schwarzen Schaftstiefeln und Breecheshosen herum. »Wie ein Offizier«, sagte mein Vater mit gerümpfter Nase, »dabei war er nicht einmal Unteroffizier.« Meine Mutter amüsierte sich: »Zum Reiten fehlt ihm nur noch das Pferd, den Ledereinsatz in der Hose hat er schon.«
Albert Hoffmann, so hieß er, hatte mit einer Windmühle Konkurs gemacht und beackerte jetzt, obwohl er nicht mehr der Jüngste und leicht asthmatisch war, mit erstaunlicher Energie eine größere Anbaufläche; außerdem hielt er in einer alten Mannschaftslatrine Kaninchen und Hühner. Es hieß auch, er sei wegen Betruges einige Monate im Gefängnis gewesen. Am meisten litt seine Frau unter diesem sozialen Abstieg. Sie hielt sich für etwas Besonderes und mochte es vielleicht auch gewesen sein. In dunkelblauem Kostüm mit Hut und weißen Handschuhen ging sie zum Einkaufen in die Stadt. Aus ihrer stolzen Einsilbigkeit erwachte sie kurzfristig nur, wenn der »Herr Major«, ein anderer Nachbar, der ständig eine gefärbte Fliegerunifom trug, sie mit den zumeist nur gemurmelten Worten »Küß die Hand, gnädige Frau« im Vorbeigehen grüßte. Das letzte Geld gab sie für den Friseur aus, während Albert in seinen schwarzen Lederstiefeln auf dem Acker Kartoffeln pflanzte oder häufelte oder ausgrub. Wenn die beiden sich zankten, was fast jeden Tag geschah, standen meine Eltern an der Zwischenwand und hörten zu. Das erschien mir komisch, weil sie sich selber häufig stritten. Ihre angespannten Gesichter verrieten großes Interesse; beim Essen unterhielten sie sich dann über das Gehörte und zogen ihre Schlüsse daraus. Prügelte der Nachbar seine Frau, was gelegentlich vorkam, nannte ihn meine Mutter, natürlich nur meinem Vater gegenüber, einen »Dreckskerl« oder »Lumpen«. Besonders empörte sie sich, wenn in diesen Zankereien in irgendeiner Form unser Name fiel. Einige Jahre später verließ Albert Hoffmann seine Frau und wurde nie wieder gesehen.
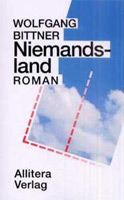
Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München
Der Autor
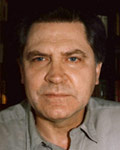 Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Online-Flyer Nr. 51 vom 04.07.2006
Druckversion
Literatur
Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 4
"Niemandsland"
von Wolfgang Bittner
IV
Als der Krieg zu Ende war
Gestern habe ich die Schreibtische gewechselt, die Korrespondenz, Fachbücher, Examensarbeiten, Prüfungsprotokolle und Notizzettel auf den linken Tisch geräumt, den rechten freigemacht. Er ist leer, bis auf die Kladde. Schreibe ich hinein, überkommt mich eine große Gelassenheit. Die Verwirrung läßt nach; auch das tiefe Entsetzen, das ich erst jetzt, im Rückblick, zu orten vermag. Ich lese, was ich bis in die Nacht hinein notiert habe, und der helle Tag vermittelt mir ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit.
Mein Vater war sehr streng. Mit vollem Munde spricht man nicht, und wer nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen. Bei Tisch hatte man aufrecht zu sitzen, die linke Hand leicht aufgestützt, und den Löffel oder die Gabel geradeaus zum Mund zu führen. Er war Hauptfeldwebel bei der Luftwaffe gewesen, in der Fallschirmjägertruppe. Den Krieg hatte er von Anfang bis Ende mitgemacht: in Rußland, auf Kreta, in Italien, Frankreich, Belgien und Holland. In der Gegend von Kleve hatte ihm Anfang 1945 ein kanadischer Spähtrupp eine Handgranate vor die Füße geworfen, als er mit seiner Kompanie einen Straßenabschnitt verteidigte. Das Glück, das ihn den Krieg bis dahin hatte heil überstehen lassen, ließ ihn auch dabei nicht im Stich; ein Bein hing nur noch an den Muskeln, aber es brauchte nicht amputiert zu werden.
Die erste Zeit nach dem Krieg ging er an Krücken, während die Knochen langsam wieder zusammenheilten. Rente bekam er nicht, weil der Vertrauensarzt des Versorgungsamtes, ein ehemaliger Oberstabsarzt, die Verwundungen als zu leicht einstufte. Lange Zeit eiterten Metallsplitter heraus. Mein Vater freute sich, daß ihm das Bein nicht abgenommen wurde.
Mehrere Jahre war er arbeitslos und kümmerte sich ehrenamtlich um den Aufbau eines Kreisverbandes der Gewerkschaft Bau?Steine?Erden, bis ein hauptamtlicher Sekretär eingestellt wurde. Ich glaube, er war damals todunglücklich. Einmal wehrte ich mich gegen seine Schläge mit einer Gabel, die ich zum Essen in der Hand hielt, und er verletzte sich am Handgelenk. Ich schlag´ dich tot, du Hund!« schrie er, hieb mir seinen Stuhl über den Rücken und stieß meine Mutter beiseite, die dazwischensprang. Ich flüchtete in die Weißdornbüsche hinter der Baracke und wagte mich erst abends wieder hinein.
Hinterher bastelte er mir einen Bauernhof aus Sperrholz. Die Tiere sägte er mit der Laubsäge aus, malte sie an und befestigte sie mit stehengelassenen Fußzapfen auf der Holzunterlage. Er spielte gut Mundharmonika, aber Lieder sangen wir selten. Im Winter saßen wir oft um den Ofen herum und hörten stundenlang Radio. Mehrmals in der Woche gab es Hörspiele, schon am frühen Nachmittag Schulfunk. Wenn die Eltern fortgingen, hatte ich auf meine kleine Schwester aufzupassen. Wir spielten mit meinem Bauernhof und ihrer Puppe, die meine Mutter aus einem alten Strumpf genäht hatte. lm Sommer gingen wir an den Feuerlöschteich, aus dem man Weißfische und sogar Hechte und Aale angeln konnte. Zweimal am Tag fuhr jenseits der Landstraße die Kleinbahn vorbei, die später, als der Autoverkehr zunahm, stillgelegt wurde.
Wir sammelten Brennesseln und Löwenzahnblätter zum Essen und Holzabfälle zum Feuern. Die Arbeitslosenunterstützung betrug für vier Personen 24,40 Mark in der Woche; die Miete kostete monatlich zwanzig Mark, ein Brot achtundneunzig Pfennige. Eines Abends klopfte es an die Tür, und als ich öffnete, stand ein fremder Mann mit zwei großen Koffern draußen. Es war mein Onkel, der jüngere Bruder meines Vaters, der unsere Adresse vom Suchdienst erfahren hatte. In den Koffern befanden sich Kleidung, Konservendosen, Hartwurst, sogar Zigaretten und ein halbes Pfund Tee. Der Onkel erzählte, daß er gleich nach Kriegsende vorübergehend Arbeit bei der kanadischen Besatzungsarmee in Osnabrück gefunden hatte. Bevor die Kanadier ihr Militärlager den Engländern übergaben, die sehr hochnäsig auftraten, hatten sie säckeweise schwarzen Tee verbrannt, um ihn nicht den ihnen unsympathischen Verbündeten zu überlassen. Da wußte mein Onkel noch nicht, daß man für Tee, ein Nationalgetränk in unseren Breiten, eintauschen konnte, was man wollte. Unser Pech; denn für ein, zwei Säcke Tee hätte man damals ein ganzes Haus bekommen können, und mein Onkel stand auf gutem Fuß mit dem kanadischen Kommandeur.
Nebenan wohnte Walter Kosinski, ein Junge in meinem Alter. Sein Vater war Trinker und saß an heißen Sommerabenden auf einem Stuhl vor der Baracke, eine Flasche Fusel in der Hand. Am Oberkörper war er nackt, und die Hosenträger hingen seitwärts herunter, oder er trug ein schmuddeliges Unterhemd. Durch die offenen Fenster war die kreischende Stimme der Frau zu hören, die sechs Kinder zu versorgen hatte und mit dem siebten schwanger ging. Ab und zu steckte sie den Kopf heraus und schrie mit schriller Stimme die Namen der Älteren, die noch draußen waren und ins Bett sollten. Darauf knurrte ihr Mann: »Hoffentlich ist da bald Ruhe!« und nahm einen Schluck aus seiner Flasche.
Meistens rief Frau Kosinski vergeblich. Ihre Kinder kamen aber von allein, sobald es dunkel wurde. Manchmal kam die Polizei und nahm Kosinski mit; dann dauerte es einige Zeit, bis er wieder auftauchte.
Wir hielten uns abends hinter den Baracken auf und fingen in einem Abzugsgraben Frösche, mit denen wir Wetthüpfen veranstalteten. Um unseren Frosch zu Höchstleistungen anzuspornen, kitzelten wir ihn mit einem Halm, der zugleich dazu diente, die Richtung zum Ziel anzugeben. So vertrieben wir uns die Zeit. »Wenn man einen Strohhalm nimmt, kann man sie aufblasen bis zum Platzen«, sagte Walter und schnappte sich seinen Frosch. Mir war das eklig. »Wenn du es tust, haue ich dir eine runter«, warnte ich ihn. »Ist doch nur zum Spaß«, erwiderte er grinsend und begann zu blasen. Ich sprang auf ihn zu, und er warf mir den Frosch ins Gesicht. Im Nu hatte ich ihn im Schwitzkasten, aber er zog mir die Beine weg und wir purzelten die Böschung hinunter in den Graben. Meine Hand blutete aus einer Schürfwunde. »Zeig mal her«, sagte Walter versöhnlich, nahm meine Hand und spuckte kräftig auf die Verletzung. Ich riß die Hand fort und stieß ihn in den Magen, daß ihm die Luft wegblieb. »Du Schwein!« schrie ich grimmig, »ich schlag´ dich zu Brei!« Walter hielt sich den Magen. »Warum denn?« fragte er keuchend und mit schmerzverzerrtem Gesicht, »mein Vater macht das auch immer.« Er begann mir zu erklären, daß Spucke eine heilkräftige Wirkung habe.
Wir schlugen uns und vertrugen uns, wie es gerade so paßte. Nasenbluten, blaue Augen oder ausgerissene Haare waren keine Seltenheit. In erster Linie zählte körperliche Gewalt, deren Wirksamkeit sich durch Wendigkeit und heimtückisches Verhalten noch steigern ließ. Ich lernte mit der Zeit die Finte nach oben und den Boxhieb in die Magengrube, auch »finnischen Kopfstoß« oder Rückenwurf. Bei manchen ging es einige Jahre später in den Gaststätten und Tanzdielen weiter. Gewöhnlich siegte aber über jede Art der Feindschaft untereinander die Langeweile.
»Guck mal, die Holschen vom Gerd«, sagte Walter und zeigte auf die Holzpantinen eines anderen Jungen, der im Graben herumwatete und Stichlinge fing. »Was ist damit?« Er nahm die Frösche aus unserer Blechdose, steckte sie in die Pantinen und stopfte die Socken davor. Kurz darauf ging Gerd Oremek mit nassen Füßen nach Hause, sein Einweckglas mit den Stichlingen in der einen Hand, die Pantinen in der anderen. Wir schlichen hinterher und warteten, bis wir die spitzen Schreie von Frau Oremek hörten, die in der Küche die Pantinen ausgeschüttelt hatte. Danach setzten wir uns in der Dämmerung hinter den Wall und ahmten das klagende Miauen der Katze von Frau Guse nach, die sich bald zum Fenster herausbeugte und ihren Liebling rief, der irgendwo in der Feldmark herumstromerte und Vogelnester ausraubte.
Am liebsten neckten wir den alten Zielinski, der von der Fürsorge lebte, wie die meisten im Lager, und regelmäßig am späten Nachmittag mit schlurfenden Schritten zu einer freistehenden Toilettenbude ging, eine alte Zeitung in der Hand. Uns fielen immer neue Streiche ein, die wir ihm spielen konnten. Ließ er sein Fahrrad draußen stehen, stand der Sattel bald verkehrt herum. Oder wir befestigten eine Schnur am hinteren Schutzblech, so daß er beim Wegfahren plötzlich ruckartig und mit einem Krach stehenblieb. Mehrfach bauten wir auf dem Weg zu seinem Abtritt kunstvolle Fallgruben, die wir mit Wasser füllten und mit Ästen und Sand überdeckten. Einmal nagelten wir sogar die Tür zu seinem Bedürfnishäuschen zu und amüsierten uns köstlich, wie er an der Klinke riß und laut nach der Polizei schrie. Er hängte sich später im Baum hinter dem Transformatorenhaus auf, weil durch einen ortsansässigen Seemann herausgekommen war, daß seine Tochter als Prostituierte auf Sankt Pauli arbeitete.
Peter Koralla und Hans Weiß tauchten auf. Plötzlich waren sie da und wohnten bei ihrer Tante. Sie berichteten abends am Wall von ihren Erlebnissen im besetzten Breslau, und ich erfuhr, daß fette Ratten einen durchaus schmackhaften Braten abgeben können. Auch ein Dietrich, aus einem dicken Stück Draht gebogen, war neu für mich. Man konnte damit bei Dunkelheit Albert Hoffmanns Hühnerstall aufschließen, einige Eier verschwinden lassen und wieder zuschließen. Peter war außerdem ein Meister im Schlingenlegen. In den Dornenhecken und Gebüschen der näheren Umgebung fing er mit viel Geschick Kaninchen, Rebhühner und Amseln, die bei seiner Tante in den Kochtopf wanderten.
Hans, der Größere, hinkte und zeigte gern eine vernarbte Schußwunde am rechten Oberschenkel, die er bei der Besetzung Schlesiens davongetragen hatte. »Aus einer MPi«, erklärte er mit unterschwelligem Stolz. »Glaubt bloß nicht, daß der Kerl, der auf mich geschossen hat, noch lebt.« Er hatte, wie er berichtete, zusammen mit Peter in den letzten Kriegstagen noch im Volkssturm gekämpft und, wenn man seinen Worten glauben durfte, einen russischen Tank mit der Panzerfaust abgeschossen. »Ein Deutscher reicht für fünf Amis«, erklärte er, »und für zehn Ruskis.« Hinterher waren alle aus der Familie tot und die beiden in den Großstadttrümmern untergekrochen, bis sich eine Gelegenheit ergab, in den Westen zu gelangen.
Sie kannten eine Unmenge von Kniffen und Schlichen, die zumeist dazu dienten, an Nahrungsmittel heranzukommen. Mehrmals war die Polizei da, um Hausdurchsuchungen zu machen, es wurde jedoch nie etwas Belastendes zutage gefördert. Bei den gemeinsamen Unternehmungen gab Peter den Ton an, obwohl er kleiner war. In seiner Wendigkeit erinnerte er mich an ein Wiesel, das ich manchmal hinter den Baracken beobachtete. Ein bißchen ähnelte er auch dem »Franzosen«, einem hübschen feingliedrigen Mann in mittlerem Alter mit schwarzem lockigen Haar, schönen braunen Augen und schmalem Oberlippenbärtchen, dessen Namen niemand kannte.
Der Franzose, der ständig einen ölverschmierten blauen Monteuranzug trug, reparierte in einem Schuppen des Lagers Fahrräder, Motorräder, Nähmaschinen und allerlei elektrische Geräte wie Bügeleisen, Kochplatten und Lampen. Er stammte aus dem französischen Lothringen, war als Verwundeter gefangen genommen worden und nach dem Krieg zurückgeblieben. Jetzt lebte er mit einer ehemaligen Krankenschwester, einer schlanken blonden Frau zusammen, das war wohl der Hauptgrund seines verlängerten Lageraufenthalts. Peter hätte sein Sohn sein können, war es aber mit Sicherheit nicht, Peters Vorfahren waren polnischer Abstammung. Mein Vater sagte oft, zwischen Polen und Franzosen gäbe es »mentalitätsmäßige Übereinstimmungen«. Was er damit ausdrücken wollte, war mir unklar; ich verstand bloß, daß er es negativ meinte.
Peter Koralla war unter den Jungen des Lagers bald der Anführer, sozusagen der Kopf. Er plante mit uns regelrechte Kriegszüge gegen die Einheimischen, die uns ständig drangsalierten, weil sie - und in erster Linie ihre Eltern - sich von den Flüchtlingen beeinträchtigt fühlten. Er verstand sich auch aufs Zaubern. Gab man ihm einen Groschen, legte er ihn auf die ausgestreckte flache Hand, schloß sie zur Faust und förderte beim Öffnen einen Pfennig zum Vorschein, den er zurückgab. Wenn man protestierte, sagte er grinsend. »Stell dich nicht so an, auch Künstler müssen leben.«
Die Streifzüge durch die Umgebung wurden immer ausgedehnter. Vom Feld brachte ich im Herbst Rüben mit, aus dem Wald Feuerholz, Brombeeren, Blaubeeren und Pilze. Da hingen die Bäume in der Nachbarschaft voller Obst. Aber als meine Mutter bei einem Bauern nach Falläpfeln fragte, wurden wir mit der Mistgabel vom Hof gejagt. »Verdammtes Rucksackgesindel!« Das war schon nach der Währungsreform.
Als ich zehn Jahre alt war, pachteten meine Eltern in der Nähe einen Acker: zwanzig Meter lang und zehn Meter breit. Wir gruben die Erde tief um, und mein Vater zeigte mir, wie die Beete anzulegen und Kartoffeln zu pflanzen waren. Erdbeerableger stahl ich aus den Gärten am Stadtrand, eine Rhabarberstaude bekam ich geschenkt. Die Einsaat von Gemüse, Suppenkräutern, Bohnen und Kohl guckte ich bei den Nachbarn ab, für die Gurkenbeete suchte ich auf den Straßen nach Pferdemist. Jeden Tag war ich sofort nach dem Mittagessen im Garten.
Tatsächlich reichten die Kartoffeln den ganzen Winter, und unser Nachbar zur Rechten, der etwas von Landwirtschaft verstand, meinte: »Aus dir wird noch ein richtiger Bauer.« Er lief tagaus, tagein in schwarzen Schaftstiefeln und Breecheshosen herum. »Wie ein Offizier«, sagte mein Vater mit gerümpfter Nase, »dabei war er nicht einmal Unteroffizier.« Meine Mutter amüsierte sich: »Zum Reiten fehlt ihm nur noch das Pferd, den Ledereinsatz in der Hose hat er schon.«
Albert Hoffmann, so hieß er, hatte mit einer Windmühle Konkurs gemacht und beackerte jetzt, obwohl er nicht mehr der Jüngste und leicht asthmatisch war, mit erstaunlicher Energie eine größere Anbaufläche; außerdem hielt er in einer alten Mannschaftslatrine Kaninchen und Hühner. Es hieß auch, er sei wegen Betruges einige Monate im Gefängnis gewesen. Am meisten litt seine Frau unter diesem sozialen Abstieg. Sie hielt sich für etwas Besonderes und mochte es vielleicht auch gewesen sein. In dunkelblauem Kostüm mit Hut und weißen Handschuhen ging sie zum Einkaufen in die Stadt. Aus ihrer stolzen Einsilbigkeit erwachte sie kurzfristig nur, wenn der »Herr Major«, ein anderer Nachbar, der ständig eine gefärbte Fliegerunifom trug, sie mit den zumeist nur gemurmelten Worten »Küß die Hand, gnädige Frau« im Vorbeigehen grüßte. Das letzte Geld gab sie für den Friseur aus, während Albert in seinen schwarzen Lederstiefeln auf dem Acker Kartoffeln pflanzte oder häufelte oder ausgrub. Wenn die beiden sich zankten, was fast jeden Tag geschah, standen meine Eltern an der Zwischenwand und hörten zu. Das erschien mir komisch, weil sie sich selber häufig stritten. Ihre angespannten Gesichter verrieten großes Interesse; beim Essen unterhielten sie sich dann über das Gehörte und zogen ihre Schlüsse daraus. Prügelte der Nachbar seine Frau, was gelegentlich vorkam, nannte ihn meine Mutter, natürlich nur meinem Vater gegenüber, einen »Dreckskerl« oder »Lumpen«. Besonders empörte sie sich, wenn in diesen Zankereien in irgendeiner Form unser Name fiel. Einige Jahre später verließ Albert Hoffmann seine Frau und wurde nie wieder gesehen.
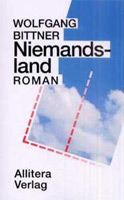
Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München
Der Autor
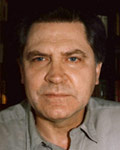 Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.Online-Flyer Nr. 51 vom 04.07.2006
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE