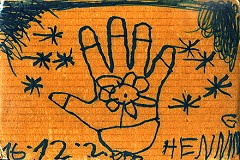SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Mehrteiler
NRhZ-Serie aus dem "Buch eines zornigen Mannes" - Folge 2
Die Niederlage des Gefängnisses
Von Hubertus Becker - vorgestellt von Christiane Ensslin
Hubertus Becker hat die verschiedenen Kapitel seines Buches durch Erzählungen aus dem Alltag des Strafvollzugs anschaulich - also sinnlich nachvollziehbar - ergänzt. Diese plastischen Schilderungen machen das analytische Buch, das sich mit der Zugangskontrolle, der Verwaltung, den Fachdiensten, dem Essen und der Arbeit im Gefängnis ebenso befaßt wie mit der Gesundheit, der Subkultur im Gefängnis, dem Widerstand gegen das Gefängnissystem und vielem anderen mehr, zusätzlich zum Leseerlebnis.
Beim Eintritt in den Knast wird der Gefangene mit einer Nummer versehen, die fortan neben seinem Namen für seine Identifikation sorgt. Er wird vollständig entkleidet. Erst jetzt, aller persönlichen Dinge wie Kleidung und Schmuck beraubt, tritt er in die Welt des Gefängnisses ein: nackt und unter den Augen der Staatsdiener. Je nach Knast und je nach Laune der Beamten geht das mit einer Inspektion des Darmausganges einher, wobei dem Gefangenen eine erste Ahnung davon vermittelt wird, welchen Stellenwert seine Menschenwürde fortan einnimmt. Die ihm zugeteilte Gefangenenkleidung besteht aus ungesundem, klobigem Schuhwerk, schlecht geschnittenen Hosen und kragenlosen Hemden. Kurz: die ganze Prozedur taucht den würdesensiblen Menschen in Scham und Unbehagen. Waren die Sträflingskleider früher quergestreift, herrscht heute das schmucklose Blau der Arbeiter vor, ein dezenter Hinweis auf die erste Funktion des Gefangenen, nämlich Objekt der Ausbeutung zu sein.
Gefängnishaft bedeutet das Ende der tausend Dinge, die den Menschen das Leben lieben lassen. Darüber hinaus gibt es wenig, was allen Gefangenen gemeinsam ist, nicht einmal Einsamkeit und Verzweiflung. Insassen von Gefängnissen stellen eine in hohem Maße heterogene Gesellschaft dar. Hier leben Menschen der unterschiedlichsten Kulturen und Weltanschauungen zusammen, Menschen verschiedenster Charaktere, Talente, Sprachen, Bildung, sozialer Herkunft und nicht zuletzt Krankheiten. Sie alle reagieren auf die Gefangenschaft auf ihre Weise.
Ein häufiges Reaktionsmuster ist der Rückzug, die soziale Verweigerung. Sich mißverstanden fühlend und unfähig, dem Schicksal die Stirn zu bieten, ziehen sich die Verweigerer in das Schneckenhaus der ihnen zugewiesenen Zelle zurück und kapseln sich vom sozialen Getriebe der Anstalt ab. Es gibt unter ihnen Gefangene, die zehn Jahre lang nicht an die frische Luft gehen, die sich sozusagen vollständig und endgültig in den Uterus der Mutter Zuchthaus zurückgezogen haben. Ihnen geht mit der Zeit jede soziale Kompetenz verloren, und sie zeigen ein Phänomen, das unter dem Begriff der Lebensuntüchtigkeit bekannt ist. Die Verweigerer werden im Knast zu sozialen Pflegefällen, auch über die Haftzeit hinaus.
Eine zweite Gruppe stellen die Konformisten, die versuchen, aus der Not eine Tugend zu machen. Sie gestehen, schuldig zu sein und geben vor, Reue zu verspüren. Sie erklären sich bereit, zu sühnen. Diese Kuli-Mentalität ist eine gute Strategie, um aus dem Knast so bald wie möglich wieder herauszukommen. Aus der gesellschaftlichen Perspektive ist erzwungene Konformität jedoch gefährlich, da das konforme Verhalten nicht auf Einsicht gründet und nur solange aufrechterhalten wird, wie der Betroffene unter Zwang steht.
Aus dieser Gruppe rekrutieren sich auch die Kalfaktoren, sogenannte Hausarbeiter, Essensverteiler und Inhaber diverser Sonderpöstchen, ohne deren Beitrag der reibungslose Ablauf der Anstalten nicht gewährleistet wäre. Ohne sich die Frage zu stellen, wem sie durch ihre Komplizenschaft mit der Behörde nutzen und wem sie schaden, schielen sie auf den kleinen Vorteil, den ihnen die Wärter im Alltag für diesen Verrat gewähren, wobei die meisten dieser Hausarbeiter ihre Arbeit nicht einmal als Verrat wahrnehmen.
Eine dritte Gruppe stellen die Pragmatiker, die sich der Realität im Knast wahrscheinlich am besten anpassen. Sie nutzen die wenigen Angebote aus, sich zu entfalten, etwa beim Sport und beim Spiel; sie organisieren die Subkultur und sehen zu, daß sie im Sinne ihrer hedonistischen Lebenseinstellung einen Rest an Lust und Spaß erleben, etwa durch Drogenkonsum oder beim Glücksspiel. Einerseits passen sie sich an, ducken sich hier, halten sich dort bedeckt, greifen andererseits nach jedem Vorteil, jeder Chance, immer flexibel und bestrebt, ihr trauriges Los ein wenig zu verbessern. Mehr oder weniger offen stehen sie in Feindschaft zur Gesellschaft, den Wärtern und den Konformisten.
Weniger häufig im Knast anzutreffen sind die echten Rebellen, die durch Insubordination und allerlei knastpolitische Aktionen der Vollzugsbehörde aktiven Widerstand entgegenbringen. Sei es, daß sie sich zu Unrecht bestraft fühlen, daß sie glauben, Opfer eines bösen Spiels geworden zu sein; sei es, daß die Mißachtung ihrer Würde im Gefängnis ihr sittliches Empfinden verletzt; sei es, daß sie Philosophen sind, die von der Absurdität der Welt im allgemeinen und der des Gefängnisses im besonderen überzeugt sind: sie alle schöpfen Kraft aus dem Bewußtsein, daß Freiheit, Solidarität und Gleichheit Werte sind, die der Staat nicht anzurühren hat. Die Rebellen im Knast haben den schwersten Stand: ihr offen erklärter Widerstand erscheint den Beamten vom kleinsten Schließer über den Anstaltsleiter bis hin zum Vorsitzenden Richter der Strafvollstreckungskammer als Beweis arroganter Uneinsichtigkeit oder gar verhärteter krimineller Energie. Der Rebell, leidet zwar am meisten, verkraftet den Knast aber erstaunlicherweise auch am besten.
Daß Menschen auf Gefangenschaft verschieden reagieren, hat vielfältige Ursachen. Charakterliche Veranlagung, bisherige Lebenserfahrung, soziale Herkunft und psychische Verfassung spielen dabei eine Rolle. Was hingegen Menschen in den Kerkern aller Länder und zu allen Zeiten vereint, ist das ausgeprägte Gefühl dafür, daß ihnen ein Unrecht geschieht. Was immer den Einzelnen ins Gefängnis geführt haben mag, er weiß, daß der Zufall und die Umstände dabei eine entscheidende Rolle gespielt hat, und er weiß, daß kein Mensch das Recht hat, ihn moralisch zu verurteilen, weil kein Mensch die Ursachen seines Verhaltens wirklich kennt.
Wenn Gefangene von Schuld, Reue und Sühnebereitschaft sprechen, so wollen sie damit sagen, daß sie einsehen, "Mist gebaut" zu haben und daß sie ihre Taten bedauern. Keineswegs stimmen sie mit denjenigen überein, die ihnen einreden wollen, verdorbene Charaktere zu haben, schlechte Menschen zu sein. Die Ursachen, die dafür verantwortlich sind, daß Menschen mit der Gesellschaft und ihren Gesetzen in Konflikt geraten, sind ebenso vielfältig wie die Beweggründe jedes anderen menschlichen Verhaltens auch. In einem weit gefaßten Sinn und vereinfacht dargestellt sind es drei Triebfedern, die kriminelles Handeln begünstigen: die Armut, die Krankheit und die Rebellion.
An erster Stelle ist die Armut zu nennen. Angehörige der unterprivilegierten sozialen Schichten sind im Knast deutlich überrepräsentiert, während man "Repräsentanten" des Bürgertums und der Eliten nur selten auf einem Gefängnishof antrifft. Nach wie vor ist ein großer Teil der Gefangenen deshalb in Haft, weil sie sich auf irgendeine illegale Weise bereichert haben. Der Zusammenhang zwischen Armut und Diebstahl ist evident. Aber auch Raub, Betrug, Hehlerei und Drogenhandel gehören in diesen Katalog.
Es folgen die sozialisationsgeschädigten Neurotiker, deren Krankheitsbilder ein weites Spektrum füllen: krankhafte Habgier mündet oft in Betrug, unkontrollierte Eifersucht endet oft in schwerer Körperverletzung, aggressive Affekte und Racheakte führen oft zu Brandstiftung und Totschlag, frühkindliche Traumatisierung zu sexueller Perversion und Gewalt, Minderwertigkeitsgefühle zu Machtstreben und Ausbeutung. Die von Psychopathen verübten Gewalttaten, Amokläufe, Attentate, Lust- und Ritualmorde sind eigentlich Sache von Nervenärzten, dennoch finden sich auch solche Täter/Patienten meist im Gefängnis wieder.
Bleiben die Überzeugungstäter, die Rebellen, die sich nur nach ihren eigenen Gesetzen richten, sei es, um sich in ihrem persönlichen Entfaltungsdrang nicht einschränken zu lassen, oder sei es, um zu provozieren, um auf ihrer Ansicht nach notwendige gesellschaftliche und politische Veränderungen aufmerksam zu machen. Es sind Menschen, die aus den verschiedensten Gründen der Gesellschaft den Rücken gekehrt haben, die die bürgerliche Moral als Heuchelei entlarvt haben; Menschen, deren Träume und Sehnsüchte sich mit den Gesetzen der Arbeit und der Religion nicht vereinbaren lassen.
Einmal im Gefängnis, behandelt die Justiz alle gleich: im großen Pool des Zuchthauses vermischen sich die Spione mit den Dieben, die Junkies mit den Trinkern, die Einbrecher mit den Sittenstrolchen, die Betrüger mit den Mördern, die Schläger mit den Hochstaplern, die Dealer mit den Terroristen. Einmal verurteilt und im Knast, gehören sie zur großen Bruderschaft der Delinquenten, die fortan vom Gefängnis an die Bewährungshilfe weitergereicht werden, draußen selten eine Arbeit finden, größtenteils von der Polizei wieder aufgegriffen und von den Gerichten anschließend als Rückfalltäter, Bewährungsversager, unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher dem Gefängnissystem wieder einverleibt werden.
Hubertus Becker hat noch keinen Verlag gefunden. Schwere Zeiten für Justiz- und Gefängniskritik.
 Christiane Ensslin, geboren 1939, lebt seit 1964 in Köln. Verschiedene Berufe, wie Vermessungstechnikerin, Kellnerin, Redakteurin, Lektorin und Archivarin. Jetzt Rentnerin und wieder einmal im Vorstand des Kölner Appell gegen Rassismus e.V.
Christiane Ensslin, geboren 1939, lebt seit 1964 in Köln. Verschiedene Berufe, wie Vermessungstechnikerin, Kellnerin, Redakteurin, Lektorin und Archivarin. Jetzt Rentnerin und wieder einmal im Vorstand des Kölner Appell gegen Rassismus e.V.
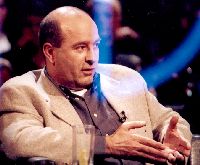 Hubertus Becker, geb. 1951 im Rheinland; 1971 Abitur, anschließend zehn Jahre in Spanien, den USA und Indonesien; 1982 wegen Drogenschmuggels für zehn Jahre inhaftiert, von 1992 bis 1995 als Kaufmann in China, 1996 wegen Geldwäsche erneut inhaftiert; seit 1999 als Drehbuchautor tätig, 2005 aus der Haft entlassen; lebt derzeit im Hunsrück und schreibt Ganoven-Biographien und Drehbücher fürs Fernsehen.
Hubertus Becker, geb. 1951 im Rheinland; 1971 Abitur, anschließend zehn Jahre in Spanien, den USA und Indonesien; 1982 wegen Drogenschmuggels für zehn Jahre inhaftiert, von 1992 bis 1995 als Kaufmann in China, 1996 wegen Geldwäsche erneut inhaftiert; seit 1999 als Drehbuchautor tätig, 2005 aus der Haft entlassen; lebt derzeit im Hunsrück und schreibt Ganoven-Biographien und Drehbücher fürs Fernsehen.
Online-Flyer Nr. 49 vom 20.06.2006
Druckversion
Mehrteiler
NRhZ-Serie aus dem "Buch eines zornigen Mannes" - Folge 2
Die Niederlage des Gefängnisses
Von Hubertus Becker - vorgestellt von Christiane Ensslin
Hubertus Becker hat die verschiedenen Kapitel seines Buches durch Erzählungen aus dem Alltag des Strafvollzugs anschaulich - also sinnlich nachvollziehbar - ergänzt. Diese plastischen Schilderungen machen das analytische Buch, das sich mit der Zugangskontrolle, der Verwaltung, den Fachdiensten, dem Essen und der Arbeit im Gefängnis ebenso befaßt wie mit der Gesundheit, der Subkultur im Gefängnis, dem Widerstand gegen das Gefängnissystem und vielem anderen mehr, zusätzlich zum Leseerlebnis.
Beim Eintritt in den Knast wird der Gefangene mit einer Nummer versehen, die fortan neben seinem Namen für seine Identifikation sorgt. Er wird vollständig entkleidet. Erst jetzt, aller persönlichen Dinge wie Kleidung und Schmuck beraubt, tritt er in die Welt des Gefängnisses ein: nackt und unter den Augen der Staatsdiener. Je nach Knast und je nach Laune der Beamten geht das mit einer Inspektion des Darmausganges einher, wobei dem Gefangenen eine erste Ahnung davon vermittelt wird, welchen Stellenwert seine Menschenwürde fortan einnimmt. Die ihm zugeteilte Gefangenenkleidung besteht aus ungesundem, klobigem Schuhwerk, schlecht geschnittenen Hosen und kragenlosen Hemden. Kurz: die ganze Prozedur taucht den würdesensiblen Menschen in Scham und Unbehagen. Waren die Sträflingskleider früher quergestreift, herrscht heute das schmucklose Blau der Arbeiter vor, ein dezenter Hinweis auf die erste Funktion des Gefangenen, nämlich Objekt der Ausbeutung zu sein.
Gefängnishaft bedeutet das Ende der tausend Dinge, die den Menschen das Leben lieben lassen. Darüber hinaus gibt es wenig, was allen Gefangenen gemeinsam ist, nicht einmal Einsamkeit und Verzweiflung. Insassen von Gefängnissen stellen eine in hohem Maße heterogene Gesellschaft dar. Hier leben Menschen der unterschiedlichsten Kulturen und Weltanschauungen zusammen, Menschen verschiedenster Charaktere, Talente, Sprachen, Bildung, sozialer Herkunft und nicht zuletzt Krankheiten. Sie alle reagieren auf die Gefangenschaft auf ihre Weise.
Ein häufiges Reaktionsmuster ist der Rückzug, die soziale Verweigerung. Sich mißverstanden fühlend und unfähig, dem Schicksal die Stirn zu bieten, ziehen sich die Verweigerer in das Schneckenhaus der ihnen zugewiesenen Zelle zurück und kapseln sich vom sozialen Getriebe der Anstalt ab. Es gibt unter ihnen Gefangene, die zehn Jahre lang nicht an die frische Luft gehen, die sich sozusagen vollständig und endgültig in den Uterus der Mutter Zuchthaus zurückgezogen haben. Ihnen geht mit der Zeit jede soziale Kompetenz verloren, und sie zeigen ein Phänomen, das unter dem Begriff der Lebensuntüchtigkeit bekannt ist. Die Verweigerer werden im Knast zu sozialen Pflegefällen, auch über die Haftzeit hinaus.
Eine zweite Gruppe stellen die Konformisten, die versuchen, aus der Not eine Tugend zu machen. Sie gestehen, schuldig zu sein und geben vor, Reue zu verspüren. Sie erklären sich bereit, zu sühnen. Diese Kuli-Mentalität ist eine gute Strategie, um aus dem Knast so bald wie möglich wieder herauszukommen. Aus der gesellschaftlichen Perspektive ist erzwungene Konformität jedoch gefährlich, da das konforme Verhalten nicht auf Einsicht gründet und nur solange aufrechterhalten wird, wie der Betroffene unter Zwang steht.
Aus dieser Gruppe rekrutieren sich auch die Kalfaktoren, sogenannte Hausarbeiter, Essensverteiler und Inhaber diverser Sonderpöstchen, ohne deren Beitrag der reibungslose Ablauf der Anstalten nicht gewährleistet wäre. Ohne sich die Frage zu stellen, wem sie durch ihre Komplizenschaft mit der Behörde nutzen und wem sie schaden, schielen sie auf den kleinen Vorteil, den ihnen die Wärter im Alltag für diesen Verrat gewähren, wobei die meisten dieser Hausarbeiter ihre Arbeit nicht einmal als Verrat wahrnehmen.
Eine dritte Gruppe stellen die Pragmatiker, die sich der Realität im Knast wahrscheinlich am besten anpassen. Sie nutzen die wenigen Angebote aus, sich zu entfalten, etwa beim Sport und beim Spiel; sie organisieren die Subkultur und sehen zu, daß sie im Sinne ihrer hedonistischen Lebenseinstellung einen Rest an Lust und Spaß erleben, etwa durch Drogenkonsum oder beim Glücksspiel. Einerseits passen sie sich an, ducken sich hier, halten sich dort bedeckt, greifen andererseits nach jedem Vorteil, jeder Chance, immer flexibel und bestrebt, ihr trauriges Los ein wenig zu verbessern. Mehr oder weniger offen stehen sie in Feindschaft zur Gesellschaft, den Wärtern und den Konformisten.
Weniger häufig im Knast anzutreffen sind die echten Rebellen, die durch Insubordination und allerlei knastpolitische Aktionen der Vollzugsbehörde aktiven Widerstand entgegenbringen. Sei es, daß sie sich zu Unrecht bestraft fühlen, daß sie glauben, Opfer eines bösen Spiels geworden zu sein; sei es, daß die Mißachtung ihrer Würde im Gefängnis ihr sittliches Empfinden verletzt; sei es, daß sie Philosophen sind, die von der Absurdität der Welt im allgemeinen und der des Gefängnisses im besonderen überzeugt sind: sie alle schöpfen Kraft aus dem Bewußtsein, daß Freiheit, Solidarität und Gleichheit Werte sind, die der Staat nicht anzurühren hat. Die Rebellen im Knast haben den schwersten Stand: ihr offen erklärter Widerstand erscheint den Beamten vom kleinsten Schließer über den Anstaltsleiter bis hin zum Vorsitzenden Richter der Strafvollstreckungskammer als Beweis arroganter Uneinsichtigkeit oder gar verhärteter krimineller Energie. Der Rebell, leidet zwar am meisten, verkraftet den Knast aber erstaunlicherweise auch am besten.
Daß Menschen auf Gefangenschaft verschieden reagieren, hat vielfältige Ursachen. Charakterliche Veranlagung, bisherige Lebenserfahrung, soziale Herkunft und psychische Verfassung spielen dabei eine Rolle. Was hingegen Menschen in den Kerkern aller Länder und zu allen Zeiten vereint, ist das ausgeprägte Gefühl dafür, daß ihnen ein Unrecht geschieht. Was immer den Einzelnen ins Gefängnis geführt haben mag, er weiß, daß der Zufall und die Umstände dabei eine entscheidende Rolle gespielt hat, und er weiß, daß kein Mensch das Recht hat, ihn moralisch zu verurteilen, weil kein Mensch die Ursachen seines Verhaltens wirklich kennt.
Wenn Gefangene von Schuld, Reue und Sühnebereitschaft sprechen, so wollen sie damit sagen, daß sie einsehen, "Mist gebaut" zu haben und daß sie ihre Taten bedauern. Keineswegs stimmen sie mit denjenigen überein, die ihnen einreden wollen, verdorbene Charaktere zu haben, schlechte Menschen zu sein. Die Ursachen, die dafür verantwortlich sind, daß Menschen mit der Gesellschaft und ihren Gesetzen in Konflikt geraten, sind ebenso vielfältig wie die Beweggründe jedes anderen menschlichen Verhaltens auch. In einem weit gefaßten Sinn und vereinfacht dargestellt sind es drei Triebfedern, die kriminelles Handeln begünstigen: die Armut, die Krankheit und die Rebellion.
An erster Stelle ist die Armut zu nennen. Angehörige der unterprivilegierten sozialen Schichten sind im Knast deutlich überrepräsentiert, während man "Repräsentanten" des Bürgertums und der Eliten nur selten auf einem Gefängnishof antrifft. Nach wie vor ist ein großer Teil der Gefangenen deshalb in Haft, weil sie sich auf irgendeine illegale Weise bereichert haben. Der Zusammenhang zwischen Armut und Diebstahl ist evident. Aber auch Raub, Betrug, Hehlerei und Drogenhandel gehören in diesen Katalog.
Es folgen die sozialisationsgeschädigten Neurotiker, deren Krankheitsbilder ein weites Spektrum füllen: krankhafte Habgier mündet oft in Betrug, unkontrollierte Eifersucht endet oft in schwerer Körperverletzung, aggressive Affekte und Racheakte führen oft zu Brandstiftung und Totschlag, frühkindliche Traumatisierung zu sexueller Perversion und Gewalt, Minderwertigkeitsgefühle zu Machtstreben und Ausbeutung. Die von Psychopathen verübten Gewalttaten, Amokläufe, Attentate, Lust- und Ritualmorde sind eigentlich Sache von Nervenärzten, dennoch finden sich auch solche Täter/Patienten meist im Gefängnis wieder.
Bleiben die Überzeugungstäter, die Rebellen, die sich nur nach ihren eigenen Gesetzen richten, sei es, um sich in ihrem persönlichen Entfaltungsdrang nicht einschränken zu lassen, oder sei es, um zu provozieren, um auf ihrer Ansicht nach notwendige gesellschaftliche und politische Veränderungen aufmerksam zu machen. Es sind Menschen, die aus den verschiedensten Gründen der Gesellschaft den Rücken gekehrt haben, die die bürgerliche Moral als Heuchelei entlarvt haben; Menschen, deren Träume und Sehnsüchte sich mit den Gesetzen der Arbeit und der Religion nicht vereinbaren lassen.
Einmal im Gefängnis, behandelt die Justiz alle gleich: im großen Pool des Zuchthauses vermischen sich die Spione mit den Dieben, die Junkies mit den Trinkern, die Einbrecher mit den Sittenstrolchen, die Betrüger mit den Mördern, die Schläger mit den Hochstaplern, die Dealer mit den Terroristen. Einmal verurteilt und im Knast, gehören sie zur großen Bruderschaft der Delinquenten, die fortan vom Gefängnis an die Bewährungshilfe weitergereicht werden, draußen selten eine Arbeit finden, größtenteils von der Polizei wieder aufgegriffen und von den Gerichten anschließend als Rückfalltäter, Bewährungsversager, unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher dem Gefängnissystem wieder einverleibt werden.
Hubertus Becker hat noch keinen Verlag gefunden. Schwere Zeiten für Justiz- und Gefängniskritik.
 Christiane Ensslin, geboren 1939, lebt seit 1964 in Köln. Verschiedene Berufe, wie Vermessungstechnikerin, Kellnerin, Redakteurin, Lektorin und Archivarin. Jetzt Rentnerin und wieder einmal im Vorstand des Kölner Appell gegen Rassismus e.V.
Christiane Ensslin, geboren 1939, lebt seit 1964 in Köln. Verschiedene Berufe, wie Vermessungstechnikerin, Kellnerin, Redakteurin, Lektorin und Archivarin. Jetzt Rentnerin und wieder einmal im Vorstand des Kölner Appell gegen Rassismus e.V.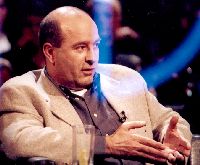 Hubertus Becker, geb. 1951 im Rheinland; 1971 Abitur, anschließend zehn Jahre in Spanien, den USA und Indonesien; 1982 wegen Drogenschmuggels für zehn Jahre inhaftiert, von 1992 bis 1995 als Kaufmann in China, 1996 wegen Geldwäsche erneut inhaftiert; seit 1999 als Drehbuchautor tätig, 2005 aus der Haft entlassen; lebt derzeit im Hunsrück und schreibt Ganoven-Biographien und Drehbücher fürs Fernsehen.
Hubertus Becker, geb. 1951 im Rheinland; 1971 Abitur, anschließend zehn Jahre in Spanien, den USA und Indonesien; 1982 wegen Drogenschmuggels für zehn Jahre inhaftiert, von 1992 bis 1995 als Kaufmann in China, 1996 wegen Geldwäsche erneut inhaftiert; seit 1999 als Drehbuchautor tätig, 2005 aus der Haft entlassen; lebt derzeit im Hunsrück und schreibt Ganoven-Biographien und Drehbücher fürs Fernsehen.Online-Flyer Nr. 49 vom 20.06.2006
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE