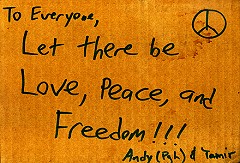SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Literatur
Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 2
"Niemandsland"
von Wolfgang Bittner
Das Lager und die kleine Stadt
Die Vergangenheit ist hervorholbar, sie läßt sich in einer Kladde aufzeichnen, beschreiben. Seit Tagen werden die Stapel auf dem rechten Schreibtisch immer höher, während ich am linken Schreibtisch sitze. Es ist wie ein Zwang, diese Aufzeichnungen weiterzuführen, zu vervollkommnen, ein ambivalentes Gefühl von Pflicht und erwartungsvoller Bereitschaft, von Verstörtheit und einer tief innerlichen Erleichterung. Ich blättere zurück und lese.
Rechnete man die Flüchtlinge aus dem Osten hinzu, zählte die Stadt etwa 6.000 Einwohner. Sie lag auf einem Geestrücken am Rande der Marsch, im Norden das flache Land bis zur See, nur unterbrochen von den Baumgruppen einzelner Bauernhöfe. Im Westen und Süden gelbe Sandwege, Wälle, Brombeerhecken und Schlehdorn, weiter hinten die blaue Silhouette des Waldes. Der Fluß, Tief genannt und aus dem Moor kommend, zog sich in einer weiten Schleife nach Norden. Die Landstraße führte mitten durch den Ort.
Dann das Lager, zur Geest hin. Baracken wie große Streichholzschachteln, eine neben der anderen, ausgerichtet auf einen Appellplatz. Aber die Zeit der Appelle war vorbei, der Arbeitsdienst abgeschafft, der letzte Kriegsgefangene schon lange entlassen, das Lazarett wurde aufgelöst. Es war die Zeit der Flüchtlinge. In einer dieser Baracken hatte mein Vater monatelang mit schweren Verwundungen gelegen, in einer anderen bekamen wir, nachdem er halbwegs genesen war, zwei Zimmer zugewiesen. Das war nach dem Krieg.
In einem Ort namens Prenzlau in der Uckermark, so erzählte meine Mutter, habe sie abends, nach Sonnenuntergang, plötzlich ein leuchtend rotes Kreuz am Himmel gesehen. Da habe sie gewußt, daß mein Vater noch lebte, was ihr kurz darauf vom Suchdienst bestätigt wurde. Die nächsten Stationen hießen Berlin, Braunschweig, Hannover und Oldenburg, bis wir schließlich ankamen.
Schokolade. Eine Woche lang gab es jeden Tag einen Riegel, mittags Graupen?, Kartoffel? oder Erbsensuppe, manchmal ganz weißes Weizenbrot. Die Frostbeulen wurden behandelt, ich hatte ein richtiges Bett für mich allein. Als es Frühling wurde, begannen die Bauern ihre Felder zu bestellen, und ich guckte vom Zaun her zu ihnen hinüber. Ab und zu brachte der Postbote ein Päckchen von der Großmutter, die »drüben«, im Osten, geblieben war. Wenn auf der Landstraße Lastwagen mit englischen Soldaten vorbeifuhren, stellte ich mich zu den anderen Kindern an den Straßenrand und klatschte in die Hände. Das Ergebnis waren ab und zu ein Rosinenbrötchen, ein paar Biskuits, ein Stück Schokolade.
Bis in die Stadt ging man eine Viertelstunde, vorbei am Schützenplatz und an den Ligusterhecken der Siedlungshäuser. Die kopfsteingepflasterten engen Straßen um die Backsteinkirche mit den knorrigen alten Bäumen hießen Drostenstraße, Kirchstraße, Norderstraße, Burgstraße. Etwas abseits lag der Marktplatz mit Kreisverwaltung, Amtsgericht, Kino, Gastwirtschaften und dem Hotel Bremer Schlüssel. Dort fanden mehrmals im Jahr Viehauftriebe statt, im Juni der Johannismarkt. Dahinter lag, umgeben von einem verwilderten Park, das Krankenhaus, das früher ein Schloß gewesen war. Die Schule, ein düsterer Ziegelbau mit schmalen hohen Fenstern, befand sich unterhalb der Kirche, die auf einer Warft lag.
Seltsame Lehrer, die Kindern sogar das Singen mit dem Rohrstock einbleuten. Groteske Figuren wie in einem Bauerntheater. Der Rektor, wuchtig und rotbäckig, angsteinflößend, verteilte gelegentlich Ohrfeigen. Manchmal mußte man vortreten und erhielt einige Hiebe mit dem Stock auf die ausgestreckte Hand. Wer in die Hosen machte, wurde bloßgestellt. Wir waren 64 Schüler in der ersten Klasse.
Es herrschte eine dumpfe Atmosphäre. Aber wer nicht viel Gutes erwartet, kann nicht so leicht enttäuscht werden. Etwa 20 Schüler kamen aus einem Kinderheim, sie hatten im Krieg ihre Eltern verloren. Einige von ihnen waren schon älter, gewieft und verschlagen; ihnen konnte keiner mehr etwas vormachen. Man erkannte sie sofort an ihren geschorenen Köpfen, den einheitlich schlottrigen Hosen, den grauen Leinenhemden und vielfach geflickten oder zerrissenen blaugrauen Tuchjacken. Man hielt sich am besten von ihnen fern, sie waren unberechenbar, traurig und verhärmt, verschlossen und widerborstig, die älteren gewalttätig. Einige stahlen, was sie kriegen konnten: Butterbrote, Kreide, Taschentücher, Mützen, Schwämme, Griffel, Buntstifte. Einmal brachten sie Krätze mit in die Schule, ein anderes Mal Läuse. Nachmittags sah ich sie bisweilen auf den Fensterbänken und Treppenstufen eines kasernenartigen Gebäudes sitzen, das als Waisenhaus diente. Dann taten sie mir leid.
Ich kann mich nicht erinnern, in der Schule einmal richtig fröhlich gewesen zu sein. Während des Unterrichts regierte der Rohrstock; man hatte still zu sitzen und zu dulden. Ein Lehrer war Hauptmann gewesen, einer Feldwebel, ein anderer kam gerade von der Hochschule und mußte sich erst zurechtfinden. Vor der Stunde beten, die Hände auf dem Tisch, den Mund halten, Reihen von Buchstaben schreiben; die Griffel kratzten auf den Schiefertafeln. »Falsch, du Trottel, du taube Nuß.« Auf dem Schulhof wurde Luft abgelassen. Schlägereien und Mißhandlungen. Die Lehrer achteten darauf, daß niemand so sehr verletzt wurde, daß er ins Krankenhaus eingeliefert werden mußte.
Vor der Turnhalle stand einmal in der Woche eine Gulaschkanone vom Roten Kreuz. Mit Heißhunger aßen wir die Rübensuppe, das Rosinenbrötchen, den Teller Milchsuppe, das Päckchen Feigenbrot, das wir Katzeneier nannten, einmal in der Woche.
Der Schrotthändler, wir sagten Lumpensammler, kaufte nahezu alles: Eisen, Blech, Papier, Knochen, Lumpen, alte Öfen, Bettgestelle, Fahrräder, Autoreifen, mit Vorliebe Buntmetall, wozu auch die Messinghülsen von Patronen und Granaten zählten. Munition zu sammeln war streng verboten worden, nachdem ein Junge aus der Nachbarschaft durch eine explodierende Granate beide Beine verloren hatte. Aber so ernst wurde das nicht genommen, man mußte sich eben vorsehen. Es gab nicht viel dafür, das wenige reichte zu Hause als Zuschuß für ein Brot oder ein halbes Pfund Margarine. Wir hatten kaum zu essen.
Geschlagen wurde damals überall, in der Schule, auf dem Heimweg, zu Hause. Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen. Es bildeten sich zwei Lager, Einheimische und Flüchtlinge. Wer den anderen in die Hände fiel, hatte Glück, wenn er mit einem blauen Auge davonkam. Fehden wurden am Rande der Stadt mit Knüppeln und Steinschleudern ausgetragen. Es gab Hautabschürfungen, Beulen, Platzwunden, ausgeschlagene Zähne, nicht selten floß Blut. Im Heimatkundeunterricht berichtete der Lehrer von den Fehden der Vergangenheit, von den Kankenas, tom Brok, Cirksenas, Ukenas und Omkens. Immer schon hatte es Krieg gegeben. Die ganze Geschichte war eine ununterbrochene Folge von Auseinandersetzungen, Plünderei, Seeräuberei, Mißhandlungen, Schändungen, Totschlag und Mord.
Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde die Stadt von der Häuptlingsfamilie Kankena beherrscht, deren Burg sich dort befand, wo nach ihrer späteren Zerstörung die Kirche errichtet wurde. Man schrieb, soweit man schreiben konnte, das Jahr 1454. Der Winter war mild, und am Weihnachtsabend waren die Wege schneefrei, die Wasserläufe von einer nur dünnen Eisschicht überzogen. Natürlich weiß man das heute nicht mehr genau, aber so könnte es jedenfalls gewesen sein. Vielleicht türmten sich auch Schneewolken an einem niedrigen Himmel. Oder der Wind wehte scharf von Osten und kündigte kältere Tage an. Wer kann das wissen, mehr als 500 Jahre später? Wer hätte bei solchem Wetter Reisende vermutet, noch dazu am Heiligen Abend? Das Land war christianisiert, wie man das nennt, und zwar seit Bonifatius, der 700 Jahre vorher in dieser Gegend erschlagen wurde. Also: Heiliger Abend. Dennoch kam ein Trupp Berittener die Straße entlang, offensichtlich ein Ziel vor den Augen. Die in der Dunkelheit verborgene Stadt. An einem Schlehdorngestrüpp stiegen die Männer von ihren Pferden. Gedämpfte Stimmen, Metall schlägt an Metall, das Schnauben der Pferde, heiseres Lachen. »Ruhe!« Bis zur Stadt waren es noch dreihundert Meter, die ersten Häuser kamen in Sicht, der breite Graben, die Mauer. Langsam und fast unhörbar senkte sich die Zugbrücke herab, leise knarrend öffnete sich das Tor.
Tanne Kankena, der Burgherr, war an diesem Abend nach reichhaltigem Mahl später als sonst zu Bett gegangen. Er war nicht mehr der Jüngste, die bevorstehende Wetteränderung riß in den Gliedern, und obwohl er einen ganzen Krug Bier getrunken hatte, schlief er unruhig, geplagt von schweren Träumen. Mitternacht war vorüber, da erwachte er und meinte in den Gängen Geräusche zu hören. Er lauschte im Halbschlaf und vernahm nichts als das Heulen des Windes. Vielleicht die Wachen. Sie waren seit Monaten auf ihrem Posten, denn es gab Auseinandersetzungen mit den Nachbarn. Man konnte nie wissen. Aber es war kalt und feucht draußen, im Bett so warm. Die Burg war sicher, das beruhigte. Er schlief wieder ein.
Kurz darauf, plötzlich, ein Lichtschein unter der Tür, ein huschender Schatten, der sich rasch vergrößerte und sich noch im Splittern des Riegels auf Kankenas Brust legte. Er war gefangen. Der neue Burgherr hieß Sibo Attena.
Nicht weit entfernt, gab es die Itzingas und die Quade Foelke, die sich jahrelang gegenseitig die Felder verwüsteten und Bauer von Bauer erschlagen ließen. Da hatte der Fürst Itzinga - es muß um 1400 gewesen sein - eine Stunde der Einsicht. Er schickte einen Unterhändler und bot Frieden an. Wenige Tage darauf kam die Antwort, diesmal kein abgeschlagener Kopf, keine abgeschnittene Nase, sondern eine Einladung auf die Burg jener Dame. Das war ermutigend. Die Nachrichten klangen freundlich, sogar herzlich, und die Einladung schloß die ganze Familie derer von Itzinga ein. Man verhandelte, ein Staatsbesuch stand bevor, man machte sich auf den Weg.
Die Gebräuche und der Umgang waren zwar rauh, um nicht zu sagen roh, aber wiederum nicht sittenlos oder anarchisch. Immerhin war der Jahre zuvor bei einer Fehde gefallene Ehemann der Gastgeberin von der Königin von Neapel zum Ritter geschlagen worden. Die Gastgeberin hatte sich beim Papst in Rom das Privileg erkauft, einen tragbaren Altar mit auf Reisen zu nehmen, um unterwegs Messen halten zu können. Auch war sie Stifterin eines Klosters und Wohltäterin eines weiteren. Andererseits war bekannt, daß sie nicht gerade zu Zimperlichkeit neigte. So hatte sie eine von Feinden besetzte Kirche stürmen und 200 Gefangene kurzerhand erschlagen lassen. Zwei gefangene Häuptlingssöhne waren im Verlies ihrer Burg so sicher verwahrt worden, daß sie sich gegenseitig vor Hunger auffraßen. Demnach war Vorsicht geboten.
Und noch einen anderen Vorfall, der sich aber auch später zugetragen haben mag, erzählt man sich: Eines Tages war ihr Schwiegersohn in heller Verzweiflung zu ihr gekommen, um sich über seine Frau zu beklagen, die offenbar wesentliche Charakterzüge der Mutter geerbt hatte. Den guten, aber wohl nicht ernst gemeinten Rat, die Tochter totzuschlagen, falls sie sich als Ehefrau nicht bessere, setzte er unmittelbar nach seiner Heimkehr in die Tat um. Daraufhin ließ die Schwiegermutter ihn, wie auch seinen Vater, gefangen nehmen und beiden den Kopf vor die Füße legen. Derartige Gepflogenheiten scheinen ihre nicht unmittelbar betroffenen Standesgenossen jedoch weder verblüfft noch erregt zu haben, zumal sich die Quade Foelke für viel Geld einen Ablaßbrief des Papstes kaufte. Man sieht, die Verhältnisse waren verwickelt und einfach zugleich, je nachdem und wie man das nimmt.
Doch auf der Burg der ehemaligen Gegnerin waren Vorbereitungen für einen würdigen Empfang getroffen worden. Davon hatten sich die Abgesandten der Itzingas überzeugt. Der Staatsbesuch konnte beginnen. Man begrüßte sich in entspannter Atmosphäre, verhandelte und plauderte, während das Festmahl vorbereitet wurde und die drei Kinder der Itzingas fröhlich im Burghof spielten. Man trank etwas, setzte sich schließlich zu Tisch und bald wurde das Essen aufgetragen: große Platten mit Fleisch und abgedeckte Schüsseln, die außergewöhnliche Genüsse versprachen. Dann hob die Quade Foelke von einer großen Schüssel den Deckel. Dann verstummten schlagartig die Gespräche. Dann sahen der Fürst Itzinga und seine Gemahlin die gesottenen Köpfe ihrer Kinder, umgeben von Salaten, Kräutern und Kohl.
Das alles finden wir in trockenen Worten in alten Chroniken, falls wir danach suchen. Das ist die eine Seite. Aber was lernen wir daraus, falls wir etwas lernen wollen? Was bedeuten uns heute die alten Berichte? Und wo finden wir Nachricht über die andere Seite, die der Dienenden und fortwährend Leidenden, der Unwissenden und Duldenden, der Aufbegehrenden und der Resignierten? Wir suchen lange und finden nichts. Wir wissen nicht, wie ihnen zumute war, wie es ihnen ging. Wir können es höchstens ahnen, wenn wir die Zahlen über Hinrichtungen lesen, die Angaben über Steuern und Dienstpflichten, die Schilderungen von Heerzügen, Eroberungen und Strafvollzug.
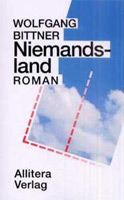
Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München
Der Autor
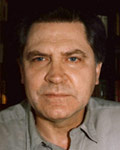 Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Online-Flyer Nr. 49 vom 20.06.2006
Druckversion
Literatur
Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 2
"Niemandsland"
von Wolfgang Bittner
Das Lager und die kleine Stadt
Die Vergangenheit ist hervorholbar, sie läßt sich in einer Kladde aufzeichnen, beschreiben. Seit Tagen werden die Stapel auf dem rechten Schreibtisch immer höher, während ich am linken Schreibtisch sitze. Es ist wie ein Zwang, diese Aufzeichnungen weiterzuführen, zu vervollkommnen, ein ambivalentes Gefühl von Pflicht und erwartungsvoller Bereitschaft, von Verstörtheit und einer tief innerlichen Erleichterung. Ich blättere zurück und lese.
Rechnete man die Flüchtlinge aus dem Osten hinzu, zählte die Stadt etwa 6.000 Einwohner. Sie lag auf einem Geestrücken am Rande der Marsch, im Norden das flache Land bis zur See, nur unterbrochen von den Baumgruppen einzelner Bauernhöfe. Im Westen und Süden gelbe Sandwege, Wälle, Brombeerhecken und Schlehdorn, weiter hinten die blaue Silhouette des Waldes. Der Fluß, Tief genannt und aus dem Moor kommend, zog sich in einer weiten Schleife nach Norden. Die Landstraße führte mitten durch den Ort.
Dann das Lager, zur Geest hin. Baracken wie große Streichholzschachteln, eine neben der anderen, ausgerichtet auf einen Appellplatz. Aber die Zeit der Appelle war vorbei, der Arbeitsdienst abgeschafft, der letzte Kriegsgefangene schon lange entlassen, das Lazarett wurde aufgelöst. Es war die Zeit der Flüchtlinge. In einer dieser Baracken hatte mein Vater monatelang mit schweren Verwundungen gelegen, in einer anderen bekamen wir, nachdem er halbwegs genesen war, zwei Zimmer zugewiesen. Das war nach dem Krieg.
In einem Ort namens Prenzlau in der Uckermark, so erzählte meine Mutter, habe sie abends, nach Sonnenuntergang, plötzlich ein leuchtend rotes Kreuz am Himmel gesehen. Da habe sie gewußt, daß mein Vater noch lebte, was ihr kurz darauf vom Suchdienst bestätigt wurde. Die nächsten Stationen hießen Berlin, Braunschweig, Hannover und Oldenburg, bis wir schließlich ankamen.
Schokolade. Eine Woche lang gab es jeden Tag einen Riegel, mittags Graupen?, Kartoffel? oder Erbsensuppe, manchmal ganz weißes Weizenbrot. Die Frostbeulen wurden behandelt, ich hatte ein richtiges Bett für mich allein. Als es Frühling wurde, begannen die Bauern ihre Felder zu bestellen, und ich guckte vom Zaun her zu ihnen hinüber. Ab und zu brachte der Postbote ein Päckchen von der Großmutter, die »drüben«, im Osten, geblieben war. Wenn auf der Landstraße Lastwagen mit englischen Soldaten vorbeifuhren, stellte ich mich zu den anderen Kindern an den Straßenrand und klatschte in die Hände. Das Ergebnis waren ab und zu ein Rosinenbrötchen, ein paar Biskuits, ein Stück Schokolade.
Bis in die Stadt ging man eine Viertelstunde, vorbei am Schützenplatz und an den Ligusterhecken der Siedlungshäuser. Die kopfsteingepflasterten engen Straßen um die Backsteinkirche mit den knorrigen alten Bäumen hießen Drostenstraße, Kirchstraße, Norderstraße, Burgstraße. Etwas abseits lag der Marktplatz mit Kreisverwaltung, Amtsgericht, Kino, Gastwirtschaften und dem Hotel Bremer Schlüssel. Dort fanden mehrmals im Jahr Viehauftriebe statt, im Juni der Johannismarkt. Dahinter lag, umgeben von einem verwilderten Park, das Krankenhaus, das früher ein Schloß gewesen war. Die Schule, ein düsterer Ziegelbau mit schmalen hohen Fenstern, befand sich unterhalb der Kirche, die auf einer Warft lag.
Seltsame Lehrer, die Kindern sogar das Singen mit dem Rohrstock einbleuten. Groteske Figuren wie in einem Bauerntheater. Der Rektor, wuchtig und rotbäckig, angsteinflößend, verteilte gelegentlich Ohrfeigen. Manchmal mußte man vortreten und erhielt einige Hiebe mit dem Stock auf die ausgestreckte Hand. Wer in die Hosen machte, wurde bloßgestellt. Wir waren 64 Schüler in der ersten Klasse.
Es herrschte eine dumpfe Atmosphäre. Aber wer nicht viel Gutes erwartet, kann nicht so leicht enttäuscht werden. Etwa 20 Schüler kamen aus einem Kinderheim, sie hatten im Krieg ihre Eltern verloren. Einige von ihnen waren schon älter, gewieft und verschlagen; ihnen konnte keiner mehr etwas vormachen. Man erkannte sie sofort an ihren geschorenen Köpfen, den einheitlich schlottrigen Hosen, den grauen Leinenhemden und vielfach geflickten oder zerrissenen blaugrauen Tuchjacken. Man hielt sich am besten von ihnen fern, sie waren unberechenbar, traurig und verhärmt, verschlossen und widerborstig, die älteren gewalttätig. Einige stahlen, was sie kriegen konnten: Butterbrote, Kreide, Taschentücher, Mützen, Schwämme, Griffel, Buntstifte. Einmal brachten sie Krätze mit in die Schule, ein anderes Mal Läuse. Nachmittags sah ich sie bisweilen auf den Fensterbänken und Treppenstufen eines kasernenartigen Gebäudes sitzen, das als Waisenhaus diente. Dann taten sie mir leid.
Ich kann mich nicht erinnern, in der Schule einmal richtig fröhlich gewesen zu sein. Während des Unterrichts regierte der Rohrstock; man hatte still zu sitzen und zu dulden. Ein Lehrer war Hauptmann gewesen, einer Feldwebel, ein anderer kam gerade von der Hochschule und mußte sich erst zurechtfinden. Vor der Stunde beten, die Hände auf dem Tisch, den Mund halten, Reihen von Buchstaben schreiben; die Griffel kratzten auf den Schiefertafeln. »Falsch, du Trottel, du taube Nuß.« Auf dem Schulhof wurde Luft abgelassen. Schlägereien und Mißhandlungen. Die Lehrer achteten darauf, daß niemand so sehr verletzt wurde, daß er ins Krankenhaus eingeliefert werden mußte.
Vor der Turnhalle stand einmal in der Woche eine Gulaschkanone vom Roten Kreuz. Mit Heißhunger aßen wir die Rübensuppe, das Rosinenbrötchen, den Teller Milchsuppe, das Päckchen Feigenbrot, das wir Katzeneier nannten, einmal in der Woche.
Der Schrotthändler, wir sagten Lumpensammler, kaufte nahezu alles: Eisen, Blech, Papier, Knochen, Lumpen, alte Öfen, Bettgestelle, Fahrräder, Autoreifen, mit Vorliebe Buntmetall, wozu auch die Messinghülsen von Patronen und Granaten zählten. Munition zu sammeln war streng verboten worden, nachdem ein Junge aus der Nachbarschaft durch eine explodierende Granate beide Beine verloren hatte. Aber so ernst wurde das nicht genommen, man mußte sich eben vorsehen. Es gab nicht viel dafür, das wenige reichte zu Hause als Zuschuß für ein Brot oder ein halbes Pfund Margarine. Wir hatten kaum zu essen.
Geschlagen wurde damals überall, in der Schule, auf dem Heimweg, zu Hause. Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen. Es bildeten sich zwei Lager, Einheimische und Flüchtlinge. Wer den anderen in die Hände fiel, hatte Glück, wenn er mit einem blauen Auge davonkam. Fehden wurden am Rande der Stadt mit Knüppeln und Steinschleudern ausgetragen. Es gab Hautabschürfungen, Beulen, Platzwunden, ausgeschlagene Zähne, nicht selten floß Blut. Im Heimatkundeunterricht berichtete der Lehrer von den Fehden der Vergangenheit, von den Kankenas, tom Brok, Cirksenas, Ukenas und Omkens. Immer schon hatte es Krieg gegeben. Die ganze Geschichte war eine ununterbrochene Folge von Auseinandersetzungen, Plünderei, Seeräuberei, Mißhandlungen, Schändungen, Totschlag und Mord.
Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde die Stadt von der Häuptlingsfamilie Kankena beherrscht, deren Burg sich dort befand, wo nach ihrer späteren Zerstörung die Kirche errichtet wurde. Man schrieb, soweit man schreiben konnte, das Jahr 1454. Der Winter war mild, und am Weihnachtsabend waren die Wege schneefrei, die Wasserläufe von einer nur dünnen Eisschicht überzogen. Natürlich weiß man das heute nicht mehr genau, aber so könnte es jedenfalls gewesen sein. Vielleicht türmten sich auch Schneewolken an einem niedrigen Himmel. Oder der Wind wehte scharf von Osten und kündigte kältere Tage an. Wer kann das wissen, mehr als 500 Jahre später? Wer hätte bei solchem Wetter Reisende vermutet, noch dazu am Heiligen Abend? Das Land war christianisiert, wie man das nennt, und zwar seit Bonifatius, der 700 Jahre vorher in dieser Gegend erschlagen wurde. Also: Heiliger Abend. Dennoch kam ein Trupp Berittener die Straße entlang, offensichtlich ein Ziel vor den Augen. Die in der Dunkelheit verborgene Stadt. An einem Schlehdorngestrüpp stiegen die Männer von ihren Pferden. Gedämpfte Stimmen, Metall schlägt an Metall, das Schnauben der Pferde, heiseres Lachen. »Ruhe!« Bis zur Stadt waren es noch dreihundert Meter, die ersten Häuser kamen in Sicht, der breite Graben, die Mauer. Langsam und fast unhörbar senkte sich die Zugbrücke herab, leise knarrend öffnete sich das Tor.
Tanne Kankena, der Burgherr, war an diesem Abend nach reichhaltigem Mahl später als sonst zu Bett gegangen. Er war nicht mehr der Jüngste, die bevorstehende Wetteränderung riß in den Gliedern, und obwohl er einen ganzen Krug Bier getrunken hatte, schlief er unruhig, geplagt von schweren Träumen. Mitternacht war vorüber, da erwachte er und meinte in den Gängen Geräusche zu hören. Er lauschte im Halbschlaf und vernahm nichts als das Heulen des Windes. Vielleicht die Wachen. Sie waren seit Monaten auf ihrem Posten, denn es gab Auseinandersetzungen mit den Nachbarn. Man konnte nie wissen. Aber es war kalt und feucht draußen, im Bett so warm. Die Burg war sicher, das beruhigte. Er schlief wieder ein.
Kurz darauf, plötzlich, ein Lichtschein unter der Tür, ein huschender Schatten, der sich rasch vergrößerte und sich noch im Splittern des Riegels auf Kankenas Brust legte. Er war gefangen. Der neue Burgherr hieß Sibo Attena.
Nicht weit entfernt, gab es die Itzingas und die Quade Foelke, die sich jahrelang gegenseitig die Felder verwüsteten und Bauer von Bauer erschlagen ließen. Da hatte der Fürst Itzinga - es muß um 1400 gewesen sein - eine Stunde der Einsicht. Er schickte einen Unterhändler und bot Frieden an. Wenige Tage darauf kam die Antwort, diesmal kein abgeschlagener Kopf, keine abgeschnittene Nase, sondern eine Einladung auf die Burg jener Dame. Das war ermutigend. Die Nachrichten klangen freundlich, sogar herzlich, und die Einladung schloß die ganze Familie derer von Itzinga ein. Man verhandelte, ein Staatsbesuch stand bevor, man machte sich auf den Weg.
Die Gebräuche und der Umgang waren zwar rauh, um nicht zu sagen roh, aber wiederum nicht sittenlos oder anarchisch. Immerhin war der Jahre zuvor bei einer Fehde gefallene Ehemann der Gastgeberin von der Königin von Neapel zum Ritter geschlagen worden. Die Gastgeberin hatte sich beim Papst in Rom das Privileg erkauft, einen tragbaren Altar mit auf Reisen zu nehmen, um unterwegs Messen halten zu können. Auch war sie Stifterin eines Klosters und Wohltäterin eines weiteren. Andererseits war bekannt, daß sie nicht gerade zu Zimperlichkeit neigte. So hatte sie eine von Feinden besetzte Kirche stürmen und 200 Gefangene kurzerhand erschlagen lassen. Zwei gefangene Häuptlingssöhne waren im Verlies ihrer Burg so sicher verwahrt worden, daß sie sich gegenseitig vor Hunger auffraßen. Demnach war Vorsicht geboten.
Und noch einen anderen Vorfall, der sich aber auch später zugetragen haben mag, erzählt man sich: Eines Tages war ihr Schwiegersohn in heller Verzweiflung zu ihr gekommen, um sich über seine Frau zu beklagen, die offenbar wesentliche Charakterzüge der Mutter geerbt hatte. Den guten, aber wohl nicht ernst gemeinten Rat, die Tochter totzuschlagen, falls sie sich als Ehefrau nicht bessere, setzte er unmittelbar nach seiner Heimkehr in die Tat um. Daraufhin ließ die Schwiegermutter ihn, wie auch seinen Vater, gefangen nehmen und beiden den Kopf vor die Füße legen. Derartige Gepflogenheiten scheinen ihre nicht unmittelbar betroffenen Standesgenossen jedoch weder verblüfft noch erregt zu haben, zumal sich die Quade Foelke für viel Geld einen Ablaßbrief des Papstes kaufte. Man sieht, die Verhältnisse waren verwickelt und einfach zugleich, je nachdem und wie man das nimmt.
Doch auf der Burg der ehemaligen Gegnerin waren Vorbereitungen für einen würdigen Empfang getroffen worden. Davon hatten sich die Abgesandten der Itzingas überzeugt. Der Staatsbesuch konnte beginnen. Man begrüßte sich in entspannter Atmosphäre, verhandelte und plauderte, während das Festmahl vorbereitet wurde und die drei Kinder der Itzingas fröhlich im Burghof spielten. Man trank etwas, setzte sich schließlich zu Tisch und bald wurde das Essen aufgetragen: große Platten mit Fleisch und abgedeckte Schüsseln, die außergewöhnliche Genüsse versprachen. Dann hob die Quade Foelke von einer großen Schüssel den Deckel. Dann verstummten schlagartig die Gespräche. Dann sahen der Fürst Itzinga und seine Gemahlin die gesottenen Köpfe ihrer Kinder, umgeben von Salaten, Kräutern und Kohl.
Das alles finden wir in trockenen Worten in alten Chroniken, falls wir danach suchen. Das ist die eine Seite. Aber was lernen wir daraus, falls wir etwas lernen wollen? Was bedeuten uns heute die alten Berichte? Und wo finden wir Nachricht über die andere Seite, die der Dienenden und fortwährend Leidenden, der Unwissenden und Duldenden, der Aufbegehrenden und der Resignierten? Wir suchen lange und finden nichts. Wir wissen nicht, wie ihnen zumute war, wie es ihnen ging. Wir können es höchstens ahnen, wenn wir die Zahlen über Hinrichtungen lesen, die Angaben über Steuern und Dienstpflichten, die Schilderungen von Heerzügen, Eroberungen und Strafvollzug.
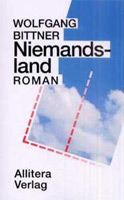
Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München
Der Autor
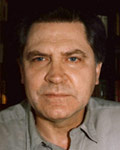 Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.Online-Flyer Nr. 49 vom 20.06.2006
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE