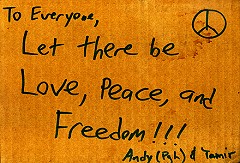SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Globales
Wahlnachlese im Nahen Osten
Irak, Palästina und Israel
Von Roni Ben Efrat
Im Nahen Osten haben wir in den vergangenen sechs Monaten Jahren drei Wahlen erlebt. Jede von diesen hat eine ohnehin schon komplizierte Situation noch weiter kompliziert. Da waren die Wahlen im Irak im Dezember 2005, dann im Januar 2005 die Wahlen zur Palästinensischen Autonomiebehörde, PA, und im März die Wahlen in Israel. In den ersten beiden Fällen fanden die Abstimmungen während oder genau im Anschluss an einen blutigen Krieg statt; sie sollten eine neue Ära der Konfliktlösung einleiten.
Irak - Bush-Demokratie
Beginnen wir mit dem Irak. Dieses Land hatte die militante Bush-Regierung für ihren Kreuzzug zur (selektiven) Auslöschung von Diktaturen im Nahen Osten als Versuchskaninchen ausersehen. Darüber hinaus sollte es sich um den Startschuss für eine neue Weltpolitik handeln, um nun - nach dem Wegfall der Sowjetunion - "die internationale Sicherheitsordnung entsprechend den amerikanischen Prinzipien und Interessen zu formen.[i] Das Dokument namens "Rebuilding America´s Defenses" vom September 2000, aus dem das vorstehende Zitat stammt, wurde zur Grundlage der Außen- und Verteidigungspolitik des US-Präsidenten George W. Bush.
Die Angriffe vom 11. September 2001 verliehen, wie ein späteres Dokument widerspiegelt, Amerikas Begierde nach globaler Kontrolle weitere Dringlichkeit. Dieses Dokument mit dem Titel "Die nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten" wurde von der Bush-Regierung am 20. September 2002 veröffentlicht.[ii] Es enthält jene Aussagen, die später als Bush-Doktrin bekannt geworden sind: "Auch wenn die Vereinigten Staaten weiterhin die Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft anstreben werden, werden wir nicht zögern, notfalls auch allein zu handeln und unser Recht auf Selbstverteidigung präventiv auszuüben ..." Die Konsequenz lag auf der Hand: Die Amerikaner würden nicht in Sicherheit sein, bis Uncle Sam seine Position als einzige Supermacht der Welt gesichert hätte. Der erste Schritt würde die Übernahme der Kontrolle über die Ölreserven im Nahen Osten sein. Diesen könnte man als edlen Feldzug zur Demokratisierung der Region verpacken.
Ein winziges Detail hatte die Bush-Regierung übersehen: die ethnische und religiöse Struktur des Irak. Hätte sie Saddam Hussein durch einen anderen rücksichtslosen Diktator ersetzt, hätte sie vielleicht die Kontrolle, die sie anstrebte, auch erlangt. Aber nein, der Vorwand lautete Demokratie, also musste Demokratie sein. In einer Gesellschaft wie der irakischen jedoch, in der die ethnische Zugehörigkeit und die religiöse Überzeugung die wesentlichen Ordnungsfaktoren ausmachen, wird Demokratie unvermeidlich zu einer anderen Spielart der Tyrannei. Eine religiöse Mehrheit wird Gottes Gesetz voranstellen. Eine ethnische Mehrheit wird versuchen, ihre Dominanz zu sichern. Als Bush und seine Neokonservativen über Demokratie im Irak sprachen, verkauften sie den Amerikanern dies innerhalb des amerikanischen Kontexts. Demokratie kann, wenn sie die Rechte von Minderheiten schützt, eine Kraft für Frieden und Gerechtigkeit sein, jedoch nur unter bestimmten Bedingungen. Wissenschaftliche, industrielle und urbane Revolutionen müssen ihr Werk getan, die Macht der Klans gebrochen und die Säkularisierung vorangetrieben haben (eine Voraussetzung für die Trennung von Religion und Staat). Auch das bringt keine ökonomische Gerechtigkeit, aber es ist ein erster Schritt. Man kann so etwas wie "demokratische Wahlen" jedoch nicht aus seinem säkularen, industriellen Kontext herausnehmen und einer religiösen Stammesgesellschaft aufdrücken, ohne damit eine Tyrannei der Mehrheit zu erzeugen.
Die irakischen Wahlen haben der Shia-Bewegung fast die Hälfte der Sitze im Parlament beschert. Das Ergebnis sind unbehebbare Spannungen. Denn es gibt im Irak weitere ethnische Gruppierungen, insbesondere die Sunniten und die Kurden. Jede von diesen ist groß genug, große Probleme zu verursachen.
Als Premierminister hatte die Shia zunächst Ibrahim al-Jaafari vorgeschlagen, der in den Monaten vor den Wahlen die provisorische Regierung angeführt hatte. Washington, die Sunniten und die Kurden mochten ihn nicht. Die Meinung der Bush-Regierung teilte auch der Leitartikel in der New York Times vom 14. Febraur 2006, der die Überschrift trug: "Der falsche Mann im Irak": "Mr. Jaafari war ein spektakulärer Fehlschlag. ... Er wird es kaum besser machen, wenn er den Job noch einmal bekommt, besonders da er seine Wahl einem politischen Deal mit den Anhängern von Moktada al-Sadr verdankt, einem Mann, dessen eigene bewaffnete Bande erheblich zum Problem beiträgt."
Am 02. April 2006 bezeichnete der Leitartikel der Times Moktada al-Sadr als "radikalen antiamerikanischen Kleriker, der eine mächtige Privatmiliz anführt, die für einen großen Teil des sektiererischen Terrors verantwortlich ist." Ethnische Milizen sind in der Tat überall im Irak, denn das Misstrauen zwischen den Ethnien hat dort tiefe historische Wurzeln, die weit in die Ära Saddam Husseins zurückreichen. Dieses Misstrauen bestand schon, ehe der Große Weiße Bush mit Angst, Schrecken und Demokratie Einzug hielt. Was hatte man also erwartet?
Der Leitartikel der Times vom 14. Februar 2006 erklärte, "Demokratie erfordert es nicht, ihn (Jaafari) als Premierminister zu bestätigen" und so geschah es auf Druck Washingtons auch: der Mann, den der demokratische Prozess nach oben gebracht hatte, wurde gezwungen, seinen Platz zu räumen. Stattdessen wurde sein Sprecher, Jawad al-Maliki, in die erste Reihe geschoben. Malaki ist ein treues Mitglied der irakischen Dawa-Partei - einer politischen Gruppierung der Shia, die jahrelang im Untergrund eine bewaffneten Widerstandsbewegung gegen die baathistische Herrschaft Saddam Husseins angeführt hat." Gibt es angesichts des religiösen und ethnischen Kontexts einen Grund für die Annahme, dass Maliki dort erfolgreich sein würde, wo Jaafari gescheitert war? Die Durchsetzung amerikanischer Interessen wird den bestehenden Konflikt nur verschärfen und das Land weiter in einen Bürgerkrieg hineintreiben.
Es gibt noch die andere Seite der Medaille. Während der Irak sich in einen Berg von Schutt verwandelt hat, haben die Amerikaner für ihren Exportartikel "Abenteuer Demokratie" schwer bezahlt. Zunächst hat die Bush-Regierung wegen der Verbindung mit der Shia die Bedeutung des Iran als geopolitische Kraft verstärkt. Amerika wird die Kooperation des Iran brauchen, wenn es sich je aus seinem irakischen Alptraum zurückziehen will (ein Punkt, der bei Spekulationen über einen US-Angriff auf den Iran berücksichtigt werden sollte). Zweitens hat sich der Ölpreis seit Beginn des Krieges mehr als verdoppelt, von 30 Dollar auf 70 Dollar pro Barrel. Drittens sind mehr als 2.300 amerikanische Soldaten getötet und über 17.000 verwundet worden, was zu einem Absturz von Bushs Popularität beigetragen und eine flügellahme Präsidentschaft nach den Kongresswahlen im November wahrscheinlich gemacht hat. Washingtons Unterstützung für Maliki beruht anscheinend eher auf seinem Wunsch aus dem selbst gebastelten Hexenkessel zu entkommen als auf irgendwelchen neuen Rezepten für die Beilegung von Konfessionskriegen.
Die palästinensische Arena
In der palästinensischen Autonomiebehörde (PA) verlaufen die Trennungslinien nicht entlang religiöser oder ethnischer Grenzen. Gleichwohl haben die Wahlen auch hier niemanden weitergebracht. Die Wahlen waren Ergebnis eines Deals zwischen Abu Mazen, dem Präsidenten der PA, und Hamas; letztere sollte ihren bewaffneten Kampf aussetzen und Abu Mazen im Gegenzug Wahlen durchführen. Hamas sah sowohl den Kommunal- als auch den Nationalwahlen ungeduldig entgegen.
Als erstes errang sie bei den Kommunalwahlen einen Erdrutschsieg. Bestürzt wollte Abu Mazen daraufhin die nationalen Wahlen verschieben. Bush bestand jedoch auf deren Durchführung. Der wegen seiner Irakpolitik heftig unter Kritik stehende amerikanische Präsident wollte zeigen, dass sich die Demokratie im Nahen Osten im Aufschwung befand. Also fanden im Januar Wahlen statt und der Sieg der Hamas überraschte alle, einschließlich ihr selbst.
Die meisten Experten hatten erwartet, dass sich das Abstimmungsmuster von dem der Kommunalwahlen unterscheiden würde. Die Bevölkerung verhielt sich jedoch anders, sie wählte wieder Hamas. Dies tat sie nicht wegen des Extremismus der Bewegung oder wegen deren Weigerung, Israel anzuerkennen und ebenso wenig, weil sie eine Verhandlungslösung ablehnt. Die Leute wollten einfach die Tiefe ihrer Abscheu vor der korrupten PA und Fatah demonstrieren. Die Wahl bot also die Möglichkeit, Israel und Amerika zu bestrafen. "Ihr wollt Demokratie? Die könnt ihr ins Gesicht kriegen!"
Was das Thema "Strafen" angeht, muss man bedenken, dass Amerika und Israel auf diesem Gebiet alte Hasen sind. Jedenfalls auf kurze Sicht. Die Schikanen, denen sie Hamas aussetzen, ohne Skrupel, Palästinenser verhungern zu lassen, sollen sie in eine zweite Fatah verwandeln. Es ist, als würden sie sagen: "Entweder wechselt Ihr Eure Streifen und übernehmt die Politik der Fatah oder Ihr scheidet aus dem Spiel aus. Wir bestimmen nicht nur die Regeln, wir entscheiden auch über das Ergebnis."
Wir haben oft gesagt, dass Hamas niemals die Absicht hatte, das große Los zu ziehen. Durch ihre Ideologie an Verhandlungen mit Israel gehindert, wäre sie lieber einer Regierung unter der Fatah beigetreten. Heute ist sie in einer eigentümlichen Situation gefangen: Die Leute wollen die Reinheit der Hamas ohne deren Politik. Wird Hamas ihre Tagesordnung zugunsten der des Volkes aufgeben? Die letzten Entwicklungen deuten nicht darauf hin. Der demokratische Prozess beinhaltet auch das Risiko zu siegen, und man tut gut daran, sich dies vorher zu überlegen. Auch ein großer Sieg kann sich in eine Niederlage verwandeln, wenn die Sieger ideologisch nicht auf die Führungsrolle vorbereitet sind.
Aber die größte Fehleinschätzung haben Israel und Amerika begangen. Dass Lauterkeit zum Hauptthema des palästinensischen Wahlkampfs wurde, lag nicht nur an der Ekel erregenden Korruption der Fatah, sondern auch am Fehlen politischer Perspektiven. Warum sollte man eine Gruppierung wählen, die Israel anerkennt und bereit ist, mit diesem zu sprechen, wenn doch klar war, dass Anerkennung und Gespräche zu nichts führten: Sie würden den Sperrzaun nicht aufhalten, nicht die Kantonisierung, sie würden Jerusalem nicht öffnen, nicht die Siedlungsblöcke beseitigen, die Gefangenen nicht befreien und die Flüchtlinge nicht zurückbringen, sie würden nicht zu einem echten palästinensischen Staat führen.
Und doch steht allen Palästinensern eine Niederlage bevor. Hamas krümmt sich heute unter internationalem und finanziellem Druck, die vermutlich in einem Bürgerkrieg oder in den Rückzug der Hamas aus der Politik und ihre Rückkehr zu den Waffen münden werden. Beide Möglichkeiten bedeuten eine Katastrophe für das palästinensische Volk.
Israels selbsttrügerische Erwartungen
In Israel, der Wiege der Demokratie im Nahen Osten, haben die Wahlen die Nation in die Lage versetzt, weiter den Kopf in den Sand zu stecken. Die Gründung der Kadima im November 2005, nach Premier Ariel Sharons Trennung vom Likud, sollte die Grundlage für eine neue israelische Mitte schaffen. Im Laufe dessen, was als der "Große Knall" bekannt wurde, spannten alle Kräfte des Zentrums ihren Karren hinter Sharon und überfuhren so die Extremisten von links und rechts. Auch kleinere Parteien schlossen sich an. Letztlich, so hoffte man, würde Israel in der Lage sein, mit der Planierraupe einen Weg zu dem zu ebnen, was sich Sharon als die beiden Hauptziele der Nation vorstellte:
1. die Lösung der sozialen Probleme, indem es in den Augen ausländischer Investoren und Finanzinstitutionen eine glaubhafte wirtschaftliche Position aufrechterhielt; und
2. die Verringerung des Ausmaßes der Besatzung und die unilaterale Festlegung permanenter Grenzen.
Keines dieser Projekte hält einer Realitätsprüfung stand. Solange Israel im Kontext des globalen Kapitalismus verbleibt, kann es nicht die Arbeitsplätze schaffen, die es brauchen würde, um die sozialen Klüfte zu schließen. Was das zweite Ziel betrifft, so werden sich die Palästinenser schlicht nicht ergeben. Dieses Gewebe selbsttrügerischer Erwartungen hing von einem Mann ab, einem alten Mann von kolossalen Ausmaßen, der von den Höhen der Stufen der Knesset jeden Tag mit einem Lächeln für die Kamera herabstieg, als wollte er sagen: "Überraschung, ich bin immer noch da!". Dann, eines Tages, war er es nicht mehr.
Zunächst sah es so aus, als würde Sharons Ausfall die Aussichten seines Nachfolgers, Ehud Olmert, das Projekt fortzusetzen, nicht beeinträchtigen. Olmert gedachte gar, die erwartete Mehrheit als eine Art nationales Referendum für einen unilateralen Rückzug zu benutzen, den er aus Teilen der Westbank durchführen wollte. Doch mit dem Wahltag zogen Besorgnis erregende Zeichen herauf. Am Tag nach der Wahl erwachte Israel mit einer merkwürdigen und diffusen politischen Landkarte. Kadima lag an der Spitze - aber nur mit 29 von 120 Mandaten. Labor war von 22 auf 19 gerutscht. Shinui, bis dahin mit 15 Mandaten drittgrößte Partei, verschwand ganz. Die Öffentlichkeit hatte den Likud abgestraft, er war von 40 auf 12 Sitze abgefallen. Eine neue rechte Partei unter Avigdor Lieberman stieg mit 11 Mandaten auf. Der Mangel an Vertrauen in Olmert oder Amir Peretz, den neuen Chef der Arbeitspartei, fand Ausdruck in einer Protestwahl für die Rentnerpartei, die sieben Mandate erhielt.
Zusammengefasst: demokratische Wahlen können schaden, insbesondere wenn sie wie im Irak unter Bedingungen stattfinden, die nur zu einem Konfessionskrieg führen können, wenn sie keine wesentlichen politischen Aussichten bieten, wie es in den palästinensischen Gebieten der Fall war; oder wenn sie, wie im Falle Israels, eine Nation davon abhalten, der Realität ins Auge zu blicken.
[1] . www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf, S. II
[1] . http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/secstrat.htm
Roni Ben Efrat ist Chefredakteurin der Zeitschrift "Challenge", die im israelischen Jaffa alle zwei Monate herausgegeben wird: http://www.hanitzotz.com/challenge/
Wir danken Endy Hagen für die Übersetzung
[i] www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf, S. II
[ii] http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/secstrat.htm
Roni Ben Efrat ist Chefredakteurin der Zeitschrift "Challenge", die im israelischen Jaffa herausgegeben wird: http://www.hanitzotz.com/challenge/
Übersetzung für die NRhZ Endy Hagen
Online-Flyer Nr. 43 vom 09.05.2006
Druckversion
Globales
Wahlnachlese im Nahen Osten
Irak, Palästina und Israel
Von Roni Ben Efrat
Im Nahen Osten haben wir in den vergangenen sechs Monaten Jahren drei Wahlen erlebt. Jede von diesen hat eine ohnehin schon komplizierte Situation noch weiter kompliziert. Da waren die Wahlen im Irak im Dezember 2005, dann im Januar 2005 die Wahlen zur Palästinensischen Autonomiebehörde, PA, und im März die Wahlen in Israel. In den ersten beiden Fällen fanden die Abstimmungen während oder genau im Anschluss an einen blutigen Krieg statt; sie sollten eine neue Ära der Konfliktlösung einleiten.
Irak - Bush-Demokratie
Beginnen wir mit dem Irak. Dieses Land hatte die militante Bush-Regierung für ihren Kreuzzug zur (selektiven) Auslöschung von Diktaturen im Nahen Osten als Versuchskaninchen ausersehen. Darüber hinaus sollte es sich um den Startschuss für eine neue Weltpolitik handeln, um nun - nach dem Wegfall der Sowjetunion - "die internationale Sicherheitsordnung entsprechend den amerikanischen Prinzipien und Interessen zu formen.[i] Das Dokument namens "Rebuilding America´s Defenses" vom September 2000, aus dem das vorstehende Zitat stammt, wurde zur Grundlage der Außen- und Verteidigungspolitik des US-Präsidenten George W. Bush.
Die Angriffe vom 11. September 2001 verliehen, wie ein späteres Dokument widerspiegelt, Amerikas Begierde nach globaler Kontrolle weitere Dringlichkeit. Dieses Dokument mit dem Titel "Die nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten" wurde von der Bush-Regierung am 20. September 2002 veröffentlicht.[ii] Es enthält jene Aussagen, die später als Bush-Doktrin bekannt geworden sind: "Auch wenn die Vereinigten Staaten weiterhin die Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft anstreben werden, werden wir nicht zögern, notfalls auch allein zu handeln und unser Recht auf Selbstverteidigung präventiv auszuüben ..." Die Konsequenz lag auf der Hand: Die Amerikaner würden nicht in Sicherheit sein, bis Uncle Sam seine Position als einzige Supermacht der Welt gesichert hätte. Der erste Schritt würde die Übernahme der Kontrolle über die Ölreserven im Nahen Osten sein. Diesen könnte man als edlen Feldzug zur Demokratisierung der Region verpacken.
Ein winziges Detail hatte die Bush-Regierung übersehen: die ethnische und religiöse Struktur des Irak. Hätte sie Saddam Hussein durch einen anderen rücksichtslosen Diktator ersetzt, hätte sie vielleicht die Kontrolle, die sie anstrebte, auch erlangt. Aber nein, der Vorwand lautete Demokratie, also musste Demokratie sein. In einer Gesellschaft wie der irakischen jedoch, in der die ethnische Zugehörigkeit und die religiöse Überzeugung die wesentlichen Ordnungsfaktoren ausmachen, wird Demokratie unvermeidlich zu einer anderen Spielart der Tyrannei. Eine religiöse Mehrheit wird Gottes Gesetz voranstellen. Eine ethnische Mehrheit wird versuchen, ihre Dominanz zu sichern. Als Bush und seine Neokonservativen über Demokratie im Irak sprachen, verkauften sie den Amerikanern dies innerhalb des amerikanischen Kontexts. Demokratie kann, wenn sie die Rechte von Minderheiten schützt, eine Kraft für Frieden und Gerechtigkeit sein, jedoch nur unter bestimmten Bedingungen. Wissenschaftliche, industrielle und urbane Revolutionen müssen ihr Werk getan, die Macht der Klans gebrochen und die Säkularisierung vorangetrieben haben (eine Voraussetzung für die Trennung von Religion und Staat). Auch das bringt keine ökonomische Gerechtigkeit, aber es ist ein erster Schritt. Man kann so etwas wie "demokratische Wahlen" jedoch nicht aus seinem säkularen, industriellen Kontext herausnehmen und einer religiösen Stammesgesellschaft aufdrücken, ohne damit eine Tyrannei der Mehrheit zu erzeugen.
Die irakischen Wahlen haben der Shia-Bewegung fast die Hälfte der Sitze im Parlament beschert. Das Ergebnis sind unbehebbare Spannungen. Denn es gibt im Irak weitere ethnische Gruppierungen, insbesondere die Sunniten und die Kurden. Jede von diesen ist groß genug, große Probleme zu verursachen.
Als Premierminister hatte die Shia zunächst Ibrahim al-Jaafari vorgeschlagen, der in den Monaten vor den Wahlen die provisorische Regierung angeführt hatte. Washington, die Sunniten und die Kurden mochten ihn nicht. Die Meinung der Bush-Regierung teilte auch der Leitartikel in der New York Times vom 14. Febraur 2006, der die Überschrift trug: "Der falsche Mann im Irak": "Mr. Jaafari war ein spektakulärer Fehlschlag. ... Er wird es kaum besser machen, wenn er den Job noch einmal bekommt, besonders da er seine Wahl einem politischen Deal mit den Anhängern von Moktada al-Sadr verdankt, einem Mann, dessen eigene bewaffnete Bande erheblich zum Problem beiträgt."
Am 02. April 2006 bezeichnete der Leitartikel der Times Moktada al-Sadr als "radikalen antiamerikanischen Kleriker, der eine mächtige Privatmiliz anführt, die für einen großen Teil des sektiererischen Terrors verantwortlich ist." Ethnische Milizen sind in der Tat überall im Irak, denn das Misstrauen zwischen den Ethnien hat dort tiefe historische Wurzeln, die weit in die Ära Saddam Husseins zurückreichen. Dieses Misstrauen bestand schon, ehe der Große Weiße Bush mit Angst, Schrecken und Demokratie Einzug hielt. Was hatte man also erwartet?
Der Leitartikel der Times vom 14. Februar 2006 erklärte, "Demokratie erfordert es nicht, ihn (Jaafari) als Premierminister zu bestätigen" und so geschah es auf Druck Washingtons auch: der Mann, den der demokratische Prozess nach oben gebracht hatte, wurde gezwungen, seinen Platz zu räumen. Stattdessen wurde sein Sprecher, Jawad al-Maliki, in die erste Reihe geschoben. Malaki ist ein treues Mitglied der irakischen Dawa-Partei - einer politischen Gruppierung der Shia, die jahrelang im Untergrund eine bewaffneten Widerstandsbewegung gegen die baathistische Herrschaft Saddam Husseins angeführt hat." Gibt es angesichts des religiösen und ethnischen Kontexts einen Grund für die Annahme, dass Maliki dort erfolgreich sein würde, wo Jaafari gescheitert war? Die Durchsetzung amerikanischer Interessen wird den bestehenden Konflikt nur verschärfen und das Land weiter in einen Bürgerkrieg hineintreiben.
Es gibt noch die andere Seite der Medaille. Während der Irak sich in einen Berg von Schutt verwandelt hat, haben die Amerikaner für ihren Exportartikel "Abenteuer Demokratie" schwer bezahlt. Zunächst hat die Bush-Regierung wegen der Verbindung mit der Shia die Bedeutung des Iran als geopolitische Kraft verstärkt. Amerika wird die Kooperation des Iran brauchen, wenn es sich je aus seinem irakischen Alptraum zurückziehen will (ein Punkt, der bei Spekulationen über einen US-Angriff auf den Iran berücksichtigt werden sollte). Zweitens hat sich der Ölpreis seit Beginn des Krieges mehr als verdoppelt, von 30 Dollar auf 70 Dollar pro Barrel. Drittens sind mehr als 2.300 amerikanische Soldaten getötet und über 17.000 verwundet worden, was zu einem Absturz von Bushs Popularität beigetragen und eine flügellahme Präsidentschaft nach den Kongresswahlen im November wahrscheinlich gemacht hat. Washingtons Unterstützung für Maliki beruht anscheinend eher auf seinem Wunsch aus dem selbst gebastelten Hexenkessel zu entkommen als auf irgendwelchen neuen Rezepten für die Beilegung von Konfessionskriegen.
Die palästinensische Arena
In der palästinensischen Autonomiebehörde (PA) verlaufen die Trennungslinien nicht entlang religiöser oder ethnischer Grenzen. Gleichwohl haben die Wahlen auch hier niemanden weitergebracht. Die Wahlen waren Ergebnis eines Deals zwischen Abu Mazen, dem Präsidenten der PA, und Hamas; letztere sollte ihren bewaffneten Kampf aussetzen und Abu Mazen im Gegenzug Wahlen durchführen. Hamas sah sowohl den Kommunal- als auch den Nationalwahlen ungeduldig entgegen.
Als erstes errang sie bei den Kommunalwahlen einen Erdrutschsieg. Bestürzt wollte Abu Mazen daraufhin die nationalen Wahlen verschieben. Bush bestand jedoch auf deren Durchführung. Der wegen seiner Irakpolitik heftig unter Kritik stehende amerikanische Präsident wollte zeigen, dass sich die Demokratie im Nahen Osten im Aufschwung befand. Also fanden im Januar Wahlen statt und der Sieg der Hamas überraschte alle, einschließlich ihr selbst.
Die meisten Experten hatten erwartet, dass sich das Abstimmungsmuster von dem der Kommunalwahlen unterscheiden würde. Die Bevölkerung verhielt sich jedoch anders, sie wählte wieder Hamas. Dies tat sie nicht wegen des Extremismus der Bewegung oder wegen deren Weigerung, Israel anzuerkennen und ebenso wenig, weil sie eine Verhandlungslösung ablehnt. Die Leute wollten einfach die Tiefe ihrer Abscheu vor der korrupten PA und Fatah demonstrieren. Die Wahl bot also die Möglichkeit, Israel und Amerika zu bestrafen. "Ihr wollt Demokratie? Die könnt ihr ins Gesicht kriegen!"
Was das Thema "Strafen" angeht, muss man bedenken, dass Amerika und Israel auf diesem Gebiet alte Hasen sind. Jedenfalls auf kurze Sicht. Die Schikanen, denen sie Hamas aussetzen, ohne Skrupel, Palästinenser verhungern zu lassen, sollen sie in eine zweite Fatah verwandeln. Es ist, als würden sie sagen: "Entweder wechselt Ihr Eure Streifen und übernehmt die Politik der Fatah oder Ihr scheidet aus dem Spiel aus. Wir bestimmen nicht nur die Regeln, wir entscheiden auch über das Ergebnis."
Wir haben oft gesagt, dass Hamas niemals die Absicht hatte, das große Los zu ziehen. Durch ihre Ideologie an Verhandlungen mit Israel gehindert, wäre sie lieber einer Regierung unter der Fatah beigetreten. Heute ist sie in einer eigentümlichen Situation gefangen: Die Leute wollen die Reinheit der Hamas ohne deren Politik. Wird Hamas ihre Tagesordnung zugunsten der des Volkes aufgeben? Die letzten Entwicklungen deuten nicht darauf hin. Der demokratische Prozess beinhaltet auch das Risiko zu siegen, und man tut gut daran, sich dies vorher zu überlegen. Auch ein großer Sieg kann sich in eine Niederlage verwandeln, wenn die Sieger ideologisch nicht auf die Führungsrolle vorbereitet sind.
Aber die größte Fehleinschätzung haben Israel und Amerika begangen. Dass Lauterkeit zum Hauptthema des palästinensischen Wahlkampfs wurde, lag nicht nur an der Ekel erregenden Korruption der Fatah, sondern auch am Fehlen politischer Perspektiven. Warum sollte man eine Gruppierung wählen, die Israel anerkennt und bereit ist, mit diesem zu sprechen, wenn doch klar war, dass Anerkennung und Gespräche zu nichts führten: Sie würden den Sperrzaun nicht aufhalten, nicht die Kantonisierung, sie würden Jerusalem nicht öffnen, nicht die Siedlungsblöcke beseitigen, die Gefangenen nicht befreien und die Flüchtlinge nicht zurückbringen, sie würden nicht zu einem echten palästinensischen Staat führen.
Und doch steht allen Palästinensern eine Niederlage bevor. Hamas krümmt sich heute unter internationalem und finanziellem Druck, die vermutlich in einem Bürgerkrieg oder in den Rückzug der Hamas aus der Politik und ihre Rückkehr zu den Waffen münden werden. Beide Möglichkeiten bedeuten eine Katastrophe für das palästinensische Volk.
Israels selbsttrügerische Erwartungen
In Israel, der Wiege der Demokratie im Nahen Osten, haben die Wahlen die Nation in die Lage versetzt, weiter den Kopf in den Sand zu stecken. Die Gründung der Kadima im November 2005, nach Premier Ariel Sharons Trennung vom Likud, sollte die Grundlage für eine neue israelische Mitte schaffen. Im Laufe dessen, was als der "Große Knall" bekannt wurde, spannten alle Kräfte des Zentrums ihren Karren hinter Sharon und überfuhren so die Extremisten von links und rechts. Auch kleinere Parteien schlossen sich an. Letztlich, so hoffte man, würde Israel in der Lage sein, mit der Planierraupe einen Weg zu dem zu ebnen, was sich Sharon als die beiden Hauptziele der Nation vorstellte:
1. die Lösung der sozialen Probleme, indem es in den Augen ausländischer Investoren und Finanzinstitutionen eine glaubhafte wirtschaftliche Position aufrechterhielt; und
2. die Verringerung des Ausmaßes der Besatzung und die unilaterale Festlegung permanenter Grenzen.
Keines dieser Projekte hält einer Realitätsprüfung stand. Solange Israel im Kontext des globalen Kapitalismus verbleibt, kann es nicht die Arbeitsplätze schaffen, die es brauchen würde, um die sozialen Klüfte zu schließen. Was das zweite Ziel betrifft, so werden sich die Palästinenser schlicht nicht ergeben. Dieses Gewebe selbsttrügerischer Erwartungen hing von einem Mann ab, einem alten Mann von kolossalen Ausmaßen, der von den Höhen der Stufen der Knesset jeden Tag mit einem Lächeln für die Kamera herabstieg, als wollte er sagen: "Überraschung, ich bin immer noch da!". Dann, eines Tages, war er es nicht mehr.
Zunächst sah es so aus, als würde Sharons Ausfall die Aussichten seines Nachfolgers, Ehud Olmert, das Projekt fortzusetzen, nicht beeinträchtigen. Olmert gedachte gar, die erwartete Mehrheit als eine Art nationales Referendum für einen unilateralen Rückzug zu benutzen, den er aus Teilen der Westbank durchführen wollte. Doch mit dem Wahltag zogen Besorgnis erregende Zeichen herauf. Am Tag nach der Wahl erwachte Israel mit einer merkwürdigen und diffusen politischen Landkarte. Kadima lag an der Spitze - aber nur mit 29 von 120 Mandaten. Labor war von 22 auf 19 gerutscht. Shinui, bis dahin mit 15 Mandaten drittgrößte Partei, verschwand ganz. Die Öffentlichkeit hatte den Likud abgestraft, er war von 40 auf 12 Sitze abgefallen. Eine neue rechte Partei unter Avigdor Lieberman stieg mit 11 Mandaten auf. Der Mangel an Vertrauen in Olmert oder Amir Peretz, den neuen Chef der Arbeitspartei, fand Ausdruck in einer Protestwahl für die Rentnerpartei, die sieben Mandate erhielt.
Zusammengefasst: demokratische Wahlen können schaden, insbesondere wenn sie wie im Irak unter Bedingungen stattfinden, die nur zu einem Konfessionskrieg führen können, wenn sie keine wesentlichen politischen Aussichten bieten, wie es in den palästinensischen Gebieten der Fall war; oder wenn sie, wie im Falle Israels, eine Nation davon abhalten, der Realität ins Auge zu blicken.
[1] . www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf, S. II
[1] . http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/secstrat.htm
Roni Ben Efrat ist Chefredakteurin der Zeitschrift "Challenge", die im israelischen Jaffa alle zwei Monate herausgegeben wird: http://www.hanitzotz.com/challenge/
Wir danken Endy Hagen für die Übersetzung
[i] www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf, S. II
[ii] http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/secstrat.htm
Roni Ben Efrat ist Chefredakteurin der Zeitschrift "Challenge", die im israelischen Jaffa herausgegeben wird: http://www.hanitzotz.com/challenge/
Übersetzung für die NRhZ Endy Hagen
Online-Flyer Nr. 43 vom 09.05.2006
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE