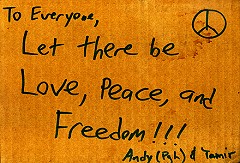SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Kultur und Wissen
Rezension: „Marsch durch die Institutionen“ – Die 68er in der SPD
Von Anfang an misstrauisch beäugt
Von Uli Klinger
Betrachtet wird in dieser Arbeit vor allem die SPD. Mit dem Godesberger Programm hatte sie sich von der Ausrichtung als Arbeiterpartei verabschiedet, im damaligen Regierungssitz Bonn bildete sie zusammen mit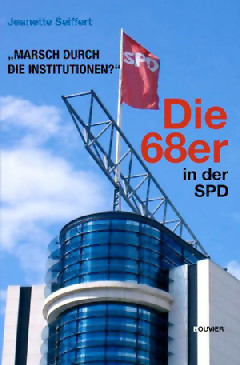 der CDU die erste bundesdeutsche Regierungskoalition (unter Führung von CDU-Kiesinger), mit dem charismatischen Parteivorsitzenden und Außenminister Willy Brandt verkörperte sie einen Aufbruch aus verkrusteten Strukturen.
der CDU die erste bundesdeutsche Regierungskoalition (unter Führung von CDU-Kiesinger), mit dem charismatischen Parteivorsitzenden und Außenminister Willy Brandt verkörperte sie einen Aufbruch aus verkrusteten Strukturen.
In diese Partei trat die große Mehrheit der 68er ein, hier sahen sie die Möglichkeit zur Veränderung, zur Übernahme von politischer Verantwortung. Die Auswirkungen auf die SPD waren dramatisch. 1965 betrug der Anteil der unter 35jährigen Neumitglieder rund 50 %, dieser Anteil steigerte sich 1972 auf fast zwei Drittel. Diese wurden (aktiv) größtenteils in die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten (Jusos) eingegliedert, zu denen altersgemäß jede/r bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres zählte. Selbstbewusst formulierte der Jugendverband der Partei „Wir sind die SPD der neunziger Jahre“.
Dieser Anspruch auf Veränderung, auf eine neue Parteikultur traf bei den Altgenossen nicht nur auf Zustimmung, sondern wurde von Anfang an
Die Autorin Jeanette Seiffert
misstrauisch beäugt und mit restriktiven Mitteln verfolgt. Zwar nahm man die Neueingetretenen gerne als willkommene Helfer zum Plakatieren im Wahlkampf, aber inhaltlich sollten sie nicht stören, den mühsam errungenen Kompromiss nicht gefährden und die eigne Karriere nicht behindern. Hinzu kamen natürlich noch die ganz offensichtlichen Differenzen zwischen dem handeln als Regierungspartei in Verantwortung und dem Veränderungswillen der Mitgliedschaft.
Ergebnis war, dass fast alle Jusos in Leitungsfunktionen mit Parteiordnungsverfahren überzogen wurden, der Höhepunkt war sicherlich im Jahr 1977 der Parteiausschluss des neu gewählten Jusovorsitzenden Klaus-Uwe Benneter. Von dieser Maßnahme erholte sich die Nachwuchsorganisation eigentlich nie wieder, und spätestens mit der Wahl von Gerhard Schröder (1983) als Bundesvorsitzender wurde die Parteijugend als Hort von kritischen Diskussionen und alternativen Politikstilen bedeutungslos. Dies geht allerdings einher mit dem naturgemäßen Altern der ehemaligen politischen Aktivisten und der Verwirklichung von individuellen Karrierezielen in Verbindung mit einer Partei- und Gremienarbeit, die Utopien als nicht ratsam erscheinen lassen und in so genannter „Realpolitik“ enden, mag einem dies gefallen oder nicht.
Das Buch endet mit den Jahren 1989/90. In einem kurzen Anhang sind noch die Lebensläufe der betrachteten Personen bis heute dargestellt.
Inhaltlich gliedert sich die Arbeit in eine Betrachtung der verschiedenen
Anke Brunn – Seiffert
Politikfelder auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene (letzteres meistens am Beispiel Köln). Immer betrachtet wird ein ausgewählter Personenkreis wie z. B. Karsten Voigt, Norbert Gansel, Hertha Däubler-Gmelin und Anke Brunn. Deren Handeln und Agieren werden dargestellt. Dies ist das Besondere dieser wirklich umfassenden Arbeit. Und gleichzeitig das Manko. Denn naturgemäß wechseln bei den Personen die Handlungsebenen, eine längere politische Karriere spielt sich nicht nur an einem Ort ab. Und so sind Wiederholungen fast zwangsläufig. Dies ermüdet beim Lesen, trotz der lebendigen Schreibe von Jeanette Seiffert.
Überraschend positives Resümee
Überrascht hat mich persönlich das positive Resümee der Autorin, dass es der SPD gelungen sei, die 68er in der Partei zu integrieren und sie „zu verantwortlichen Mitgestaltern des politischen Systems der Bundesrepublik“ (… zu machen). Denn das Ziel der 68er war ein anderes: Sie hatten die Machtfrage gestellt, wollten die Institutionen verändern, nicht von Ihnen „gefressen“ werden (Daniel Cohn-Bendit).
Leider fehlt auch die Betrachtung über den eigenen nationalen Tellerrand hinaus. 1967/68 war ja keine deutsche Besonderheit, sondern ein internationales Aufbegehren, ein Einüben in „neue Lebensformen“. Daraus entwickelte sich in vielen westlichen Gesellschaften ein anderes Verständnis von Politik. Dies bleibt bei dieser Arbeit leider außer Betracht.
Wie überhaupt zum Schluss offensichtlich die verbliebene Zeit etwas knapp wurde. So sind die Kapitel „Durchmarsch der Frauen“ und „68er und die neuen Sozialen Bewegungen“ etwas zu kurz geraten, und bei den Biografien endet die von z.B Uli Maurer 1999 mit seinem Rückzug als Landesvorsitzender in Baden-Württemberg – um dann plötzlich am Ende der nächsten Seite in einem anderen Zusammenhang kurz von seinem erfolgreichen Neustart bei der „Linken“ zu lesen. Auch hier fehlen die Erwähnung von der Leidenschaft und der Lust, politisch gestaltend einzugreifen – und die Verzweiflung, wenn man erkennt, dass man die früheren Ziele mit dieser SPD nicht verwirklichen kann.
Trotz dieser „leisen“ Kritik: Das Buch ist äußerst lesenswert und strotzt von Detailwissen, so dass sich die Anschaffung unbedingt lohnt! (PK)
Online-Flyer Nr. 233 vom 20.01.2010
Druckversion
Kultur und Wissen
Rezension: „Marsch durch die Institutionen“ – Die 68er in der SPD
Von Anfang an misstrauisch beäugt
Von Uli Klinger
Betrachtet wird in dieser Arbeit vor allem die SPD. Mit dem Godesberger Programm hatte sie sich von der Ausrichtung als Arbeiterpartei verabschiedet, im damaligen Regierungssitz Bonn bildete sie zusammen mit
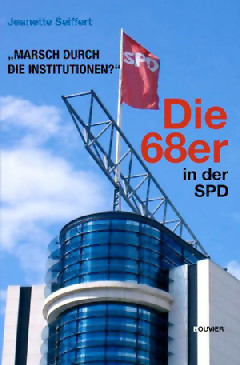 der CDU die erste bundesdeutsche Regierungskoalition (unter Führung von CDU-Kiesinger), mit dem charismatischen Parteivorsitzenden und Außenminister Willy Brandt verkörperte sie einen Aufbruch aus verkrusteten Strukturen.
der CDU die erste bundesdeutsche Regierungskoalition (unter Führung von CDU-Kiesinger), mit dem charismatischen Parteivorsitzenden und Außenminister Willy Brandt verkörperte sie einen Aufbruch aus verkrusteten Strukturen. In diese Partei trat die große Mehrheit der 68er ein, hier sahen sie die Möglichkeit zur Veränderung, zur Übernahme von politischer Verantwortung. Die Auswirkungen auf die SPD waren dramatisch. 1965 betrug der Anteil der unter 35jährigen Neumitglieder rund 50 %, dieser Anteil steigerte sich 1972 auf fast zwei Drittel. Diese wurden (aktiv) größtenteils in die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten (Jusos) eingegliedert, zu denen altersgemäß jede/r bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres zählte. Selbstbewusst formulierte der Jugendverband der Partei „Wir sind die SPD der neunziger Jahre“.
Dieser Anspruch auf Veränderung, auf eine neue Parteikultur traf bei den Altgenossen nicht nur auf Zustimmung, sondern wurde von Anfang an

Die Autorin Jeanette Seiffert
Ergebnis war, dass fast alle Jusos in Leitungsfunktionen mit Parteiordnungsverfahren überzogen wurden, der Höhepunkt war sicherlich im Jahr 1977 der Parteiausschluss des neu gewählten Jusovorsitzenden Klaus-Uwe Benneter. Von dieser Maßnahme erholte sich die Nachwuchsorganisation eigentlich nie wieder, und spätestens mit der Wahl von Gerhard Schröder (1983) als Bundesvorsitzender wurde die Parteijugend als Hort von kritischen Diskussionen und alternativen Politikstilen bedeutungslos. Dies geht allerdings einher mit dem naturgemäßen Altern der ehemaligen politischen Aktivisten und der Verwirklichung von individuellen Karrierezielen in Verbindung mit einer Partei- und Gremienarbeit, die Utopien als nicht ratsam erscheinen lassen und in so genannter „Realpolitik“ enden, mag einem dies gefallen oder nicht.
Das Buch endet mit den Jahren 1989/90. In einem kurzen Anhang sind noch die Lebensläufe der betrachteten Personen bis heute dargestellt.
Inhaltlich gliedert sich die Arbeit in eine Betrachtung der verschiedenen

Anke Brunn – Seiffert
Überraschend positives Resümee
Überrascht hat mich persönlich das positive Resümee der Autorin, dass es der SPD gelungen sei, die 68er in der Partei zu integrieren und sie „zu verantwortlichen Mitgestaltern des politischen Systems der Bundesrepublik“ (… zu machen). Denn das Ziel der 68er war ein anderes: Sie hatten die Machtfrage gestellt, wollten die Institutionen verändern, nicht von Ihnen „gefressen“ werden (Daniel Cohn-Bendit).
Leider fehlt auch die Betrachtung über den eigenen nationalen Tellerrand hinaus. 1967/68 war ja keine deutsche Besonderheit, sondern ein internationales Aufbegehren, ein Einüben in „neue Lebensformen“. Daraus entwickelte sich in vielen westlichen Gesellschaften ein anderes Verständnis von Politik. Dies bleibt bei dieser Arbeit leider außer Betracht.
Wie überhaupt zum Schluss offensichtlich die verbliebene Zeit etwas knapp wurde. So sind die Kapitel „Durchmarsch der Frauen“ und „68er und die neuen Sozialen Bewegungen“ etwas zu kurz geraten, und bei den Biografien endet die von z.B Uli Maurer 1999 mit seinem Rückzug als Landesvorsitzender in Baden-Württemberg – um dann plötzlich am Ende der nächsten Seite in einem anderen Zusammenhang kurz von seinem erfolgreichen Neustart bei der „Linken“ zu lesen. Auch hier fehlen die Erwähnung von der Leidenschaft und der Lust, politisch gestaltend einzugreifen – und die Verzweiflung, wenn man erkennt, dass man die früheren Ziele mit dieser SPD nicht verwirklichen kann.
Trotz dieser „leisen“ Kritik: Das Buch ist äußerst lesenswert und strotzt von Detailwissen, so dass sich die Anschaffung unbedingt lohnt! (PK)
Online-Flyer Nr. 233 vom 20.01.2010
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE