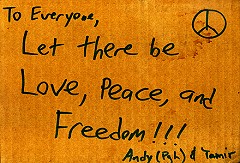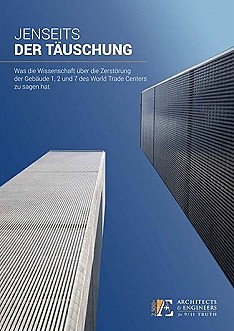SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Arbeit und Soziales
Man hasst ihn, weil er etwas sichtbar macht: Regeln
Der undankbare Job des Fahrkartenkontrolleurs
Von Christopher Dömges
 Es gibt Berufe, die unsere Gesellschaft nur deshalb erträgt, weil sie funktionieren. Nicht, weil man sie schätzt. Nicht, weil man ihren Trägern Respekt entgegenbringt. Sondern weil sie notwendig sind, um ein System am Laufen zu halten, das wir gleichzeitig verachten. Der Fahrkartenkontrolleur ist so ein Beruf. Er steht irgendwo zwischen Ordnungshüter und Projektionsfläche, zwischen menschlicher Schranke und moralischem Ärgernis. Undankbarer kann Arbeit kaum sein.
Es gibt Berufe, die unsere Gesellschaft nur deshalb erträgt, weil sie funktionieren. Nicht, weil man sie schätzt. Nicht, weil man ihren Trägern Respekt entgegenbringt. Sondern weil sie notwendig sind, um ein System am Laufen zu halten, das wir gleichzeitig verachten. Der Fahrkartenkontrolleur ist so ein Beruf. Er steht irgendwo zwischen Ordnungshüter und Projektionsfläche, zwischen menschlicher Schranke und moralischem Ärgernis. Undankbarer kann Arbeit kaum sein.
Der Fahrkartenkontrolleur betritt den Waggon nie als Mensch. Er betritt ihn als Störung. Als Moment, in dem die diffuse Illusion des anonymen Mitfahrens zerbricht. Plötzlich wird aus Bewegung Kontrolle, aus Freiheit ein Abgleich, aus „Ich fahre einfach mit“ die Frage: Darf ich das überhaupt? Das kleine Gerät in seiner Hand ist dabei weniger Werkzeug als Symbol. Es piept nicht, es richtet.
Man hasst ihn nicht, weil er etwas falsch macht. Man hasst ihn, weil er etwas sichtbar macht: Regeln.
Diese Regeln sind bekannt. Sie stehen auf Plakaten, auf Websites, in Apps. Niemand kann ernsthaft behaupten, überrascht zu sein. Und doch ist jede Kontrolle ein emotionales Minenfeld. Der vergessene Fahrschein wird zur existenziellen Ungerechtigkeit, die leere Batterie des Handys zur systemischen Grausamkeit. „Ich fahre doch jeden Tag“, sagt man dann, als sei Gewohnheit eine Währung. Oder: „Das ist doch nur eine Station“, als hätten Regeln eine räumliche Gnadenfrist.
Der Kontrolleur hört diese Sätze tausendfach. Er hört sie in allen Tonlagen: aggressiv, flehend, gönnerhaft. Er hört sie von Menschen, die sonst wahrscheinlich sehr viel Wert auf Ordnung legen – solange sie nicht selbst betroffen sind. Seine Aufgabe ist es, diese Sätze zu ignorieren. Freundlich, aber bestimmt. Menschlich, aber unnachgiebig. Eine Haltung, die von außen leicht gefordert, von innen kaum auszuhalten ist.
Denn der Fahrkartenkontrolleur arbeitet in einem emotionalen Dauerbeschuss. Er wird beschimpft, belächelt, belehrt. Er ist „Abzocker“, „Handlanger“, „Paragraphenreiter“. Dass er weder die Preise macht noch die Regeln schreibt, interessiert niemanden. Er ist die letzte Instanz vor der Strafe, also muss er auch die Schuld tragen. In einer Zeit, in der Verantwortung konsequent nach unten delegiert wird, ist das kein Zufall, sondern System.
Besonders perfide ist dabei die moralische Schieflage, in der dieser Beruf steckt. Der Kontrolleur soll Verständnis zeigen, aber keine Ausnahmen machen. Er soll deeskalieren, aber durchsetzen. Er soll lächeln, während man ihn anbrüllt. Und er soll bitte niemals vergessen, dass er „auch nur Dienstleister“ ist – ein Wort, das in diesem Kontext weniger Service als Unterordnung meint.
Gleichzeitig verlangt man von ihm Zivilcourage. Er soll einschreiten, wenn es brenzlig wird. Er soll Präsenz zeigen, wenn jemand randaliert. Er soll Situationen kontrollieren, in denen andere wegschauen. Doch wehe, er tut das zu sichtbar. Dann ist er plötzlich zu hart, zu streng, zu autoritär. Der Grat, auf dem er balanciert, ist schmal und schlecht beleuchtet.
Was diesen Job so unerquicklich macht, ist nicht die Kontrolle an sich. Es ist die gesellschaftliche Verlogenheit, die sie umgibt. Wir wollen öffentliche Verkehrsmittel, aber wir wollen nicht für sie bezahlen. Wir wollen Sicherheit, aber keine Autorität. Wir wollen Regeln, aber bitte nur für die anderen. Der Fahrkartenkontrolleur ist der lebende Widerspruch dieser Wünsche.
Er sieht mehr Realität als viele andere. Er sieht Armut, die sich schämt. Wohlstand, der sich empört. Jugendliche, die testen, wie weit sie gehen können. Erwachsene, die plötzlich sehr klein werden. Er sieht Menschen an guten und an schlechten Tagen. Und er muss sie alle gleich behandeln, obwohl sie es nicht sind.
Am Ende seines Arbeitstages steigt er aus dem Zug wie jemand, der einen unsichtbaren Kampf geführt hat. Es gibt keinen Applaus, kein Dankeschön, selten ein freundliches Wort. Wenn alles gut läuft, hat ihn niemand bemerkt. Wenn etwas schiefgeht, erinnert man sich sehr genau an sein Gesicht.
Vielleicht ist das das Bitterste an diesem Beruf: Er funktioniert am besten, wenn er unsichtbar bleibt. Doch unsichtbar sein heißt auch, nicht gesehen zu werden. Nicht als Mensch, nicht als Arbeiter, nicht als Teil eines Systems, das wir alle nutzen – und für dessen Unbequemlichkeiten wir erstaunlich wenig Verantwortung übernehmen wollen.
Der Fahrkartenkontrolleur ist kein Feind. Er ist ein Spiegel. Und wie so oft mögen wir nicht, was wir darin sehen.
Es gibt Regeln; soviel ist klar. Im echten Sozialismus hingegen wird zumindest die Fahrkartenkontrolle wegfallen. Denn öffentlicher Verkehr ist absolut kostenlos. Fortbewegung wird als staatlich reguliertes Grundrecht betrachtet. Das gibt es schon heute teilweise in kapitalistischen Staaten – Luxemburg und Malta. Recht auf freies Vorankommen macht Fahrkartenkontrollen überflüssig!
Online-Flyer Nr. 858 vom 14.02.2026
Druckversion
Arbeit und Soziales
Man hasst ihn, weil er etwas sichtbar macht: Regeln
Der undankbare Job des Fahrkartenkontrolleurs
Von Christopher Dömges
 Es gibt Berufe, die unsere Gesellschaft nur deshalb erträgt, weil sie funktionieren. Nicht, weil man sie schätzt. Nicht, weil man ihren Trägern Respekt entgegenbringt. Sondern weil sie notwendig sind, um ein System am Laufen zu halten, das wir gleichzeitig verachten. Der Fahrkartenkontrolleur ist so ein Beruf. Er steht irgendwo zwischen Ordnungshüter und Projektionsfläche, zwischen menschlicher Schranke und moralischem Ärgernis. Undankbarer kann Arbeit kaum sein.
Es gibt Berufe, die unsere Gesellschaft nur deshalb erträgt, weil sie funktionieren. Nicht, weil man sie schätzt. Nicht, weil man ihren Trägern Respekt entgegenbringt. Sondern weil sie notwendig sind, um ein System am Laufen zu halten, das wir gleichzeitig verachten. Der Fahrkartenkontrolleur ist so ein Beruf. Er steht irgendwo zwischen Ordnungshüter und Projektionsfläche, zwischen menschlicher Schranke und moralischem Ärgernis. Undankbarer kann Arbeit kaum sein.Der Fahrkartenkontrolleur betritt den Waggon nie als Mensch. Er betritt ihn als Störung. Als Moment, in dem die diffuse Illusion des anonymen Mitfahrens zerbricht. Plötzlich wird aus Bewegung Kontrolle, aus Freiheit ein Abgleich, aus „Ich fahre einfach mit“ die Frage: Darf ich das überhaupt? Das kleine Gerät in seiner Hand ist dabei weniger Werkzeug als Symbol. Es piept nicht, es richtet.
Man hasst ihn nicht, weil er etwas falsch macht. Man hasst ihn, weil er etwas sichtbar macht: Regeln.
Diese Regeln sind bekannt. Sie stehen auf Plakaten, auf Websites, in Apps. Niemand kann ernsthaft behaupten, überrascht zu sein. Und doch ist jede Kontrolle ein emotionales Minenfeld. Der vergessene Fahrschein wird zur existenziellen Ungerechtigkeit, die leere Batterie des Handys zur systemischen Grausamkeit. „Ich fahre doch jeden Tag“, sagt man dann, als sei Gewohnheit eine Währung. Oder: „Das ist doch nur eine Station“, als hätten Regeln eine räumliche Gnadenfrist.
Der Kontrolleur hört diese Sätze tausendfach. Er hört sie in allen Tonlagen: aggressiv, flehend, gönnerhaft. Er hört sie von Menschen, die sonst wahrscheinlich sehr viel Wert auf Ordnung legen – solange sie nicht selbst betroffen sind. Seine Aufgabe ist es, diese Sätze zu ignorieren. Freundlich, aber bestimmt. Menschlich, aber unnachgiebig. Eine Haltung, die von außen leicht gefordert, von innen kaum auszuhalten ist.
Denn der Fahrkartenkontrolleur arbeitet in einem emotionalen Dauerbeschuss. Er wird beschimpft, belächelt, belehrt. Er ist „Abzocker“, „Handlanger“, „Paragraphenreiter“. Dass er weder die Preise macht noch die Regeln schreibt, interessiert niemanden. Er ist die letzte Instanz vor der Strafe, also muss er auch die Schuld tragen. In einer Zeit, in der Verantwortung konsequent nach unten delegiert wird, ist das kein Zufall, sondern System.
Besonders perfide ist dabei die moralische Schieflage, in der dieser Beruf steckt. Der Kontrolleur soll Verständnis zeigen, aber keine Ausnahmen machen. Er soll deeskalieren, aber durchsetzen. Er soll lächeln, während man ihn anbrüllt. Und er soll bitte niemals vergessen, dass er „auch nur Dienstleister“ ist – ein Wort, das in diesem Kontext weniger Service als Unterordnung meint.
Gleichzeitig verlangt man von ihm Zivilcourage. Er soll einschreiten, wenn es brenzlig wird. Er soll Präsenz zeigen, wenn jemand randaliert. Er soll Situationen kontrollieren, in denen andere wegschauen. Doch wehe, er tut das zu sichtbar. Dann ist er plötzlich zu hart, zu streng, zu autoritär. Der Grat, auf dem er balanciert, ist schmal und schlecht beleuchtet.
Was diesen Job so unerquicklich macht, ist nicht die Kontrolle an sich. Es ist die gesellschaftliche Verlogenheit, die sie umgibt. Wir wollen öffentliche Verkehrsmittel, aber wir wollen nicht für sie bezahlen. Wir wollen Sicherheit, aber keine Autorität. Wir wollen Regeln, aber bitte nur für die anderen. Der Fahrkartenkontrolleur ist der lebende Widerspruch dieser Wünsche.
Er sieht mehr Realität als viele andere. Er sieht Armut, die sich schämt. Wohlstand, der sich empört. Jugendliche, die testen, wie weit sie gehen können. Erwachsene, die plötzlich sehr klein werden. Er sieht Menschen an guten und an schlechten Tagen. Und er muss sie alle gleich behandeln, obwohl sie es nicht sind.
Am Ende seines Arbeitstages steigt er aus dem Zug wie jemand, der einen unsichtbaren Kampf geführt hat. Es gibt keinen Applaus, kein Dankeschön, selten ein freundliches Wort. Wenn alles gut läuft, hat ihn niemand bemerkt. Wenn etwas schiefgeht, erinnert man sich sehr genau an sein Gesicht.
Vielleicht ist das das Bitterste an diesem Beruf: Er funktioniert am besten, wenn er unsichtbar bleibt. Doch unsichtbar sein heißt auch, nicht gesehen zu werden. Nicht als Mensch, nicht als Arbeiter, nicht als Teil eines Systems, das wir alle nutzen – und für dessen Unbequemlichkeiten wir erstaunlich wenig Verantwortung übernehmen wollen.
Der Fahrkartenkontrolleur ist kein Feind. Er ist ein Spiegel. Und wie so oft mögen wir nicht, was wir darin sehen.
Es gibt Regeln; soviel ist klar. Im echten Sozialismus hingegen wird zumindest die Fahrkartenkontrolle wegfallen. Denn öffentlicher Verkehr ist absolut kostenlos. Fortbewegung wird als staatlich reguliertes Grundrecht betrachtet. Das gibt es schon heute teilweise in kapitalistischen Staaten – Luxemburg und Malta. Recht auf freies Vorankommen macht Fahrkartenkontrollen überflüssig!
Online-Flyer Nr. 858 vom 14.02.2026
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE