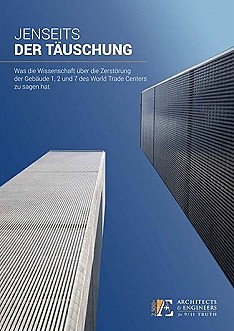SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Literatur
Auszug aus dem Demokratischen Heimatroman "Über Leben"
1923: Kämpfe und Niederlagen der Arbeiterbewegung im Südwesten
Von Wilma Ruth Albrecht
 9. An einem warmen Juliabend neunzehnhundertdreiundzwanzig kehrte Frieda müde nach Hause in ihre kleine, dunkle Wohnung, die in einem Laubengaleriehinterhaus der Mannheimer Innenstadt, genauer im Quadrat H 7 lag und die sie nach Georgs Entlassung aus der BASF vor einem halben Jahr beziehen konnte, weil ihr Mann in einer Drahtseilfabrik Arbeit fand. Die Wohnung bestand nur aus zwei Zimmern ohne eigene Toilette und einem Wasserbecken für drei Arbeiterfamilien am Ende der Galerie, dafür war sie billig. Die ungenügenden sanitären Einrichtungen waren nun auch wiederum nicht so schlimm, denn auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich das öffentliche Volksbad, in dem man am Samstag Nachmittag zu bezahlbaren Preisen ein Wannenbad nehmen oder sich duschen konnte. Wenn man von den trüben Arbeitervierteln in den unteren Quadranten absah, dann hatte Mannheim durchaus seine Reize: da gab es Lichtspielhäuser, den Luisen- und Schlosspark, die Friedrichsanlage, elegante Kaufhäuser und viele Gaststätten, auch wurden immer Dienstmädchen oder Haushaltshilfen gesucht, denn hier wohnten mehr städtische und Landesbeamte als in der hässlicheren Schwesterstadt westlich des Rheins.
9. An einem warmen Juliabend neunzehnhundertdreiundzwanzig kehrte Frieda müde nach Hause in ihre kleine, dunkle Wohnung, die in einem Laubengaleriehinterhaus der Mannheimer Innenstadt, genauer im Quadrat H 7 lag und die sie nach Georgs Entlassung aus der BASF vor einem halben Jahr beziehen konnte, weil ihr Mann in einer Drahtseilfabrik Arbeit fand. Die Wohnung bestand nur aus zwei Zimmern ohne eigene Toilette und einem Wasserbecken für drei Arbeiterfamilien am Ende der Galerie, dafür war sie billig. Die ungenügenden sanitären Einrichtungen waren nun auch wiederum nicht so schlimm, denn auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich das öffentliche Volksbad, in dem man am Samstag Nachmittag zu bezahlbaren Preisen ein Wannenbad nehmen oder sich duschen konnte. Wenn man von den trüben Arbeitervierteln in den unteren Quadranten absah, dann hatte Mannheim durchaus seine Reize: da gab es Lichtspielhäuser, den Luisen- und Schlosspark, die Friedrichsanlage, elegante Kaufhäuser und viele Gaststätten, auch wurden immer Dienstmädchen oder Haushaltshilfen gesucht, denn hier wohnten mehr städtische und Landesbeamte als in der hässlicheren Schwesterstadt westlich des Rheins.
Als sie in die Wohnstube trat, fand sie auf dem mit Wachstuch belegten weißen Küchentisch einen Zettel, auf dem ihr Mann Georg ihr mitteilte, dass er zur Parteiversammlung ins gegenüberliegende kleine Lichtspielhaus gegangen sei. Es könne spät werden, denn es gelte die große stadtweite Demonstration gegen die Cunoregierung vorzubreiten. Sie könne, wenn sie nicht zu müde sei, nachkommen. Doch sie war zu müde, denn heute war der große Fensterputz im Arzthaushalt angesagt und wer schon einmal dreizehn zwei Meter hohe Doppelfenster geputzt hat, kann dies nachempfinden.
Das kleine Lichtspielhaus, in dem sonst zwei Mal die Woche Stummfilme vorgeführt wurden, war gerammelt voll. Man sah viele Arbeiter mit Schirmmützen und um die Beine schlotternde Hosen, kleine Angestellte mit kurzem Haupthaar und ausrasiertem Nacken, dazwischen einige jüngere und ältere Frauen. Der Saal war voll beleuchtet und dennoch schummrig wegen der Rauchschwaden, die die Zigaretten- und Stumpenraucher in die Luft bliesen.
Vor der mit Ölfarbe weiß gestrichenen Kopfwand des Saales, die die Leinwand für die Filmvorführung abgab, war wie immer ein Tisch mit drei Stühlen für die Versammlungsleitung bestehend aus dem jungen Mühlenarbeiter August, dem Obmann des Vertrauenskörpers dem Metaller Friedrich und dem altbekannten kommunistischen Parteisekretär Franz aufgebaut.
Letzterer erhob sich und begrüßte die Anwesenden mit „Genossen und Genossinnen“, worauf es sogleich im Saal still wurde. „Die Partei hat für den kommenden Samstag landesweit zu Massendemonstrationen aufgerufen zum Sturz der Cunoregierung, der offenen und brutalen Interessenvertretung der aggressiven Monopolbourgeoisie, der Bergbau- und Stahlbarone, die die Arbeiterklasse versklaven will und das Kleinbürgertum inflationär enteignet hat.
Schauen wir uns diese Blutsauger des Volkes einmal an: Da haben wir einmal als Reichskanzler einen Wilhelm Cuno, vormals Direktor der Hamburg-Amerika-Linie, einen Wirtschaftsminister Wilhelm Becker, ehemaliges Vorstandsmitglied der Rheinischen Stahlwerke Otto Wolff, dann als Regierungsberater Stinnes und Helffrich selbst. Ihr Ziel ist es eine faschistische Diktatur zu errichten. Schon neunzehnhundertzweiundzwanzig plante Stinnes, den durch die Revolution erkämpfen Achtstundentag zurückzunehmen und den Zehnstundentag einzuführen, Streiks und Gewerkschaftsarbeit zu verbieten und strafrechtlich zu verfolgen und die Höchstpreisverordnungen aufzuheben, um nur einige Punkte zu nennen. Dies wird jetzt schrittweise umgesetzt.
Mit der durch die deutsche Monopolbourgeoisie provozierten Besetzung des Ruhrgebietes wird der Konkurrenzkampf zwischen den deutschen und französischen Stahlkonzernen darüber hinaus auf dem Rücken der Arbeiterklasse und des Mittelstandes ausgefochten. Es ging von Anfang an nur darum, wer in dem geplanten lothringisch-rheinischen Montantrust die Mehrheit besitzen soll. Poincaré, der Handlanger von Eugène Schneider, Francois de Wendel, hat doch schon letzten Herbst gedroht, sich im Ruhrgebiet produktive Pfänder zu nehmen, wenn Stinnes, Krupp und Thyssen nicht einer Aktienkapitalverteilung von sechzig zu vierzig zustimmen und die Reparationslieferungen weiter verzögern. Die Cunoregierung hat sich ganz in den Dienst der Stinnes, Krupp, Thyssen und Co. gestellt. Ein sofortiger Generalstreik beim Einmarsch der Franzosen am elften Januar dreiundzwanzig ins Ruhrgebiet hätte Wirkung gezeigt, aber doch nicht ein passiver Widerstand. Wie sieht der denn aus, dieser passive Widerstand? Unser Genosse Stankowski von der Zeche Zollverein aus Essen wird ihn euch schildern!“
Er zeigte auf einem breiten, untersetzten jungen Mann, der sich nun erhob, an das Podium trat und in den Saal sprach: „Genossen, der angebliche passive Widerstand ist ein reines Schmierentheater. Ein paar deutsche Beamte verweigern die Durchführung der Anordnungen der Franzosen und werden einfach durch französische ersetzt. Die Zechenbesitzer halten die Produktion aufrecht und kassieren zusätzlich noch Entschädigungsgelder. Das sieht dann so aus. Die Kumpels fördern tagtäglich Kohlen, die dann auf Halden aufgehäuft werden. Dann kommt französisches Militär, Arbeiter und Grubenbeamte werden aufgefordert empört die Zeche zu verlassen, die Franzosen bleiben allein und räumen mit Hilfe der mitgebrachten fremden Arbeiter die Halden ab, verfrachten sie auf die deutschen Eisenbahnen, auf denen französische Lokführer sitzen, weil ja die deutschen passiven Widerstand geleistet haben, und transportieren sie weg. Dann kommen die Kumpel wieder und fördern... So geht das Spielchen weiter! Der Cuno lässt die Zechenbesitzer seelenruhig gewähren, denn er gehört ja selbst zu der Brut!“
„Saboteure!“ „Landesverräter!“ „Ausbeuter!“ drang es vielstimmig durch den Saal. Während der Kumpel sich setzte, bat der Sitzungsleiter um Ruhe, damit er weiter sprechen könne: „Genossen, es sind hauptsächlich unsere deutschen Finanz- und Industriehaie, die über das Volk herfallen. Ihr wisst es selbst aus euren Betrieben: Es wird ziemlich viel produziert. Die Waren, die zu lächerlich geringen Kosten für das Kapital hergestellt werden, gehen zu Schleuderpreisen ins Ausland und sichern satte Profite. Mit dem Geld, das man uns gibt, kann man sich fast nichts kaufen. Da stehen Millionen, Milliarden und neuerdings sogar Billionen auf einem Geldschein, doch ein Brot bekommt man dafür nicht. Ein Wochenlohn eines Betriebsschlossers bei Lanz reicht gerade für einen Zentner Kartoffel, zehn Arbeitsstunden sind nötig für ein Pfund Margarine.“
„Wenn es überhaupt Kartoffel und Margarine zu kaufen gibt“, schrie jemand aus dem Saal dazwischen. „Ganz recht, so ist es“, fuhr der Redner fort. „Die Verelendung der Arbeiterklasse, der kleinen Angestellten, der werktätigen Intelligenz, der Rentner und Invaliden nimmt immer größere Ausmaße an. Der Mittelstand verarmt, während die Großkapitalisten und Großgrundbesitzer Nutznießer des Kreislaufes Krieg – Krise – Inflation sind. Was hier und heute läuft, ist eine der größten Räubereien der Weltgeschichte!“ „Genauso ist es“, grummelte es vielstimmig im Saal. „Dazu kommt noch, dass überall Faschisten aus ihren dunklen, stinkigen Löchern hervorkriechen, seien es die deutschen „Vaterländischen Verbände“ der Ludendorffs und Co., die mit der reaktionären Reichswehr zusammenarbeiten, oder die mit französischen Geldern ausgehaltenen Separatisten.“
„Vor drei Tagen wurden wieder zwei Gewerkschafter auf offener Straße, auf der Neckarbrück´ brutal zusammengeschlagen – und die Polizei steht daneben und schaut zu“, schrie empört ein Versammlungsteilnehmer in den Saal.
„Deshalb Arbeiter und Genossen wisst“, hob der Redner mit emphatischer Stimme an, „nur wenn wir überall im ganzen Reich als selbständige Kraft aufmarschieren, als Klasse, die um ihre Rechte und für die sofortige Bildung einer Arbeiterregierung kämpft, werden wir im Stande sein, das jetzige Elend zu beenden. Die Losung lautet:
Schlagen wir Cuno und Poincaré
an der Ruhr und an der Spree,
auch am Neckar und am Rhein,
Mannheims Arbeiter werden Helfer sein!
„Bravo!“, „Hoch!“ “Gemeinsam sind wir stark!“ riefen die Anwesenden laut durcheinander. „Halt, Genossen, noch einen Augenblick Ruhe“, ließ sich trompetend August vom Podium vernehmen. „Bevor wir auseinander gehen, müssen wir noch das Organisatorische regeln. Also seid vernünftig, Leute. Die Demonstration hat die Partei schon angemeldet, jetzt muss noch massenhaft mobilisiert und organisiert werden, damit keine Provokateure stören können.“
„Wenn ich auf so einen treff´, dem hau´ ich gleich eine über die Rüb´“, plärrte ein breitschultriger Hafenarbeiter in den Saal.
„Das gerade nicht, Genosse“, beruhigte ihn August, „keine Schlägereien, dass das klar ist. Damit es nicht dazu kommt, brauchen wir Ordner. Es sollen sich jetzt alle die in die linke Ecke kommen, die schon einmal einen Streik organisiert haben oder als Ordner aufgetreten sind. Dann müssen die Flugblätter in der Stadt und im Hafenviertel verteilt werden. Die Helfer kommen auf die rechte Seite.“ „Und die Betriebe?“, fragte jemand. „Das wird zentral übernommen“, erklärte August.
So ging es noch eine halbe Stunde hin und her, bis um dreiundzwanzig Uhr die Versammlung aufgelöst wurde. Georg kam kurz vor Mitternacht mit zwei Packen Flugblätter an und erklärte Frieda, die schon lange im Bett lag, dass sie am Samstag auf dem Wochenmarkt einen Packen Flugblätter verteilen soll, während er selbst im Jungbusch von Tür zu Tür gehen wollte.
*
Als Georg eine Viertelstunde zuvor in den Hinterhof eingetreten war, sah er in der Waschküche noch Licht. Diesen erbärmlich muffigen und schimmeligen Raum, der immer klamm blieb, bewohnte seit ein paar Monaten der Kriegsinvalide Josef Mosbach. Sein rechtes Bein war bis zum Beckenansatz, sein linkes bis zum Knie amputiert und seine Invalidenrente so gering, dass er sich mit einem Rollwägelchen tagsüber bettelnd auf den Straßen bewegen musste. Als überzeugter Nationalist und Kriegsfreiwilliger wollte er als Feldjäger eine berufliche Zukunft in der kaiserlichen Armee finden. Doch diese Zukunftsvision zerstob mit der Gewehrsalve, die seine Beine zerschmetterte. Dennoch glaubte er fest daran, dass der Krieg hätte gewonnen werden können, wenn nicht die Sozialisten den Truppen einen Dolchstoß verpasst hätten. Dann wäre es auch nicht zum Versailler Schandvertrag gekommen, der das deutsche Heer auf nur hunderttausend Mann begrenzte, und er wie auch andere Kriegsinvaliden hätten in ihm auch noch Verwendung finden können. So aber war es von militärischem Standpunkt völlig einsichtig, dass dieses Hunderttausend-Mann- Heer sich natürlich nicht auch noch mit Krüppel belasten konnte, sollte es demnächst wieder zu Kämpfen mit dem Erzfeind kommen.
Als er nun auf dem Tisch hinter dem Fenster sitzend Georg mit zwei Packen Papier unter dem Arm ankommen sah, kroch in ihm Wut hoch. ´Auch so ein Linker, der die Heimat in Chaos und Anarchie durch ständige Streiks, Kundgebungen und Demonstrationen stürzt. Diese Subjekte haben auch noch zwei gesunde Beine, eine feste Arbeit und dazu noch ein strammes Weibsbild, das ihnen nachts das Bett wärmt. Wahrscheinlich liegt seine Frieda schon mit breiten Beinen bereit. Man müsste doch mindestens einen dieser Vaterlandsverräter zu packen bekommen!`
Am Montag, dem Tag des politischen Massenstreiks mit Großdemonstration, schob er sich auf seinem Wägelchen mühsam über den Ring und durch die Beilstraße in die Hafengegend. Sein Ziel war die Drahtzieherei, in der Georg Ossmann arbeitete. Vor dem Eingangstor hielt er und stellte ein Pappschild auf, auf dem stand:
„Achtung! Auch diesen Betrieb ruinieren russisch gelenkte Kommunisten, während nationale Deutsche arbeitslos auf der Straße sitzen.“
Als der Pförtner den Mann auf die andere Straßenseite schieben wollte, kam es zu einem Geschrei: „Lassen sie den Mann doch, der hat gar nicht so unrecht“, meinte eine verhärmt aussehende Beamtenwitwe mittleren Alters mit schief abgelaufenen Sohlen an den Schuhen. „Mein Paulchen hat Abitur und findet nirgends eine Anstellung.“ „Und die in dem Betrieb haben schon wieder am Mittag die Arbeit hingeschmissen, um zu demonstrieren“, keifte eine rundliche Dirne.
Tatsächlich zogen am frühen Nachmittag streikende Arbeiter, kleine Angestellte und selbst Dienstmädchen und –boten in drei langen Zügen über die Blanken, die Breite Straße und die Akademiestraße zum Paradeplatz, um lauthals ihre Forderungen kund zu tun:
Rücktritt Cunos und Auflösung des Reichstages, Bildung einer Arbeiter- und Bauernregierung; Beschlagnahme der Lebensmittel und Sicherung der Ernährung; Anerkennung der proletarischen Kontrollausschüsse; Aufhebung des Verbots proletarischer Hundertschaften; Festsetzung eines Minimallohnes von 60 Friedenspfennigen; Wiedereinsetzung aller Arbeitslosen und Beschäftigung von Kriegsrentnern; Aufhebung des Demonstrationsverbotes und des Ausnahmezustandes; Freilassung aller politischen Gefangenen.
Das waren nicht nur Kommunisten, Freie Gewerkschafter sondern es fanden sich auch Sozialdemokraten und christliche Gewerkschafter ein, unter ihnen auch Georg Ossmann und seine gewerkschaftlich organisierten Arbeitskollegen.
Obwohl solche Streiks für die Drahtzieherei nichts Neues waren, hatte dieser jedoch für Georg ein Nachspiel, weniger wegen der Streikbeteiligung selbst als vielmehr wegen der Presseveröffentlichung in der örtlichen Zeitung, die halbseitig ein Foto mit dem Kriegsinvaliden auf seinem Wägelchen und seinem Pappschild, dessen Aufschrift deutlich erkennbar nachgezogen worden war, vor der Drahtfabrik abgebildet brachte mit der Balkenüberschrift „Deutschland - ganz unten!“
Georg und ein weiterer Genosse wurden wegen Störung des Betriebsfriedens, Aufhetzung zur Arbeitsverweigerung und Schädigung des Betriebsansehens fristlos entlassen. Neueinstellungen, vor, allem die eines Kriegskrüppels, erfolgten nicht.
Dass der folgenden einjährigen Arbeitslosigkeit Georgs die Denunziation seines Nachbarn zugrunde lag, erfuhr er erst viele Jahre später.
Die erhoffte Wirkung trat aber ein: Georg zog sich nach dem Verbot der KDP am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertdreiundzwanzig, der Inhaftierung von Franz und August erst einmal ins Privatleben zurück.
10. „So geht das einfach nicht mehr weiter“, schimpfte der Ochsenwirt unter beifälligem Nicken der sechs gestandenen Männer mittleren Alters, die den kleinen SPD-Ortsverband des Dorfes bildeten und sich Mitte Oktober neunzehnhundertdreiundzwanzig in Schorschs schwach beleuchtetes Hinterzimmer versammelt hatten. „Überall ist Chaos, das Geld ist nichts mehr wert, die Menschen hungern, wir sitzen auf unserem Wein und Obst, die Eisenbahn fährt schon seit Monaten nur sporadisch, uns plündern die Franzosen die Wälder, in München ist Diktatur, überall Aufmärsche, Streiks, Überfälle und was weiß ich sonst noch. Alles läuft, wenn es so weiter geht, wieder auf einen Krieg hinaus. Das ist wohl das letzte, was wir brauchen.“ „Ist ja schon gut“, warf der stämmige Holzarbeiter ein, „oder siehst du einen Ausweg?“ „Ich weiß auch nicht so richtig,“, meinte der Ochsenwirt, um dann zögernd fort zu fahren: „Aber wenn es nicht anders geht und die Situation sich in unserem Landstrich nicht anders verbessern kann, dann sollten wir vielleicht doch dem Drängen des Generals de Metz nachgeben und uns autonom erklären.“ „Bist du von allen Socken, Ochsenwirt? Ist dir vielleicht dein Name ins Hirn gestiegen?“ schimpfte Eugen, „Jetzt, wo wir in Berlin wieder in der Regierung sind! Sollen wir vielleicht unseren Genossen in den Rücken fallen? Das kommt gar nicht in Frage.“ „Hör´ auf ´rumzumaulen, Eugen“, erwiderte der Geschmähte sachlich. „Ich hab´ neulich zufällig unseren Abgeordneten, den Hoffmann Johannes, in Bergzabern getroffen und der war auch der Meinung, bevor die rechten Bauernbündler die pfälzische Autonomie ausrufen, sollten wir Sozialdemokraten die Sache lieber in die Hand nehmen. Ein erster Schritt müsste natürlich so eine Art Währungsunion sein. Wenn wir den Franc anstelle uns´rer Mark als Zahlungsmittel hätten, könnten wir wenigstens unseren Wein gut verkaufen. Dieser ganze Quatsch mit dem passiven Widerstand hat doch überhaupt nichts gebracht außer Not und Unruhen. Unser Gebiet war doch schon vorher von den Franzosen besetzt.“
Keine vierzehn Tage später kursierten anonyme Flugblätter im Land:
„Wieder einmal hat sich die Sozialdemokratie als Vaterlandsverräter entlarvt. Am 23. Oktober wollten drei Sozis: der Abgeordnete Johann Hoffmann, der 2. Bürgermeister von Ludwigshafen Paul Kleefoot und der bekannte Rechtsverdreher Dr. Wilhelm Wagner unsere schöne Pfalz an die Franzmänner verscherbeln.
Sie teilten in Speyer dem Besatzungsgeneral de Metz mit, dass sie einen selbständigen Staat Pfalz bilden wollten und sich für eine provisorische Regierung zur Verfügung stellten. Den verantwortungsbewussten , nationalen bürgerlichen Parteien ist es zu verdanken, dass dieser zweite Dolchstoß abgewehrt wurde. Durch Vertagung der Abstimmung über den Antrag der drei Separatisten auf der Kreistagssitzung am 24. Oktober in Speyer konnten die nationalen Reihen geschlossen werden. Aber erst durch die Androhung des Parteiausschlusses durch den SPD-Vorsitzenden Wels, der extra aus Berlin anreisen musste, und die Überzeugungskraft des Staatssekretärs Profit aus Heidelberg konnten die drei Verräter wieder auf Linie gebracht werden. Einstimmig nahm dann am 26. Oktober die Kreistagssitzung die Resolution an, dass die Pfalz fest zu Bayern und dem Reich steht. Es lebe Deutschland! Bayern und Pfalz, Gott erhalt´s!“
Beim Frühschoppen nach dem sonntäglichen Kirchgang zeigte der zerknirschte Ochsenwirt das Flugblatt seinen Genossen. „Sich der Parteidisziplin unterordnen und vor den Parteibonzen zu kuschen, muss nicht unbedingt auch politisch klug sein“, knurrte der faltige Waldarbeiter.
Er sollte Recht behalten, denn keinen Monat später hatten die Bauernbündler die Macht in der Pfalz ergriffen und den Führer der „Freien Bauernschaft“ Franz Josef Heinz am zwölften November zum Präsidenten der Republik Pfalz ausgerufen und in Speyer unter dem Schutz de Metz eine Regierung gebildet. Doch seine Herrschaft war nicht von langer Dauer. Aus München kam der Mordbefehl, bis zum zehnten Januar sollten alle Mitglieder der separatistischen Regierung beseitigt werden. Am neunten Januar wurde das Vorhaben bezeichnender Weise im Wittelsbacher Hof in Speyer dann auch prompt durchgeführt.
Doch damit sollte noch lange keine Ruhe im Land einkehren. Bis ins Frühjahr neunzehnhundertvierundzwanzig hinein zogen sich Aufstände, Streiks und Boykotts. Erst danach schienen leichtere Tage anzubrechen.
11. Frieda saß am Küchentisch, der mit einem bunten Wachstuch bedeckt war. Darauf lagen ein Lineal, ein Radiergummi, ein Bleistift sowie ein Tintenfässchen mit königsblauer Tinte, ein Federhalter und mehrere Federn. In ihren Händen hielt sie ein mit krakeligen Zeichen beschriftetes Blatt Papier, das auf der Rückseite mit einer Nähmaschinenwerbung bedruckt war, und las sich die von einer guten Bekannten korrigierte Vorfassung des Briefes an den Vater noch einmal durch. Sie wusste, ein von Rechtschreibfehlern wimmelnder Brief an den Vater würde einen schlechten Eindruck machen und ihr Anliegen, Unterstützung von ihm zu erhalten, nicht fördern.
Dann nahm sie das Lineal und den Bleistift in die Hand, legte das Lineal auf den weißen, unbeschriebenen Briefbogen und zog mit dem Bleistift vorsichtig nur schwer erkennbare Linien. Sie suchte sich eine Schreibfeder aus, steckte sie in den Federhalter und öffnete das kleine Tintenfässchen, tunkte die Feder hinein, ließ etwas Tinte abtropfen und erprobte an einer Ecke der Vorfassung des Briefes ihr Schriftbild. Als sie damit zufrieden schien, nahm sie sich das leere Blatt vor und schrieb mit verkrampften Fingern, die des Schreibens längerer Texte entwöhnt waren:
Schorsch ließ sich jedoch in keine Diskussion ein. Am Nachmittag forderte er Johanna auf, einen runden Weidenkorb aus der Scheune zu holen und ihn in seine Werkstatt zu bringen. Auf die Frage, was er vorhabe, antwortete er: „Ich will die Frederike mit einem Fresskorb überraschen. Geh´ hoch in den Speicher. Hol´ einen Spankorb voll Äpfel und Birnen, nimm auch vom Dörrfleisch und ein paar getrocknete Würste mit.“
Zuerst polsterte er den Weidenkorb mit getrocknetem Stroh aus, füllte im Vorratskeller ein Säckchen Kartoffel und Karotten und legte es in den Korb, umwickelte die von Johanna gebrachten Fleischwaren in Leinenhandtücher und gab sie ebenfalls hinein, darüber wurden die Birnen geschichtet, dazwischen zwei Flaschen Wein aus dem einundzwanziger Jahrgang gesteckt und zum Abschluss die festen Äpfel gelegt.
„Hol´ jetzt die lange Sticknadel und die Schnur aus der Küche und näh´ den Sack über der Öffnung zu, so wie wir es immer machen“, wies er seine Jüngste an. „Dann nimmst du den kleinen Leiterwagen und fährst den Korb zum Bahnhof. In der Zwischenzeit füll´ ich die Packzettel aus. Ach, und noch ´was: Was wir hier machen, braucht die Karoline nicht so genau zu wissen. Denk´ dir etwas aus, wenn sie nachfragt“, fügte er hinzu. „Die hält sich und ihren Jakob auch nicht kurz“, murmelte er vor sich hin.
Doch Karoline fragte nicht, obwohl ihr die Geschäftigkeit in der Werkstatt nicht entgangen war, denn ähnliche Körbe füllte sie selbst für ihren Jakob. Allerdings brachte sie diese nicht zum Bahnhof sondern nur wenige Straßen weiter in das kleine Wohnhaus des jungen Sattlers.
Am Freitag vor dem dritten Advent erhielt Frieda die Mitteilung, dass am kleinen Güterbahnhof in der Neckarstadt eine Fracht für sie angekommen sei. Am nächsten Tag sah man sie ebenfalls einem Leiterwagen, den sie sich vom Kohlenhändler ausgeliehen hatte, durch die Breite Straße und durch die des H7-Quadrates ziehen, beäugt von neidischen Blicken derer, die den Inhalt des Korbes erahnten und ebenfalls dringend benötigten.
Doch Frieda war nicht geizig. Als sie kommenden Sonntag mit Georg die befreundete Familie Simon besuchte, übergab sie ein mit Kartoffel, Äpfel und Birnen gefülltes Einkaufsnetz, aus dem der Hals einer Weinflasche herausragte.
*
Nicht am Heiligen Abend sondern erst am zweiten Weihnachtsfeiertag traf Frieda in Klingenmünster ein. Wegen des Abzugs der französischen Truppen unter General de Metz war der gesamte Eisenbahnverkehr blockiert und die Fahrpläne und Streckenführung durcheinander geworfen worden.
´Wie eng hier alles ist, die Straßen, die Häuser, ja selbst das Elternhaus habe ich in viel größerer Erinnerung´, dachte sie, als sie sich ihm näherte, ´keinen Autoverkehr, nur Hundegebell´.
Es war erst fünf Uhr am Nachmittag, aber schon völlig dunkel, als sie in die Hofeinfahrt trat. Die Tür zur Gaststube war verschlossen, ebenso die Küche. Also stieg sie die enge Treppe hoch in das erste Obergeschoss und erinnerte sich daran, wie oft sie diese herunter lief, wenn sie von der Mutter, dem Vater oder später der Stiefmutter gerufen wurde. Am Ende der Treppe rechts den Gang entlang befand sich vor vielen Jahren einmal ihr Zimmer vor denen der Brüder. Aber hier war es jetzt tiefdunkel, linker Hand zeigte sich an der Türschwelle zum ehemaligen Wohnzimmer ein Lichtbalken.
Schon öffnete sich die Tür und im Türrahmen stand ihr gealterte Vater mit noch vollem aber völlig ergrautem Haupthaar und tiefschwarzem Schnurrbart, breit und stark, etwas verlegen lächelnd und fragend zu der sich vom Backfisch zu einer strammen entwickelten Frau: „Frederike?“ Frieda nickte nur und grüßte förmlich, während sie der Vater in das Wohnzimmer einlud, wo Karoline und Johanna am Tisch saßen, die eine strickend, die andere stickend. „Es ist gut, dass du gekommen bist“, meinte Schorsch und schüttelte ihr kräftig die Hand, mehr an Zutraulichkeit und Freude konnte er nicht ausdrücken, war auch nicht üblich.
Nachdem Frieda auch Karoline begrüßt hatte, ging sie auf Johanna, die aufgestanden war und nun schüchtern herumstand, zu: „Du bist wohl unsere kleine Johanna, aber schon fast erwachsen“, stellte Frieda mit zurückgewonnenem Selbstbewusstsein fest. Karoline, die spürte, dass Schorsch wohl mit seiner Ältesten alleine sein wollte, erhob sich und sprach zu Johanna: „Dann wollen wir zwei ´mal das Abendbrot vorbereiten“, um gefolgt von Johanna schnell das Zimmer zu verlassen.
Als Frieda und Schorsch alleine waren, meinte der Vater: „Leg´ deinen Mantel und Hut ab und stell´ das Köfferchen hin. Ich will dich ´mal richtig anschauen. – Kräftig bist du geworden, siehst auch gesund aus und im Gesicht immer noch das schelmische Lächeln.“ ´Du hättest auch einen besseren haben können als den Ossmann`, dachte er, während er sie betrachtete, sprach es aber nicht aus. „Ja, Vater, eigentlich kann ich so richtig nicht klagen, wenn man ´mal von den schlechten Zeiten absieht. Mit meinem Georg komme gut aus, wir haben auch einige Freunde und die Herrschaft behandelt mich ordentlich. Jetzt allerdings wird es etwas eng mit dem Geld – ich hab´s dir ja geschrieben - , weil sie den Georg gekündigt haben. Aber er findet bestimmt eine neue Stelle als Schmid – bei den vielen Fabriken“, erklärte Frieda, obwohl sie um die hoffnungslosen Aussichten bei der hohen Arbeitslosigkeit wusste. „Hast du auch Kinder?“ fragte Schorsch mit besorgtem Unterton. „Leider nicht. Vor einem Jahr hatte ich eine Todgeburt, ein Mädchen. Jetzt kann ich keine Kinder mehr bekommen“, antwortete Frieda traurig. „Das tut weh“, meinte der Vater mitfühlend, fügte aber doch noch hinzu, „vielleicht war das besser so, dein Ossmann ist dein Cousin, da weiß man nie so genau, was dabei herauskommt.“
Dann drehte sich das Gespräch um die Brüder, die Wirtschaft, Verwandte und Bekannte, bis Johanna eintrat und zum Abendbrot einlud, das so früh genommen wurde, weil um neunzehn Uhr die Gastwirtschaft wieder geöffnet werden sollte.
Doch zuvor führte der Vater Frieda noch in ihre Kammer, die fast unverändert möbliert war, lediglich nach dem Auszug der Franzosen neu getüncht wurde. Auf dem Nachttischschränkchen lag eine kleine Bibel und an der Wand hing Schorschs Hochzeitbild mit einem Trauerflor. Darauf zeigte er nun und sagte: „Morgen früh gehen wir auch zum Grab und sagen der Mutter, dass wir uns wieder vertragen wollen.“ Dann wischte er sich kurz die Augen, verließ die Kammer mit den Worten: „Komm gleich ´runter zum Essen, damit´s nicht kalt wird.“
*
Am nächsten und übernächsten Tag brauchte Frieda nicht mitzuhelfen, stattdessen waren Besuche bei Verwandten, alten Freundinnen und Bekannten angesagt. Doch am Freitag meinte Karoline: „Frieda, für Samstag haben sich ein paar Herren aus Speyer angekündigt. Die wollen am Nachmittag nach ihrer Wanderung ein gutes Essen. Heut´ fangen wir mit dem Backen der Kränze an, morgen müssten dann Kartoffeln, Gemüse, Äpfel und alles andere vorbereitet werden. Wenn du mit anpackst, dann brauch´ ich die Lina nicht zu bezahlen. Übrigens servieren könntest du auch. Der Schorsch will nicht, dass Johanna das Essen aufträgt. Die Herren machen oft so schmutzige Witze, manchmal grabschen sie auch. Du weißt schon, was ich meine...“
Dass Mitarbeit auf Frieda zukäme, war ihr schon bewusst. Dass aber in diesen schlechten Zeiten, in denen so viele einfache Menschen in den Städten nicht satt wurden, Festessen arrangiert werden konnten, ärgerte sie.
Am Nachmittag des nächsten Tages zogen Frieda und Johanna ihre hellen, kein Körperteil beengenden Reformkleider an, beide leicht tailliert und mit einem Gürtel in Form gehalten, während Karoline sich eine saubere, weiße Schürze mit Spitzenrand über ihr blauweiß gewürfeltes Wollstoffkleid band. Die dunklen Wollstrümpfe, deren Enden an das Strumpfband geknüpft wurden, steckten in blank geputzten Lederschuhen. So standen sie wie ein Empfangskomitee im Hof, als die fünf Wandermänner mit strammen Schritt durch die Einfahrt marschierten. „Das muss fotografiert werden“, bestimmte der schmale mit Nickelbrille unter ihnen, holte seinen Apparat heraus, kommandierte die Frauen in Position und knipste seine Bilder.
Währenddessen komplimentierte Schorsch seine gut zahlenden Gäste mit großer Zuvorkommenheit in das Nebenzimmer, in dem zwei Tische zusammengeschoben, mit weißen Dammastdecken und gutem Geschirr gedeckt waren. Fein geordnet lagen rechts Messer, Gabel, Löffel auf gläsernen Besteckbänkchen und links waren verschiedene Gläser aufgestellt, für den Roten, den Weißen, den Likör. Des weiteren zierte die Tische kunstvoll zusammengesteckte Servietten und eine Efeuranke. Alles war mit Hilfe Johannas, die geschickt hantierte, so oder ähnlich arrangiert, wie es Frieda bei ihrer Herrschaft gelernt hatte.
„Meine Herren, wollen Sie nicht ablegen und Platz nehmen“, lud Schorsch devot ein. „Mensch Decker, ist ja prachtvoll gedeckt“, lobte der kugelige Regierungsamtsrat, dessen Kinn ein Schmiss aufwies, das Ehrenzeichen akademischer Verbindungen. Auch sein breit gebauter Wanderfreund lobte: „Wenn das Essen hält, was die Dekoration verspricht, dann ist das die Krönung unseres Ausfluges.“ „Vielleicht zuerst ein Holunderschnaps, zum Warmwerden?“ fragte der Wirt die Flasche in der einen Hand und ein Tablett mit fünf Schnapsgläsern in der anderen. Das lehnten die Herren, die sich ihrer Lodenmäntel entledigt hatten und nun in Bundhosen mit Hosenträgern über den karierten Hemden Platz genommen hatten, natürlich nicht ab.
Dann wurden die verschiedenen Essensgänge serviert: zuerst klare Rindfleischbrühe mit Eierschwämmchen, dann der gespickte Kaninchenbraten mit Rotkohl und Kartoffelklößchen, als Dessert ein Apfelkompott mit Rosinen und Blaubeerenrand, zum Schluss die Käseplatte, dazwischen verschiedene Weine. Man sprach über die Wanderung zum Treitelskopf durch die Schlucht an den Röxelhalden am Hundsfelsen vorbei und den Blick auf die „Pfälzer Schweiz“. Schorsch erklärte einen zweiten Wanderweg über das Mühltälchen unterm Hatzelberg und Abtskopf und beklagte dabei die unkontrollierten Holzeinschläge der Franzosen. Die Gespräche wurden lockerer, die Gesichter rotbackiger und die Witze zotiger. Doch da war das Geschirr schon abgeräumt, wobei Schorsch darauf achtete, dass jetzt auch Frieda nicht mehr den Raum betrat. Längst hatte sich auch der Gastraum der Wirtschaft mit einheimischen Zechern und lauten Gesprächen gefüllt, als die Männer aus dem Nebenraum schwankten, um sich zum kleinen Bahnhof zu begeben, wo die letzte Bahn schon wartete, um sie über Landau nach Speyer zu bringen.
Schorsch strich zufrieden seinen Oberlippenbart, winkte Frieda herbei und steckte ihr einen neuen Zehnmarkrentenschein in die Tasche, wobei er mehr zu sich sagte: „Um einen Wochenlohn wegen, kann man durchaus für ein paar Stunden seine soziales Republikanertum vergessen und das Maul halten, auch wenn´s einem nicht passt, dass die ständig den Kaiser, den König, den Hindenburg und Ludendorff hochleben lassen.“
12. Peter Möller, ein junger, schlaksiger Mann mit vollem Haar, buschigen Augenbrauen und höflichen Umgangsformen saß betrübt in seinem kleinen aber immerhin geheizten Untermietzimmer und machte sich Notizen. Er war jetzt gerade dreiundzwanzig Jahre alt, hatte eine Buchdruckerausbildung abgeschlossen, arbeitete jedoch seit zwei Jahren berufsfremd in der Anilin als Fabrikarbeiter und engagierte sich in der gewerkschaftlichen Betriebsgruppe und der zwischenzeitlich illegalen KPD-Zelle Ludwigshafen Süd. Für deren nächste Sitzung sollte er zum ersten Mal das politische Referat halten unter dem Thema: „Lehren aus den deutschen Ereignissen im Herbst und Winter neunzehnhundertdreiundzwanzig“.
Wie er es auf Schulungen gelernt hatte, stellte er also zuerst die Ereignisse in chronologischer Abfolge zusammen:
Faktisch 70% Arbeitslose, 95% der Betriebe nicht ausgelastet; 20% der Industrieproduktion von 1913; keine ausreichenden Löhne, Gehälter, Renten, Erwerbslosenunterstützung; faktische Wochenarbeitszeit für Beschäftigte von 48-54 Stunden bei Wochenlöhnen von 20 Mark; Handel ohne Waren.
Als er seine Notizen noch einmal durchsah, stellte er fest: Am Ende des Jahres neunzehnhundertdreiundzwanzig war das deutsche Großkapital mit den Reichswehrgenerälen der unbestreitbare Sieger, dies vor allem mit Unterstützung der SPD. Einer halben Revolution folgt immer der ganze Sieg der Konterrevolution.
*
Gegenüber dem Haupteingang des Mundenheimer Friedhofes befand sich eine Schrebergartensiedlung und mitten darin das Naturfreundehaus. Im Grunde war es eher eine Hütte, ein selbstgebautes Holzhaus mit großem Versammlungsraum, abgetrennter Küche und Schlafraum, etwas abseits zwei nach Geschlechtern getrennte Plumpsklos.
Zwischen Küche und Schlafraum stand ein einfacher Holzspanofen, dem so eingeheizt worden war, dass sein Blechmantel fast glühte, denn draußen war es Ende Februar bitterkalt, es herrschten tiefe Minusgrade. Der Ofen verströmte eine Bullenhitze und heizte die Gemüter der versammelten dreißig Männer verschiedenen Alters zusätzlich auf. Diese saßen auf selbst gefertigten, klobigen Bänken um ebensolche Tische und ereiferten sich darüber, wie man sich als Kommunist und linker revolutionärer Gewerkschafter, allerdings schon seit Monaten aus dem ADGB ausgeschlossen, gegenüber der vom Hauptvorstand des Fabrikarbeiterverbandes in der Schlichtung ausgehandelten Arbeitszeiterhöhung, dem Neunstundentag, verhalten sollte.
„Fritz, das kann doch nun wirklich nicht wahr sein, dass auch der von uns dominierte Industrieverband Chemie diese Kröte schlucken will“, empörte sich Peter Möller. „Wenn wir dagegen nichts unternehmen, setzen wir den ganzen Verband als Sammelbecken des revolutionären Chemieproletariats auf Spiel. Sind wir jetzt schon so weit heruntergekommen wie die Reformisten?“
Fritz Bäumler versuchte noch einmal alle Bedenken, die gegen einen Streik sprachen, ins Felde zu führen.
„Genossen, wir haben in den letzten Monaten so viele Niederlagen einstecken müssen. Nach der Aktion neunzehnhundertzweiundzwanzig wurden fast alle revolutionären Betriebszellen aufgerieben. Auch wird der ADGB wieder spalten, denn er hat ja das Ergebnis ausgehandelt, und wird sich mit den christlichen Gewerkschaften verbinden. Aus sicherer Quelle weiß ich, dass sich die Direktoren der Anilin mit anderen Großunternehmen abgesprochen haben, in dieser Frage vorzupreschen. Deshalb auch der einwöchige frühere Einstieg in den Neunstundentag. Man hat sich sogar ausrechnen lassen, was ein mehrwöchiger Produktionsausfall für Vor- und Nachteile bringt. Die Gegenrechnung ergab, dass bei Produktionsausfall ein Nachfrageboom erzeugt wird, der die Preise in die Höhe treibt, und nach Durchsetzung der Verlängerung des Arbeitstages und Erhöhung des Akkords höhere Gewinne erzielt werden als bei laufender Produktion. Genossen, ich bin überzeugt, wenn wir jetzt zu kämpferischen Aktionen aufrufen, treten wir in eine provokative Falle.“
„Mensch Fritz, bist du jetzt auch zu so einem Funktionär geworden, der die Arbeiter einlullen will, auch so ein Arbeiterverräter?“ brüllte Max Wenzel mit Zorn gerötetem Kopf in den Raum.
Tumult entstand: Max solle das sofort zurücknehmen. Warum denn? Er habe doch nur gesagt, was die Mehrheit hier denkt.
Endlich kehrte Ruhe ein. Nicht aus Überzeugung sondern zur Rettung seiner revolutionären Gesinnung schlug Fritz vor, ein Flugblatt zu erstellen und zu verteilen, in dem die Arbeiter am dritten März aufgefordert werden, nach achtstündigem Arbeitstag die Arbeit nieder zu legen und den Betrieb zu verlassen. Man werde dann ja sehen, wie die Reaktionen sein werden.
Als sich die Versammlung aufgelöst hatte, nahm Peter Ernst Florenz, Max Wenzel und noch drei weitere Genossen zur Seite. „Mit ein paar Flugblättern ist es nicht getan, wie ihr alle wisst. Wir müssen Arbeiterversammlungen organisieren“, meinte er, „dazu auch eine Plakataktion in den Pendlerorten der Vorderpfalz.“ „Wer soll denn von uns und wann die Plakate aufhängen?“, fragte Ernst skeptisch. „Lass das ´mal meine Sache sein. Ich hab´ Zugang zu einer Druckerei und kenne die Genossen der Arbeitslosengruppen, die auf den Dörfer agitieren können.“
*
Das am dritten März, dem Tag, an dem der Neunstundentag eingeführt werden sollte, verteilte Flugblatt zeigte wenig Wirkung. Anders dagegen die Arbeiterversammlungen während und nach der Schicht sowie die Plakataktion. Die Direktion setzte auf Spaltung der Arbeiter und drohte am vierten März: Sollte mehr als ein Drittel der Beschäftigten den Arbeitsplatz nach acht Stunden verlassen, werde sie das Werk schließen.
Als am nächsten Morgen die Frühschicht zur Arbeit gehen wollte, fand sie alle Werkstore geschlossen, dahinter den Werkschutz mit Schlagstöcken ausgerüstet, dreireihig aufgestellt und in einiger Entfernung kleine Gruppen von Angestellten und Streik brechenden Arbeitern.
Die Ruchheimer und Maxdorfer, meist junge Männer, trafen als erste am Tor drei an. „Was heißt hier Aussperrung?“ schrie Joseph Brummer, ein untersetzter stämmiger Kerl, der noch auf dem Hof der Eltern wohnte und dort auch mithalf. Er nahm den Begriff „Aussperrung“ wörtlich und persönlich. „Sind wir vielleicht Rindvieher, die man in den Stall ein- und aussperrt? Wollt ihr euch wie Ochsen behandeln lassen?“ fragte er die umstehenden Kollegen. „Los, wir zeigen denen da, wer wen aussperrt!“ Und schon kletterten die ersten auf die Werkstore, schoben Hindernisse weg und machten sich an den Kontrollhäuschen zu schaffen. Dabei kam auch allerlei Werkzeuge wie Beißzangen und Feilen zum Einsatz.
Die Leute vom Werkschutz nahmen zuerst den Kampf noch auf, doch als sie sahen, dass die Arbeiter mit Werkzeugen ausgerüstet waren und vom Bahnhof sich eine Menschenschlange aus weiteren Frühschichtlern heranwälzte, zogen sie sich zurück.
Diese Menschenschlange wurde von den Arbeitern gebildet, die der Eisenbahnzug täglich auf seiner Strecke Speyer, Schifferstadt, Limburgerhof, Rheingönnheim einsammelte und direkt in das Werk fuhr. Heute jedoch waren die Zuggeleise vor dem Werk mit schweren eisernen Rammböcken versperrt. Als die Arbeiter den ungewohnten Weg über die Geleise zur Straße zu Tor drei gingen, bemerkten sie im Halbdunkel, dass in den Seitenstraßen schon Polizeistaffeln zusammengezogen waren. Noch bevor sie die an Toren und Gittern Hantierenden warnen konnten, sahen sie, wie bewaffnete Polizei vorrückte. Die Arbeiter wehrten sich mit Steinen, Werkzeugen, Latten und anderen Wurfgeschossen. Eine Polizeistaffel aus fünfzig Mann war jedoch durch die für sie unerwartet vom Bahnhof anrückende Menschenmasse eingekreist worden. In Panik gab der Leiter der Staffel den Befehl zu schießen. Ziellos wurde in die Menge geballert. Als Fritz Bäumler und Peter Möller am Schauplatz der Ereignisse eintrafen, um die Revolte in organisatorische Bahnen zu lenken, fanden sie fünf getötete Arbeiter und vierzig zum Teil Schwerverletzte vor. Zwischenzeitlich hatte der Bürgermeister auf Anraten der Werkdirektoren auch das französische Militär um Hilfe gebeten. Angesichts der schwer bewaffneten anrückenden Franzosen löste sich die Menge auf.
*
Nun begann der Prozess der Zermürbung der kämpfenden Arbeiter, denn es war geplant die aufständische Arbeiterschaft physisch auszuhungern und psychisch zu demoralisieren.
Tatsächlich waren Ende April neunzehnhundertvierundzwanzig allein in Ludwigshafen durch die Aussperrung von achttausendzweihundertfünfzehn Beschäftigten bei der Anilin und eintausendeinhundertvierundzwanzig in metallverarbeitenden Betrieben zusammen mit Frauen und Kindern achtunddreißigtausendachthundertdreizehn Menschen, das waren rund neununddreißig Prozent der Bevölkerung, auf öffentliche Fürsorge angewiesen, die sie nur notdürftig versorgte.
Wie schon neunzehnhundertzweiundzwanzig wurden die Ausgesperrten aufgefordert sich persönlich und brieflich an das Unternehmen zu wenden, um ihre Bereitschaft anzuzeigen, die Arbeit unter den Bedingungen der direktoralen Betriebsleitung aufzunehmen. Der Druck des Magens und der Familie verfehlte seine Wirkung nicht. Nach neuneinhalb Wochen Aussperrung wurde sie am neunten Mai aufgehoben. Erneut wurden Kommunisten, revolutionäre Betriebsräte und Gewerkschaftler sowie rebellische Jungarbeiter ausgesiebt, darunter auch Peter Möller.
Da war es auch nicht tröstend, dass bei der Reichstagswahl am vierten Mai neunzehnhundertvierundzwanig die KPD in Ludwigshafen mit elftausend Stimmen zur zweitstärksten, in Speyer, dem Bezirk Speyer und dem Bezirk Neustadt sogar zur stärksten politischen Partei gewählt wurde, denn die Basis für die parlamentarische Arbeit in den Betrieben war über Jahre hinaus geschwächt worden.
Auszug aus dem 1. Band der Romanquatrologie "Über Leben". Demokratischer Heimatroman von Wilma Ruth Albrecht. Heidenheim (edition Spinoza) 2016, S.68-80

Online-Flyer Nr. 816 vom 09.08.2023
Druckversion
Literatur
Auszug aus dem Demokratischen Heimatroman "Über Leben"
1923: Kämpfe und Niederlagen der Arbeiterbewegung im Südwesten
Von Wilma Ruth Albrecht
 9. An einem warmen Juliabend neunzehnhundertdreiundzwanzig kehrte Frieda müde nach Hause in ihre kleine, dunkle Wohnung, die in einem Laubengaleriehinterhaus der Mannheimer Innenstadt, genauer im Quadrat H 7 lag und die sie nach Georgs Entlassung aus der BASF vor einem halben Jahr beziehen konnte, weil ihr Mann in einer Drahtseilfabrik Arbeit fand. Die Wohnung bestand nur aus zwei Zimmern ohne eigene Toilette und einem Wasserbecken für drei Arbeiterfamilien am Ende der Galerie, dafür war sie billig. Die ungenügenden sanitären Einrichtungen waren nun auch wiederum nicht so schlimm, denn auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich das öffentliche Volksbad, in dem man am Samstag Nachmittag zu bezahlbaren Preisen ein Wannenbad nehmen oder sich duschen konnte. Wenn man von den trüben Arbeitervierteln in den unteren Quadranten absah, dann hatte Mannheim durchaus seine Reize: da gab es Lichtspielhäuser, den Luisen- und Schlosspark, die Friedrichsanlage, elegante Kaufhäuser und viele Gaststätten, auch wurden immer Dienstmädchen oder Haushaltshilfen gesucht, denn hier wohnten mehr städtische und Landesbeamte als in der hässlicheren Schwesterstadt westlich des Rheins.
9. An einem warmen Juliabend neunzehnhundertdreiundzwanzig kehrte Frieda müde nach Hause in ihre kleine, dunkle Wohnung, die in einem Laubengaleriehinterhaus der Mannheimer Innenstadt, genauer im Quadrat H 7 lag und die sie nach Georgs Entlassung aus der BASF vor einem halben Jahr beziehen konnte, weil ihr Mann in einer Drahtseilfabrik Arbeit fand. Die Wohnung bestand nur aus zwei Zimmern ohne eigene Toilette und einem Wasserbecken für drei Arbeiterfamilien am Ende der Galerie, dafür war sie billig. Die ungenügenden sanitären Einrichtungen waren nun auch wiederum nicht so schlimm, denn auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich das öffentliche Volksbad, in dem man am Samstag Nachmittag zu bezahlbaren Preisen ein Wannenbad nehmen oder sich duschen konnte. Wenn man von den trüben Arbeitervierteln in den unteren Quadranten absah, dann hatte Mannheim durchaus seine Reize: da gab es Lichtspielhäuser, den Luisen- und Schlosspark, die Friedrichsanlage, elegante Kaufhäuser und viele Gaststätten, auch wurden immer Dienstmädchen oder Haushaltshilfen gesucht, denn hier wohnten mehr städtische und Landesbeamte als in der hässlicheren Schwesterstadt westlich des Rheins.Als sie in die Wohnstube trat, fand sie auf dem mit Wachstuch belegten weißen Küchentisch einen Zettel, auf dem ihr Mann Georg ihr mitteilte, dass er zur Parteiversammlung ins gegenüberliegende kleine Lichtspielhaus gegangen sei. Es könne spät werden, denn es gelte die große stadtweite Demonstration gegen die Cunoregierung vorzubreiten. Sie könne, wenn sie nicht zu müde sei, nachkommen. Doch sie war zu müde, denn heute war der große Fensterputz im Arzthaushalt angesagt und wer schon einmal dreizehn zwei Meter hohe Doppelfenster geputzt hat, kann dies nachempfinden.
Das kleine Lichtspielhaus, in dem sonst zwei Mal die Woche Stummfilme vorgeführt wurden, war gerammelt voll. Man sah viele Arbeiter mit Schirmmützen und um die Beine schlotternde Hosen, kleine Angestellte mit kurzem Haupthaar und ausrasiertem Nacken, dazwischen einige jüngere und ältere Frauen. Der Saal war voll beleuchtet und dennoch schummrig wegen der Rauchschwaden, die die Zigaretten- und Stumpenraucher in die Luft bliesen.
Vor der mit Ölfarbe weiß gestrichenen Kopfwand des Saales, die die Leinwand für die Filmvorführung abgab, war wie immer ein Tisch mit drei Stühlen für die Versammlungsleitung bestehend aus dem jungen Mühlenarbeiter August, dem Obmann des Vertrauenskörpers dem Metaller Friedrich und dem altbekannten kommunistischen Parteisekretär Franz aufgebaut.
Letzterer erhob sich und begrüßte die Anwesenden mit „Genossen und Genossinnen“, worauf es sogleich im Saal still wurde. „Die Partei hat für den kommenden Samstag landesweit zu Massendemonstrationen aufgerufen zum Sturz der Cunoregierung, der offenen und brutalen Interessenvertretung der aggressiven Monopolbourgeoisie, der Bergbau- und Stahlbarone, die die Arbeiterklasse versklaven will und das Kleinbürgertum inflationär enteignet hat.
Schauen wir uns diese Blutsauger des Volkes einmal an: Da haben wir einmal als Reichskanzler einen Wilhelm Cuno, vormals Direktor der Hamburg-Amerika-Linie, einen Wirtschaftsminister Wilhelm Becker, ehemaliges Vorstandsmitglied der Rheinischen Stahlwerke Otto Wolff, dann als Regierungsberater Stinnes und Helffrich selbst. Ihr Ziel ist es eine faschistische Diktatur zu errichten. Schon neunzehnhundertzweiundzwanzig plante Stinnes, den durch die Revolution erkämpfen Achtstundentag zurückzunehmen und den Zehnstundentag einzuführen, Streiks und Gewerkschaftsarbeit zu verbieten und strafrechtlich zu verfolgen und die Höchstpreisverordnungen aufzuheben, um nur einige Punkte zu nennen. Dies wird jetzt schrittweise umgesetzt.
Mit der durch die deutsche Monopolbourgeoisie provozierten Besetzung des Ruhrgebietes wird der Konkurrenzkampf zwischen den deutschen und französischen Stahlkonzernen darüber hinaus auf dem Rücken der Arbeiterklasse und des Mittelstandes ausgefochten. Es ging von Anfang an nur darum, wer in dem geplanten lothringisch-rheinischen Montantrust die Mehrheit besitzen soll. Poincaré, der Handlanger von Eugène Schneider, Francois de Wendel, hat doch schon letzten Herbst gedroht, sich im Ruhrgebiet produktive Pfänder zu nehmen, wenn Stinnes, Krupp und Thyssen nicht einer Aktienkapitalverteilung von sechzig zu vierzig zustimmen und die Reparationslieferungen weiter verzögern. Die Cunoregierung hat sich ganz in den Dienst der Stinnes, Krupp, Thyssen und Co. gestellt. Ein sofortiger Generalstreik beim Einmarsch der Franzosen am elften Januar dreiundzwanzig ins Ruhrgebiet hätte Wirkung gezeigt, aber doch nicht ein passiver Widerstand. Wie sieht der denn aus, dieser passive Widerstand? Unser Genosse Stankowski von der Zeche Zollverein aus Essen wird ihn euch schildern!“
Er zeigte auf einem breiten, untersetzten jungen Mann, der sich nun erhob, an das Podium trat und in den Saal sprach: „Genossen, der angebliche passive Widerstand ist ein reines Schmierentheater. Ein paar deutsche Beamte verweigern die Durchführung der Anordnungen der Franzosen und werden einfach durch französische ersetzt. Die Zechenbesitzer halten die Produktion aufrecht und kassieren zusätzlich noch Entschädigungsgelder. Das sieht dann so aus. Die Kumpels fördern tagtäglich Kohlen, die dann auf Halden aufgehäuft werden. Dann kommt französisches Militär, Arbeiter und Grubenbeamte werden aufgefordert empört die Zeche zu verlassen, die Franzosen bleiben allein und räumen mit Hilfe der mitgebrachten fremden Arbeiter die Halden ab, verfrachten sie auf die deutschen Eisenbahnen, auf denen französische Lokführer sitzen, weil ja die deutschen passiven Widerstand geleistet haben, und transportieren sie weg. Dann kommen die Kumpel wieder und fördern... So geht das Spielchen weiter! Der Cuno lässt die Zechenbesitzer seelenruhig gewähren, denn er gehört ja selbst zu der Brut!“
„Saboteure!“ „Landesverräter!“ „Ausbeuter!“ drang es vielstimmig durch den Saal. Während der Kumpel sich setzte, bat der Sitzungsleiter um Ruhe, damit er weiter sprechen könne: „Genossen, es sind hauptsächlich unsere deutschen Finanz- und Industriehaie, die über das Volk herfallen. Ihr wisst es selbst aus euren Betrieben: Es wird ziemlich viel produziert. Die Waren, die zu lächerlich geringen Kosten für das Kapital hergestellt werden, gehen zu Schleuderpreisen ins Ausland und sichern satte Profite. Mit dem Geld, das man uns gibt, kann man sich fast nichts kaufen. Da stehen Millionen, Milliarden und neuerdings sogar Billionen auf einem Geldschein, doch ein Brot bekommt man dafür nicht. Ein Wochenlohn eines Betriebsschlossers bei Lanz reicht gerade für einen Zentner Kartoffel, zehn Arbeitsstunden sind nötig für ein Pfund Margarine.“
„Wenn es überhaupt Kartoffel und Margarine zu kaufen gibt“, schrie jemand aus dem Saal dazwischen. „Ganz recht, so ist es“, fuhr der Redner fort. „Die Verelendung der Arbeiterklasse, der kleinen Angestellten, der werktätigen Intelligenz, der Rentner und Invaliden nimmt immer größere Ausmaße an. Der Mittelstand verarmt, während die Großkapitalisten und Großgrundbesitzer Nutznießer des Kreislaufes Krieg – Krise – Inflation sind. Was hier und heute läuft, ist eine der größten Räubereien der Weltgeschichte!“ „Genauso ist es“, grummelte es vielstimmig im Saal. „Dazu kommt noch, dass überall Faschisten aus ihren dunklen, stinkigen Löchern hervorkriechen, seien es die deutschen „Vaterländischen Verbände“ der Ludendorffs und Co., die mit der reaktionären Reichswehr zusammenarbeiten, oder die mit französischen Geldern ausgehaltenen Separatisten.“
„Vor drei Tagen wurden wieder zwei Gewerkschafter auf offener Straße, auf der Neckarbrück´ brutal zusammengeschlagen – und die Polizei steht daneben und schaut zu“, schrie empört ein Versammlungsteilnehmer in den Saal.
„Deshalb Arbeiter und Genossen wisst“, hob der Redner mit emphatischer Stimme an, „nur wenn wir überall im ganzen Reich als selbständige Kraft aufmarschieren, als Klasse, die um ihre Rechte und für die sofortige Bildung einer Arbeiterregierung kämpft, werden wir im Stande sein, das jetzige Elend zu beenden. Die Losung lautet:
Schlagen wir Cuno und Poincaré
an der Ruhr und an der Spree,
auch am Neckar und am Rhein,
Mannheims Arbeiter werden Helfer sein!
„Bravo!“, „Hoch!“ “Gemeinsam sind wir stark!“ riefen die Anwesenden laut durcheinander. „Halt, Genossen, noch einen Augenblick Ruhe“, ließ sich trompetend August vom Podium vernehmen. „Bevor wir auseinander gehen, müssen wir noch das Organisatorische regeln. Also seid vernünftig, Leute. Die Demonstration hat die Partei schon angemeldet, jetzt muss noch massenhaft mobilisiert und organisiert werden, damit keine Provokateure stören können.“
„Wenn ich auf so einen treff´, dem hau´ ich gleich eine über die Rüb´“, plärrte ein breitschultriger Hafenarbeiter in den Saal.
„Das gerade nicht, Genosse“, beruhigte ihn August, „keine Schlägereien, dass das klar ist. Damit es nicht dazu kommt, brauchen wir Ordner. Es sollen sich jetzt alle die in die linke Ecke kommen, die schon einmal einen Streik organisiert haben oder als Ordner aufgetreten sind. Dann müssen die Flugblätter in der Stadt und im Hafenviertel verteilt werden. Die Helfer kommen auf die rechte Seite.“ „Und die Betriebe?“, fragte jemand. „Das wird zentral übernommen“, erklärte August.
So ging es noch eine halbe Stunde hin und her, bis um dreiundzwanzig Uhr die Versammlung aufgelöst wurde. Georg kam kurz vor Mitternacht mit zwei Packen Flugblätter an und erklärte Frieda, die schon lange im Bett lag, dass sie am Samstag auf dem Wochenmarkt einen Packen Flugblätter verteilen soll, während er selbst im Jungbusch von Tür zu Tür gehen wollte.
*
Als Georg eine Viertelstunde zuvor in den Hinterhof eingetreten war, sah er in der Waschküche noch Licht. Diesen erbärmlich muffigen und schimmeligen Raum, der immer klamm blieb, bewohnte seit ein paar Monaten der Kriegsinvalide Josef Mosbach. Sein rechtes Bein war bis zum Beckenansatz, sein linkes bis zum Knie amputiert und seine Invalidenrente so gering, dass er sich mit einem Rollwägelchen tagsüber bettelnd auf den Straßen bewegen musste. Als überzeugter Nationalist und Kriegsfreiwilliger wollte er als Feldjäger eine berufliche Zukunft in der kaiserlichen Armee finden. Doch diese Zukunftsvision zerstob mit der Gewehrsalve, die seine Beine zerschmetterte. Dennoch glaubte er fest daran, dass der Krieg hätte gewonnen werden können, wenn nicht die Sozialisten den Truppen einen Dolchstoß verpasst hätten. Dann wäre es auch nicht zum Versailler Schandvertrag gekommen, der das deutsche Heer auf nur hunderttausend Mann begrenzte, und er wie auch andere Kriegsinvaliden hätten in ihm auch noch Verwendung finden können. So aber war es von militärischem Standpunkt völlig einsichtig, dass dieses Hunderttausend-Mann- Heer sich natürlich nicht auch noch mit Krüppel belasten konnte, sollte es demnächst wieder zu Kämpfen mit dem Erzfeind kommen.
Als er nun auf dem Tisch hinter dem Fenster sitzend Georg mit zwei Packen Papier unter dem Arm ankommen sah, kroch in ihm Wut hoch. ´Auch so ein Linker, der die Heimat in Chaos und Anarchie durch ständige Streiks, Kundgebungen und Demonstrationen stürzt. Diese Subjekte haben auch noch zwei gesunde Beine, eine feste Arbeit und dazu noch ein strammes Weibsbild, das ihnen nachts das Bett wärmt. Wahrscheinlich liegt seine Frieda schon mit breiten Beinen bereit. Man müsste doch mindestens einen dieser Vaterlandsverräter zu packen bekommen!`
Am Montag, dem Tag des politischen Massenstreiks mit Großdemonstration, schob er sich auf seinem Wägelchen mühsam über den Ring und durch die Beilstraße in die Hafengegend. Sein Ziel war die Drahtzieherei, in der Georg Ossmann arbeitete. Vor dem Eingangstor hielt er und stellte ein Pappschild auf, auf dem stand:
„Achtung! Auch diesen Betrieb ruinieren russisch gelenkte Kommunisten, während nationale Deutsche arbeitslos auf der Straße sitzen.“
Als der Pförtner den Mann auf die andere Straßenseite schieben wollte, kam es zu einem Geschrei: „Lassen sie den Mann doch, der hat gar nicht so unrecht“, meinte eine verhärmt aussehende Beamtenwitwe mittleren Alters mit schief abgelaufenen Sohlen an den Schuhen. „Mein Paulchen hat Abitur und findet nirgends eine Anstellung.“ „Und die in dem Betrieb haben schon wieder am Mittag die Arbeit hingeschmissen, um zu demonstrieren“, keifte eine rundliche Dirne.
Tatsächlich zogen am frühen Nachmittag streikende Arbeiter, kleine Angestellte und selbst Dienstmädchen und –boten in drei langen Zügen über die Blanken, die Breite Straße und die Akademiestraße zum Paradeplatz, um lauthals ihre Forderungen kund zu tun:
Rücktritt Cunos und Auflösung des Reichstages, Bildung einer Arbeiter- und Bauernregierung; Beschlagnahme der Lebensmittel und Sicherung der Ernährung; Anerkennung der proletarischen Kontrollausschüsse; Aufhebung des Verbots proletarischer Hundertschaften; Festsetzung eines Minimallohnes von 60 Friedenspfennigen; Wiedereinsetzung aller Arbeitslosen und Beschäftigung von Kriegsrentnern; Aufhebung des Demonstrationsverbotes und des Ausnahmezustandes; Freilassung aller politischen Gefangenen.
Das waren nicht nur Kommunisten, Freie Gewerkschafter sondern es fanden sich auch Sozialdemokraten und christliche Gewerkschafter ein, unter ihnen auch Georg Ossmann und seine gewerkschaftlich organisierten Arbeitskollegen.
Obwohl solche Streiks für die Drahtzieherei nichts Neues waren, hatte dieser jedoch für Georg ein Nachspiel, weniger wegen der Streikbeteiligung selbst als vielmehr wegen der Presseveröffentlichung in der örtlichen Zeitung, die halbseitig ein Foto mit dem Kriegsinvaliden auf seinem Wägelchen und seinem Pappschild, dessen Aufschrift deutlich erkennbar nachgezogen worden war, vor der Drahtfabrik abgebildet brachte mit der Balkenüberschrift „Deutschland - ganz unten!“
Georg und ein weiterer Genosse wurden wegen Störung des Betriebsfriedens, Aufhetzung zur Arbeitsverweigerung und Schädigung des Betriebsansehens fristlos entlassen. Neueinstellungen, vor, allem die eines Kriegskrüppels, erfolgten nicht.
Dass der folgenden einjährigen Arbeitslosigkeit Georgs die Denunziation seines Nachbarn zugrunde lag, erfuhr er erst viele Jahre später.
Die erhoffte Wirkung trat aber ein: Georg zog sich nach dem Verbot der KDP am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertdreiundzwanzig, der Inhaftierung von Franz und August erst einmal ins Privatleben zurück.
10. „So geht das einfach nicht mehr weiter“, schimpfte der Ochsenwirt unter beifälligem Nicken der sechs gestandenen Männer mittleren Alters, die den kleinen SPD-Ortsverband des Dorfes bildeten und sich Mitte Oktober neunzehnhundertdreiundzwanzig in Schorschs schwach beleuchtetes Hinterzimmer versammelt hatten. „Überall ist Chaos, das Geld ist nichts mehr wert, die Menschen hungern, wir sitzen auf unserem Wein und Obst, die Eisenbahn fährt schon seit Monaten nur sporadisch, uns plündern die Franzosen die Wälder, in München ist Diktatur, überall Aufmärsche, Streiks, Überfälle und was weiß ich sonst noch. Alles läuft, wenn es so weiter geht, wieder auf einen Krieg hinaus. Das ist wohl das letzte, was wir brauchen.“ „Ist ja schon gut“, warf der stämmige Holzarbeiter ein, „oder siehst du einen Ausweg?“ „Ich weiß auch nicht so richtig,“, meinte der Ochsenwirt, um dann zögernd fort zu fahren: „Aber wenn es nicht anders geht und die Situation sich in unserem Landstrich nicht anders verbessern kann, dann sollten wir vielleicht doch dem Drängen des Generals de Metz nachgeben und uns autonom erklären.“ „Bist du von allen Socken, Ochsenwirt? Ist dir vielleicht dein Name ins Hirn gestiegen?“ schimpfte Eugen, „Jetzt, wo wir in Berlin wieder in der Regierung sind! Sollen wir vielleicht unseren Genossen in den Rücken fallen? Das kommt gar nicht in Frage.“ „Hör´ auf ´rumzumaulen, Eugen“, erwiderte der Geschmähte sachlich. „Ich hab´ neulich zufällig unseren Abgeordneten, den Hoffmann Johannes, in Bergzabern getroffen und der war auch der Meinung, bevor die rechten Bauernbündler die pfälzische Autonomie ausrufen, sollten wir Sozialdemokraten die Sache lieber in die Hand nehmen. Ein erster Schritt müsste natürlich so eine Art Währungsunion sein. Wenn wir den Franc anstelle uns´rer Mark als Zahlungsmittel hätten, könnten wir wenigstens unseren Wein gut verkaufen. Dieser ganze Quatsch mit dem passiven Widerstand hat doch überhaupt nichts gebracht außer Not und Unruhen. Unser Gebiet war doch schon vorher von den Franzosen besetzt.“
Keine vierzehn Tage später kursierten anonyme Flugblätter im Land:
„Wieder einmal hat sich die Sozialdemokratie als Vaterlandsverräter entlarvt. Am 23. Oktober wollten drei Sozis: der Abgeordnete Johann Hoffmann, der 2. Bürgermeister von Ludwigshafen Paul Kleefoot und der bekannte Rechtsverdreher Dr. Wilhelm Wagner unsere schöne Pfalz an die Franzmänner verscherbeln.
Sie teilten in Speyer dem Besatzungsgeneral de Metz mit, dass sie einen selbständigen Staat Pfalz bilden wollten und sich für eine provisorische Regierung zur Verfügung stellten. Den verantwortungsbewussten , nationalen bürgerlichen Parteien ist es zu verdanken, dass dieser zweite Dolchstoß abgewehrt wurde. Durch Vertagung der Abstimmung über den Antrag der drei Separatisten auf der Kreistagssitzung am 24. Oktober in Speyer konnten die nationalen Reihen geschlossen werden. Aber erst durch die Androhung des Parteiausschlusses durch den SPD-Vorsitzenden Wels, der extra aus Berlin anreisen musste, und die Überzeugungskraft des Staatssekretärs Profit aus Heidelberg konnten die drei Verräter wieder auf Linie gebracht werden. Einstimmig nahm dann am 26. Oktober die Kreistagssitzung die Resolution an, dass die Pfalz fest zu Bayern und dem Reich steht. Es lebe Deutschland! Bayern und Pfalz, Gott erhalt´s!“
Beim Frühschoppen nach dem sonntäglichen Kirchgang zeigte der zerknirschte Ochsenwirt das Flugblatt seinen Genossen. „Sich der Parteidisziplin unterordnen und vor den Parteibonzen zu kuschen, muss nicht unbedingt auch politisch klug sein“, knurrte der faltige Waldarbeiter.
Er sollte Recht behalten, denn keinen Monat später hatten die Bauernbündler die Macht in der Pfalz ergriffen und den Führer der „Freien Bauernschaft“ Franz Josef Heinz am zwölften November zum Präsidenten der Republik Pfalz ausgerufen und in Speyer unter dem Schutz de Metz eine Regierung gebildet. Doch seine Herrschaft war nicht von langer Dauer. Aus München kam der Mordbefehl, bis zum zehnten Januar sollten alle Mitglieder der separatistischen Regierung beseitigt werden. Am neunten Januar wurde das Vorhaben bezeichnender Weise im Wittelsbacher Hof in Speyer dann auch prompt durchgeführt.
Doch damit sollte noch lange keine Ruhe im Land einkehren. Bis ins Frühjahr neunzehnhundertvierundzwanzig hinein zogen sich Aufstände, Streiks und Boykotts. Erst danach schienen leichtere Tage anzubrechen.
11. Frieda saß am Küchentisch, der mit einem bunten Wachstuch bedeckt war. Darauf lagen ein Lineal, ein Radiergummi, ein Bleistift sowie ein Tintenfässchen mit königsblauer Tinte, ein Federhalter und mehrere Federn. In ihren Händen hielt sie ein mit krakeligen Zeichen beschriftetes Blatt Papier, das auf der Rückseite mit einer Nähmaschinenwerbung bedruckt war, und las sich die von einer guten Bekannten korrigierte Vorfassung des Briefes an den Vater noch einmal durch. Sie wusste, ein von Rechtschreibfehlern wimmelnder Brief an den Vater würde einen schlechten Eindruck machen und ihr Anliegen, Unterstützung von ihm zu erhalten, nicht fördern.
Dann nahm sie das Lineal und den Bleistift in die Hand, legte das Lineal auf den weißen, unbeschriebenen Briefbogen und zog mit dem Bleistift vorsichtig nur schwer erkennbare Linien. Sie suchte sich eine Schreibfeder aus, steckte sie in den Federhalter und öffnete das kleine Tintenfässchen, tunkte die Feder hinein, ließ etwas Tinte abtropfen und erprobte an einer Ecke der Vorfassung des Briefes ihr Schriftbild. Als sie damit zufrieden schien, nahm sie sich das leere Blatt vor und schrieb mit verkrampften Fingern, die des Schreibens längerer Texte entwöhnt waren:
- Mannheim, den 9. Dezember 1923
Guten Tag, Vater!
Nachdem ich viele Jahre nichts mehr von mir habe hören lassen und auch von dir keinen Gruß erhielt und angesichts der schweren Notzeiten und politischen Unruhen möchte ich noch einmal mein Elternhaus sehen und, wenn es Dir recht ist, auch Dich. Das ist jetzt auch möglich, weil die Rheinbrücke wieder ohne Sondergenehmigung passiert werden kann.
Wir sollten uns aussprechen und unseren Streit beenden.
Ich bin mit dem Ossmann Georg verheiratet, arbeite im Haushalt und bewohne eine kleine Zweizimmerwohnung. Mein Mann arbeitete in der Fabrik, ist aber leider jetzt wieder arbeitslos geworden. Zuvor kamen wir im Großen und Ganzen so zurecht, jetzt ist es schwieriger, weil die Arbeitslosenunterstützung doch recht gering ist.
Vielleicht habe ich Dich enttäuscht, aber ich konnte mit Deiner neuen Frau einfach nicht auskommen. Die war so ganz anders als meine Mutter, so herrisch. Aber jetzt, da ich erwachsen bin und als Haushaltshilfe auch Einblick in andere Familien bekommen habe, sehe ich das anders.
Wenn Du willst und damit einverstanden bist, würde ich um die Weihnachtszeit kommen. Meine Herrschaft fährt auf Skiurlaub, deshalb werde ich um diese Zeit nicht gebraucht. Du müsstest mir allerdings Bescheid geben.
Es grüßt Dich Deine Tochter Frederike.
Schorsch ließ sich jedoch in keine Diskussion ein. Am Nachmittag forderte er Johanna auf, einen runden Weidenkorb aus der Scheune zu holen und ihn in seine Werkstatt zu bringen. Auf die Frage, was er vorhabe, antwortete er: „Ich will die Frederike mit einem Fresskorb überraschen. Geh´ hoch in den Speicher. Hol´ einen Spankorb voll Äpfel und Birnen, nimm auch vom Dörrfleisch und ein paar getrocknete Würste mit.“
Zuerst polsterte er den Weidenkorb mit getrocknetem Stroh aus, füllte im Vorratskeller ein Säckchen Kartoffel und Karotten und legte es in den Korb, umwickelte die von Johanna gebrachten Fleischwaren in Leinenhandtücher und gab sie ebenfalls hinein, darüber wurden die Birnen geschichtet, dazwischen zwei Flaschen Wein aus dem einundzwanziger Jahrgang gesteckt und zum Abschluss die festen Äpfel gelegt.
„Hol´ jetzt die lange Sticknadel und die Schnur aus der Küche und näh´ den Sack über der Öffnung zu, so wie wir es immer machen“, wies er seine Jüngste an. „Dann nimmst du den kleinen Leiterwagen und fährst den Korb zum Bahnhof. In der Zwischenzeit füll´ ich die Packzettel aus. Ach, und noch ´was: Was wir hier machen, braucht die Karoline nicht so genau zu wissen. Denk´ dir etwas aus, wenn sie nachfragt“, fügte er hinzu. „Die hält sich und ihren Jakob auch nicht kurz“, murmelte er vor sich hin.
Doch Karoline fragte nicht, obwohl ihr die Geschäftigkeit in der Werkstatt nicht entgangen war, denn ähnliche Körbe füllte sie selbst für ihren Jakob. Allerdings brachte sie diese nicht zum Bahnhof sondern nur wenige Straßen weiter in das kleine Wohnhaus des jungen Sattlers.
Am Freitag vor dem dritten Advent erhielt Frieda die Mitteilung, dass am kleinen Güterbahnhof in der Neckarstadt eine Fracht für sie angekommen sei. Am nächsten Tag sah man sie ebenfalls einem Leiterwagen, den sie sich vom Kohlenhändler ausgeliehen hatte, durch die Breite Straße und durch die des H7-Quadrates ziehen, beäugt von neidischen Blicken derer, die den Inhalt des Korbes erahnten und ebenfalls dringend benötigten.
Doch Frieda war nicht geizig. Als sie kommenden Sonntag mit Georg die befreundete Familie Simon besuchte, übergab sie ein mit Kartoffel, Äpfel und Birnen gefülltes Einkaufsnetz, aus dem der Hals einer Weinflasche herausragte.
*
Nicht am Heiligen Abend sondern erst am zweiten Weihnachtsfeiertag traf Frieda in Klingenmünster ein. Wegen des Abzugs der französischen Truppen unter General de Metz war der gesamte Eisenbahnverkehr blockiert und die Fahrpläne und Streckenführung durcheinander geworfen worden.
´Wie eng hier alles ist, die Straßen, die Häuser, ja selbst das Elternhaus habe ich in viel größerer Erinnerung´, dachte sie, als sie sich ihm näherte, ´keinen Autoverkehr, nur Hundegebell´.
Es war erst fünf Uhr am Nachmittag, aber schon völlig dunkel, als sie in die Hofeinfahrt trat. Die Tür zur Gaststube war verschlossen, ebenso die Küche. Also stieg sie die enge Treppe hoch in das erste Obergeschoss und erinnerte sich daran, wie oft sie diese herunter lief, wenn sie von der Mutter, dem Vater oder später der Stiefmutter gerufen wurde. Am Ende der Treppe rechts den Gang entlang befand sich vor vielen Jahren einmal ihr Zimmer vor denen der Brüder. Aber hier war es jetzt tiefdunkel, linker Hand zeigte sich an der Türschwelle zum ehemaligen Wohnzimmer ein Lichtbalken.
Schon öffnete sich die Tür und im Türrahmen stand ihr gealterte Vater mit noch vollem aber völlig ergrautem Haupthaar und tiefschwarzem Schnurrbart, breit und stark, etwas verlegen lächelnd und fragend zu der sich vom Backfisch zu einer strammen entwickelten Frau: „Frederike?“ Frieda nickte nur und grüßte förmlich, während sie der Vater in das Wohnzimmer einlud, wo Karoline und Johanna am Tisch saßen, die eine strickend, die andere stickend. „Es ist gut, dass du gekommen bist“, meinte Schorsch und schüttelte ihr kräftig die Hand, mehr an Zutraulichkeit und Freude konnte er nicht ausdrücken, war auch nicht üblich.
Nachdem Frieda auch Karoline begrüßt hatte, ging sie auf Johanna, die aufgestanden war und nun schüchtern herumstand, zu: „Du bist wohl unsere kleine Johanna, aber schon fast erwachsen“, stellte Frieda mit zurückgewonnenem Selbstbewusstsein fest. Karoline, die spürte, dass Schorsch wohl mit seiner Ältesten alleine sein wollte, erhob sich und sprach zu Johanna: „Dann wollen wir zwei ´mal das Abendbrot vorbereiten“, um gefolgt von Johanna schnell das Zimmer zu verlassen.
Als Frieda und Schorsch alleine waren, meinte der Vater: „Leg´ deinen Mantel und Hut ab und stell´ das Köfferchen hin. Ich will dich ´mal richtig anschauen. – Kräftig bist du geworden, siehst auch gesund aus und im Gesicht immer noch das schelmische Lächeln.“ ´Du hättest auch einen besseren haben können als den Ossmann`, dachte er, während er sie betrachtete, sprach es aber nicht aus. „Ja, Vater, eigentlich kann ich so richtig nicht klagen, wenn man ´mal von den schlechten Zeiten absieht. Mit meinem Georg komme gut aus, wir haben auch einige Freunde und die Herrschaft behandelt mich ordentlich. Jetzt allerdings wird es etwas eng mit dem Geld – ich hab´s dir ja geschrieben - , weil sie den Georg gekündigt haben. Aber er findet bestimmt eine neue Stelle als Schmid – bei den vielen Fabriken“, erklärte Frieda, obwohl sie um die hoffnungslosen Aussichten bei der hohen Arbeitslosigkeit wusste. „Hast du auch Kinder?“ fragte Schorsch mit besorgtem Unterton. „Leider nicht. Vor einem Jahr hatte ich eine Todgeburt, ein Mädchen. Jetzt kann ich keine Kinder mehr bekommen“, antwortete Frieda traurig. „Das tut weh“, meinte der Vater mitfühlend, fügte aber doch noch hinzu, „vielleicht war das besser so, dein Ossmann ist dein Cousin, da weiß man nie so genau, was dabei herauskommt.“
Dann drehte sich das Gespräch um die Brüder, die Wirtschaft, Verwandte und Bekannte, bis Johanna eintrat und zum Abendbrot einlud, das so früh genommen wurde, weil um neunzehn Uhr die Gastwirtschaft wieder geöffnet werden sollte.
Doch zuvor führte der Vater Frieda noch in ihre Kammer, die fast unverändert möbliert war, lediglich nach dem Auszug der Franzosen neu getüncht wurde. Auf dem Nachttischschränkchen lag eine kleine Bibel und an der Wand hing Schorschs Hochzeitbild mit einem Trauerflor. Darauf zeigte er nun und sagte: „Morgen früh gehen wir auch zum Grab und sagen der Mutter, dass wir uns wieder vertragen wollen.“ Dann wischte er sich kurz die Augen, verließ die Kammer mit den Worten: „Komm gleich ´runter zum Essen, damit´s nicht kalt wird.“
*
Am nächsten und übernächsten Tag brauchte Frieda nicht mitzuhelfen, stattdessen waren Besuche bei Verwandten, alten Freundinnen und Bekannten angesagt. Doch am Freitag meinte Karoline: „Frieda, für Samstag haben sich ein paar Herren aus Speyer angekündigt. Die wollen am Nachmittag nach ihrer Wanderung ein gutes Essen. Heut´ fangen wir mit dem Backen der Kränze an, morgen müssten dann Kartoffeln, Gemüse, Äpfel und alles andere vorbereitet werden. Wenn du mit anpackst, dann brauch´ ich die Lina nicht zu bezahlen. Übrigens servieren könntest du auch. Der Schorsch will nicht, dass Johanna das Essen aufträgt. Die Herren machen oft so schmutzige Witze, manchmal grabschen sie auch. Du weißt schon, was ich meine...“
Dass Mitarbeit auf Frieda zukäme, war ihr schon bewusst. Dass aber in diesen schlechten Zeiten, in denen so viele einfache Menschen in den Städten nicht satt wurden, Festessen arrangiert werden konnten, ärgerte sie.
Am Nachmittag des nächsten Tages zogen Frieda und Johanna ihre hellen, kein Körperteil beengenden Reformkleider an, beide leicht tailliert und mit einem Gürtel in Form gehalten, während Karoline sich eine saubere, weiße Schürze mit Spitzenrand über ihr blauweiß gewürfeltes Wollstoffkleid band. Die dunklen Wollstrümpfe, deren Enden an das Strumpfband geknüpft wurden, steckten in blank geputzten Lederschuhen. So standen sie wie ein Empfangskomitee im Hof, als die fünf Wandermänner mit strammen Schritt durch die Einfahrt marschierten. „Das muss fotografiert werden“, bestimmte der schmale mit Nickelbrille unter ihnen, holte seinen Apparat heraus, kommandierte die Frauen in Position und knipste seine Bilder.
Währenddessen komplimentierte Schorsch seine gut zahlenden Gäste mit großer Zuvorkommenheit in das Nebenzimmer, in dem zwei Tische zusammengeschoben, mit weißen Dammastdecken und gutem Geschirr gedeckt waren. Fein geordnet lagen rechts Messer, Gabel, Löffel auf gläsernen Besteckbänkchen und links waren verschiedene Gläser aufgestellt, für den Roten, den Weißen, den Likör. Des weiteren zierte die Tische kunstvoll zusammengesteckte Servietten und eine Efeuranke. Alles war mit Hilfe Johannas, die geschickt hantierte, so oder ähnlich arrangiert, wie es Frieda bei ihrer Herrschaft gelernt hatte.
„Meine Herren, wollen Sie nicht ablegen und Platz nehmen“, lud Schorsch devot ein. „Mensch Decker, ist ja prachtvoll gedeckt“, lobte der kugelige Regierungsamtsrat, dessen Kinn ein Schmiss aufwies, das Ehrenzeichen akademischer Verbindungen. Auch sein breit gebauter Wanderfreund lobte: „Wenn das Essen hält, was die Dekoration verspricht, dann ist das die Krönung unseres Ausfluges.“ „Vielleicht zuerst ein Holunderschnaps, zum Warmwerden?“ fragte der Wirt die Flasche in der einen Hand und ein Tablett mit fünf Schnapsgläsern in der anderen. Das lehnten die Herren, die sich ihrer Lodenmäntel entledigt hatten und nun in Bundhosen mit Hosenträgern über den karierten Hemden Platz genommen hatten, natürlich nicht ab.
Dann wurden die verschiedenen Essensgänge serviert: zuerst klare Rindfleischbrühe mit Eierschwämmchen, dann der gespickte Kaninchenbraten mit Rotkohl und Kartoffelklößchen, als Dessert ein Apfelkompott mit Rosinen und Blaubeerenrand, zum Schluss die Käseplatte, dazwischen verschiedene Weine. Man sprach über die Wanderung zum Treitelskopf durch die Schlucht an den Röxelhalden am Hundsfelsen vorbei und den Blick auf die „Pfälzer Schweiz“. Schorsch erklärte einen zweiten Wanderweg über das Mühltälchen unterm Hatzelberg und Abtskopf und beklagte dabei die unkontrollierten Holzeinschläge der Franzosen. Die Gespräche wurden lockerer, die Gesichter rotbackiger und die Witze zotiger. Doch da war das Geschirr schon abgeräumt, wobei Schorsch darauf achtete, dass jetzt auch Frieda nicht mehr den Raum betrat. Längst hatte sich auch der Gastraum der Wirtschaft mit einheimischen Zechern und lauten Gesprächen gefüllt, als die Männer aus dem Nebenraum schwankten, um sich zum kleinen Bahnhof zu begeben, wo die letzte Bahn schon wartete, um sie über Landau nach Speyer zu bringen.
Schorsch strich zufrieden seinen Oberlippenbart, winkte Frieda herbei und steckte ihr einen neuen Zehnmarkrentenschein in die Tasche, wobei er mehr zu sich sagte: „Um einen Wochenlohn wegen, kann man durchaus für ein paar Stunden seine soziales Republikanertum vergessen und das Maul halten, auch wenn´s einem nicht passt, dass die ständig den Kaiser, den König, den Hindenburg und Ludendorff hochleben lassen.“
12. Peter Möller, ein junger, schlaksiger Mann mit vollem Haar, buschigen Augenbrauen und höflichen Umgangsformen saß betrübt in seinem kleinen aber immerhin geheizten Untermietzimmer und machte sich Notizen. Er war jetzt gerade dreiundzwanzig Jahre alt, hatte eine Buchdruckerausbildung abgeschlossen, arbeitete jedoch seit zwei Jahren berufsfremd in der Anilin als Fabrikarbeiter und engagierte sich in der gewerkschaftlichen Betriebsgruppe und der zwischenzeitlich illegalen KPD-Zelle Ludwigshafen Süd. Für deren nächste Sitzung sollte er zum ersten Mal das politische Referat halten unter dem Thema: „Lehren aus den deutschen Ereignissen im Herbst und Winter neunzehnhundertdreiundzwanzig“.
Wie er es auf Schulungen gelernt hatte, stellte er also zuerst die Ereignisse in chronologischer Abfolge zusammen:
- 10. August: Der Vorsitzende der KPD-Fraktion im Reichstag Wilhelm Koenen bringt ein Misstrauensvotum gegen die Regierung Cuno im Parlament ein, nachdem Wochen zuvor schon Massenkundgebungen gegen Teuerung und Wucher veranstaltet worden waren und zwei Tage zuvor große Teile der Arbeiterschaft im Ruhrgebiet, in den Großstädten im Westen und an der Küste, im Erzgebirge, im Vogtland und natürlich in Berlin streikten.
- 11. August: Die in Berlin tagende Betriebsrätevollversammlung mit 20 000 Betriebsräten beschließt die Ausrufung eines dreitägigen Generalstreiks. Die SPD-Fraktion beschließt für den Misstrauensantrag zu stimmen.
- 12. August: Cuno tritt zurück.
- 13. August: Bildung einer großen Koalition aus SPD, DVP, DDP und Zentrum und Ernennung G. Stresemann zum Reichskanzler.
- 14. August: Abbruch des Streiks nach blutigen Zusammenstößen mit der brutal vorgehenden Polizei.
- Mitte September: Streiks im Bergbau, der Metall- und Textilindustrie Sachsens, des Rheinlandes, in Oberschlesien; Hungerdemonstrationen in Berlin, Frankfurt, Köln, Solingen und anderen Städten.
- 26. Sept.: Abbruch des sogenannten „passiven Widerstandes“ im Ruhrgebiet.
- 27. Sept.: Reichspräsident Ebert erklärt den Ausnahmezustand und überträgt die vollziehende Gewalt dem Reichswehrminister v. Seeckt. In Bayern fungiert Kahr als Generalstaatskommissar.
- 6. Oktober: Bildung einer Arbeiterregierung in Sachsen aus SPD und KPD
- 13. Okt.: Ermächtigungsgesetz durch den Reichstag verabschiedet.
- 16. Okt.: Bildung einer Arbeiterregierung in Thüringen.
- 21. Okt.: Einmarsch der Reichswehrtruppen in Sachsen und Thüringen, Besetzung Leipzigs. Gleichen Tags Konferenz der sächsischen Regierung mit Vertretern der Betriebsräte, Gewerkschaften und Kontrollausschüsse mit dem Ziel, einen Generalstreik auszurufen, der in einen bewaffneten Aufstand münden soll.
- 23.-25. Okt.: Hamburger bewaffneter Arbeiteraufstand.
- 28.-30. Okt: Auflösung der Arbeiterregierungen in Thüringen und Sachsen.
- 8. Nov.: Hitlerputsch in München; General v. Seeckt erhält von Ebert die gesamte vollziehende Gewalt übertragen.
- 23. Nov.: Verbot der KPD.
- 1. Dez.: Regierung Marx.
- 8. Dez.: 63 neue Notverordnungen verabschiedet, darunter Senkung der Löhne, Abbau der Beamtengehälter und -pensionen, Entlassung von Beamten, Kürzung der Arbeitslosenunterstützung, der Invaliden-, Kriegsbeschädigten- und Altersrente, Erhöhung der Lohnabzüge, der Steuern und Mieten, Zwangsschlichtungsverfahren
- 18. Dez.: Massenstreiks
- 21. Dez.: Notverordnung: Einführung des 10-Stundentages möglich
Faktisch 70% Arbeitslose, 95% der Betriebe nicht ausgelastet; 20% der Industrieproduktion von 1913; keine ausreichenden Löhne, Gehälter, Renten, Erwerbslosenunterstützung; faktische Wochenarbeitszeit für Beschäftigte von 48-54 Stunden bei Wochenlöhnen von 20 Mark; Handel ohne Waren.
Als er seine Notizen noch einmal durchsah, stellte er fest: Am Ende des Jahres neunzehnhundertdreiundzwanzig war das deutsche Großkapital mit den Reichswehrgenerälen der unbestreitbare Sieger, dies vor allem mit Unterstützung der SPD. Einer halben Revolution folgt immer der ganze Sieg der Konterrevolution.
*
Gegenüber dem Haupteingang des Mundenheimer Friedhofes befand sich eine Schrebergartensiedlung und mitten darin das Naturfreundehaus. Im Grunde war es eher eine Hütte, ein selbstgebautes Holzhaus mit großem Versammlungsraum, abgetrennter Küche und Schlafraum, etwas abseits zwei nach Geschlechtern getrennte Plumpsklos.
Zwischen Küche und Schlafraum stand ein einfacher Holzspanofen, dem so eingeheizt worden war, dass sein Blechmantel fast glühte, denn draußen war es Ende Februar bitterkalt, es herrschten tiefe Minusgrade. Der Ofen verströmte eine Bullenhitze und heizte die Gemüter der versammelten dreißig Männer verschiedenen Alters zusätzlich auf. Diese saßen auf selbst gefertigten, klobigen Bänken um ebensolche Tische und ereiferten sich darüber, wie man sich als Kommunist und linker revolutionärer Gewerkschafter, allerdings schon seit Monaten aus dem ADGB ausgeschlossen, gegenüber der vom Hauptvorstand des Fabrikarbeiterverbandes in der Schlichtung ausgehandelten Arbeitszeiterhöhung, dem Neunstundentag, verhalten sollte.
„Fritz, das kann doch nun wirklich nicht wahr sein, dass auch der von uns dominierte Industrieverband Chemie diese Kröte schlucken will“, empörte sich Peter Möller. „Wenn wir dagegen nichts unternehmen, setzen wir den ganzen Verband als Sammelbecken des revolutionären Chemieproletariats auf Spiel. Sind wir jetzt schon so weit heruntergekommen wie die Reformisten?“
Fritz Bäumler versuchte noch einmal alle Bedenken, die gegen einen Streik sprachen, ins Felde zu führen.
„Genossen, wir haben in den letzten Monaten so viele Niederlagen einstecken müssen. Nach der Aktion neunzehnhundertzweiundzwanzig wurden fast alle revolutionären Betriebszellen aufgerieben. Auch wird der ADGB wieder spalten, denn er hat ja das Ergebnis ausgehandelt, und wird sich mit den christlichen Gewerkschaften verbinden. Aus sicherer Quelle weiß ich, dass sich die Direktoren der Anilin mit anderen Großunternehmen abgesprochen haben, in dieser Frage vorzupreschen. Deshalb auch der einwöchige frühere Einstieg in den Neunstundentag. Man hat sich sogar ausrechnen lassen, was ein mehrwöchiger Produktionsausfall für Vor- und Nachteile bringt. Die Gegenrechnung ergab, dass bei Produktionsausfall ein Nachfrageboom erzeugt wird, der die Preise in die Höhe treibt, und nach Durchsetzung der Verlängerung des Arbeitstages und Erhöhung des Akkords höhere Gewinne erzielt werden als bei laufender Produktion. Genossen, ich bin überzeugt, wenn wir jetzt zu kämpferischen Aktionen aufrufen, treten wir in eine provokative Falle.“
„Mensch Fritz, bist du jetzt auch zu so einem Funktionär geworden, der die Arbeiter einlullen will, auch so ein Arbeiterverräter?“ brüllte Max Wenzel mit Zorn gerötetem Kopf in den Raum.
Tumult entstand: Max solle das sofort zurücknehmen. Warum denn? Er habe doch nur gesagt, was die Mehrheit hier denkt.
Endlich kehrte Ruhe ein. Nicht aus Überzeugung sondern zur Rettung seiner revolutionären Gesinnung schlug Fritz vor, ein Flugblatt zu erstellen und zu verteilen, in dem die Arbeiter am dritten März aufgefordert werden, nach achtstündigem Arbeitstag die Arbeit nieder zu legen und den Betrieb zu verlassen. Man werde dann ja sehen, wie die Reaktionen sein werden.
Als sich die Versammlung aufgelöst hatte, nahm Peter Ernst Florenz, Max Wenzel und noch drei weitere Genossen zur Seite. „Mit ein paar Flugblättern ist es nicht getan, wie ihr alle wisst. Wir müssen Arbeiterversammlungen organisieren“, meinte er, „dazu auch eine Plakataktion in den Pendlerorten der Vorderpfalz.“ „Wer soll denn von uns und wann die Plakate aufhängen?“, fragte Ernst skeptisch. „Lass das ´mal meine Sache sein. Ich hab´ Zugang zu einer Druckerei und kenne die Genossen der Arbeitslosengruppen, die auf den Dörfer agitieren können.“
*
Das am dritten März, dem Tag, an dem der Neunstundentag eingeführt werden sollte, verteilte Flugblatt zeigte wenig Wirkung. Anders dagegen die Arbeiterversammlungen während und nach der Schicht sowie die Plakataktion. Die Direktion setzte auf Spaltung der Arbeiter und drohte am vierten März: Sollte mehr als ein Drittel der Beschäftigten den Arbeitsplatz nach acht Stunden verlassen, werde sie das Werk schließen.
Als am nächsten Morgen die Frühschicht zur Arbeit gehen wollte, fand sie alle Werkstore geschlossen, dahinter den Werkschutz mit Schlagstöcken ausgerüstet, dreireihig aufgestellt und in einiger Entfernung kleine Gruppen von Angestellten und Streik brechenden Arbeitern.
Die Ruchheimer und Maxdorfer, meist junge Männer, trafen als erste am Tor drei an. „Was heißt hier Aussperrung?“ schrie Joseph Brummer, ein untersetzter stämmiger Kerl, der noch auf dem Hof der Eltern wohnte und dort auch mithalf. Er nahm den Begriff „Aussperrung“ wörtlich und persönlich. „Sind wir vielleicht Rindvieher, die man in den Stall ein- und aussperrt? Wollt ihr euch wie Ochsen behandeln lassen?“ fragte er die umstehenden Kollegen. „Los, wir zeigen denen da, wer wen aussperrt!“ Und schon kletterten die ersten auf die Werkstore, schoben Hindernisse weg und machten sich an den Kontrollhäuschen zu schaffen. Dabei kam auch allerlei Werkzeuge wie Beißzangen und Feilen zum Einsatz.
Die Leute vom Werkschutz nahmen zuerst den Kampf noch auf, doch als sie sahen, dass die Arbeiter mit Werkzeugen ausgerüstet waren und vom Bahnhof sich eine Menschenschlange aus weiteren Frühschichtlern heranwälzte, zogen sie sich zurück.
Diese Menschenschlange wurde von den Arbeitern gebildet, die der Eisenbahnzug täglich auf seiner Strecke Speyer, Schifferstadt, Limburgerhof, Rheingönnheim einsammelte und direkt in das Werk fuhr. Heute jedoch waren die Zuggeleise vor dem Werk mit schweren eisernen Rammböcken versperrt. Als die Arbeiter den ungewohnten Weg über die Geleise zur Straße zu Tor drei gingen, bemerkten sie im Halbdunkel, dass in den Seitenstraßen schon Polizeistaffeln zusammengezogen waren. Noch bevor sie die an Toren und Gittern Hantierenden warnen konnten, sahen sie, wie bewaffnete Polizei vorrückte. Die Arbeiter wehrten sich mit Steinen, Werkzeugen, Latten und anderen Wurfgeschossen. Eine Polizeistaffel aus fünfzig Mann war jedoch durch die für sie unerwartet vom Bahnhof anrückende Menschenmasse eingekreist worden. In Panik gab der Leiter der Staffel den Befehl zu schießen. Ziellos wurde in die Menge geballert. Als Fritz Bäumler und Peter Möller am Schauplatz der Ereignisse eintrafen, um die Revolte in organisatorische Bahnen zu lenken, fanden sie fünf getötete Arbeiter und vierzig zum Teil Schwerverletzte vor. Zwischenzeitlich hatte der Bürgermeister auf Anraten der Werkdirektoren auch das französische Militär um Hilfe gebeten. Angesichts der schwer bewaffneten anrückenden Franzosen löste sich die Menge auf.
*
Nun begann der Prozess der Zermürbung der kämpfenden Arbeiter, denn es war geplant die aufständische Arbeiterschaft physisch auszuhungern und psychisch zu demoralisieren.
Tatsächlich waren Ende April neunzehnhundertvierundzwanzig allein in Ludwigshafen durch die Aussperrung von achttausendzweihundertfünfzehn Beschäftigten bei der Anilin und eintausendeinhundertvierundzwanzig in metallverarbeitenden Betrieben zusammen mit Frauen und Kindern achtunddreißigtausendachthundertdreizehn Menschen, das waren rund neununddreißig Prozent der Bevölkerung, auf öffentliche Fürsorge angewiesen, die sie nur notdürftig versorgte.
Wie schon neunzehnhundertzweiundzwanzig wurden die Ausgesperrten aufgefordert sich persönlich und brieflich an das Unternehmen zu wenden, um ihre Bereitschaft anzuzeigen, die Arbeit unter den Bedingungen der direktoralen Betriebsleitung aufzunehmen. Der Druck des Magens und der Familie verfehlte seine Wirkung nicht. Nach neuneinhalb Wochen Aussperrung wurde sie am neunten Mai aufgehoben. Erneut wurden Kommunisten, revolutionäre Betriebsräte und Gewerkschaftler sowie rebellische Jungarbeiter ausgesiebt, darunter auch Peter Möller.
Da war es auch nicht tröstend, dass bei der Reichstagswahl am vierten Mai neunzehnhundertvierundzwanig die KPD in Ludwigshafen mit elftausend Stimmen zur zweitstärksten, in Speyer, dem Bezirk Speyer und dem Bezirk Neustadt sogar zur stärksten politischen Partei gewählt wurde, denn die Basis für die parlamentarische Arbeit in den Betrieben war über Jahre hinaus geschwächt worden.
Auszug aus dem 1. Band der Romanquatrologie "Über Leben". Demokratischer Heimatroman von Wilma Ruth Albrecht. Heidenheim (edition Spinoza) 2016, S.68-80

Online-Flyer Nr. 816 vom 09.08.2023
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE