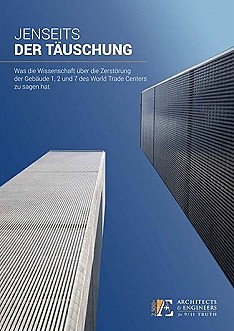SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Arbeit und Soziales
Feminismus im Spannungsfeld von Patriarchat und Kapital
Was haben wir gewollt, was ist daraus geworden? (1)
Von Maria Mies
Die internationale Frauenbewegung ist der Geburtsort revolutionärer Ideen. Samenkörner, die aufzugehen in diesem kapitalistischen System zu verhindern gesucht werden. Warum gibt es auf der ganzen Welt Gewalt gegen Frauen, in allen Kulturen, in allen Gesellschaftsschichten? Was für Zusammenhänge finden sich in einem Gesellschaftssystem, das nur Ware und Konsum als glücklich machend verheißt, in dem Menschen selbst zu Waren und Konsumgütern werden? Wir eröffnen eine Reihe mit Texten der Soziologie- und Gesellschaftswissenschaftlerin, Prof. Maria Mies, deren wichtigstes Buch „Patriarchat und Kapital“ erst kürzlich neu aufgelegt worden ist. Die einleitenden drei Artikel (in Folge) erschienen in dem von Maria Mies gegründeten „Infobrief gegen Konzernherrschaft und neoliberale Politik“. Hier Teil 1 mit der Fragestellung: was haben wir gewollt?
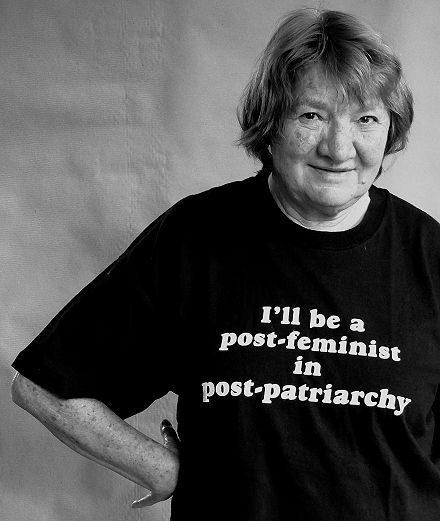
Maria Mies, 2008 (Foto: arbeiterfotografie.com)
Köln, das erste autonome Frauenhaus in Deutschland
Mein Zugang zur Frauenbewegung war nicht die Frage der Gleichheit zwischen Männern und Frauen, die in unserer Verfassung zwar gefordert aber bis heute nirgendwo eingelöst ist sondern die Gewaltfrage. Diese Frage hatte sich mir während meiner Forschungen über indische Frauen schon aufgedrängt. (1968-1970). Dabei entdeckte ich nicht nur, dass es ein System namens Patriarchat gibt, sondern auch, dass dieses Patriarchat nicht nur in Indien existierte sondern auch in Deutschland. Hier äußerte es sich zwar nicht in Kinderheiraten und Witwenverbrennungen, wohl aber in der Gewalt gegen Frauen und Kinder und in frauendiskriminierenden Gesetzen. Diese Gewalt war in Deutschland nicht nur direkte sondern auch strukturelle Gewalt, wie Johan Galtung das nannte.
1972 gab es noch keine "Frauenstudien", geschweige denn "Gender-Studien" an deutschen Hochschulen. Aber es gab hier und dort Kolleginnen, die sich als Feministinnen verstanden und den Spielraum, den sie im Rahmen ihrer Disziplin – Soziologie, Geschichte, Psychologie, Volkswirtschaft usw. hatten - nutzten, um die "Frauenfrage" zu thematisieren. Ich tat dies im Rahmen meiner Studienschwerpunkte Familiensoziologie und Soziologie gesellschaftlicher Minderheiten an der Fachhochschule Köln, Fachbereich Sozialpädagogik.
Mir war schon klar geworden, dass wir - die Frauen der Frauenbewegung - aber auch die Öffentlichkeit keine Ahnung mehr hatten über die Existenz und die Leistungen der älteren Frauenbewegung, die schon während der Französischen Revolution begonnen hatte. Obwohl die Anfänge der Sozialarbeit und Sozialpädagogik auf die Kämpfe der Frauen im 19. Jh. um das Recht auf eine bezahlte Berufstätigkeit zurückgingen, wurde diese Tatsache in den geschichtlichen Darstellungen über die Sozialpädagogik nicht beachtet. Erst als Feministinnen anfingen, diese frühe Geschichte in lokalen Studien zu erforschen, wurde der Beitrag der Frauen zur Schaffung dieses Berufsfeldes deutlich (Meyer-Renschhausen. "Soziologie, Soziale Arbeit und Frauenbewegung – eine Art Familiengeschichte". In: Feministische Studien, 12. Jg. 1994, S. 17-32; Ostbomk-Fischer, 2005: Historische und gegenwärtige Entwicklungen in der Sozialpädagogik, Frauen handeln. Männer schreiben ihre Geschichte. FH Köln, Skript 8).
Im Wesentlichen war es so, wie die Kollegin Elke Ostbomk-Fischer heute noch kritisiert: Die Frauen machen die Geschichte, aber die Männer schreiben sie.
Um dieses Geschichtsdefizit aufzuheben, entstand an vielen Hochschulen das, was "Her-Story"-Kurse, im Gegensatz zu "His-Story" genannt wurde, was meist aus dem Studium großer Männer bestand: Feldherren, Könige, Kaiser und ihrer Kriege. Die Alltagsgeschichte, die Geschichte der Frauen kam nicht vor. Dieses Defizit wollte ich beheben.
Von 1974-1977 führte ich Seminare zur "Geschichte der Internationalen Frauenbewegung" durch. Ich war u.a. inspiriert durch die 1. internationale UN-Frauenkonferenz in Mexiko 1975. Damals begannen viele Studentinnen, sich für die Frauenbewegung zu interessieren. Wir stellten fest, dass wir kaum etwas über die alte Frauenbewegung in Europa, geschweige denn über die Bewegungen in anderen Teilen der Welt wussten.
Nach einem solchen Seminar über die Frauenbewegung im 19. und frühen 20. Jahrhundert bemerkten einige Studentinnen mit Erstaunen, dass viele unserer heutigen Probleme und Forderungen schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts von Feministinnen artikuliert worden waren. Warum war die Frauenbefreiung nicht weitergekommen? Warum war die Frauenbewegung in der Weimarer Republik eingeschlafen? Warum hatten wir ihre Geschichte vergessen?
"Das soll nicht noch einmal passieren", sagten diese Studentinnen - es waren fünfzehn. Sie bildeten eine Gruppe und überlegten, was sie zusammen machen könnten. Eins war bald klar, sie wollten weder eine bloße Selbsterfahrungsgruppe noch ein loser Gesprächskreis sein, sondern wollten die Inhalte, über die sie in Gesprächskreisen reflektiert hatten, praktisch-politisch umsetzen. Da war vor allem die Erfahrung der Gewalt: Um diese Zeit war von Erin Pizzi das erste Haus für geprügelte Frauen im Londoner Stadtteil Chiswick errichtet worden. Die Studentinnen beschlossen, auch in Köln ein Haus für geschlagene Frauen zu gründen.
Um diese Aktion in die Wege zu leiten, ging eine "Abordnung" der Studentinnengruppe zum Sozialamt und trug dem damaligen Sozialdezernenten, Herrn Körner, ihr Anliegen vor. Herr Körner jedoch meinte, in Köln bestünde kein Bedarf für ein solches Frauenhaus, denn bei den bestehenden Einrichtungen der Stadt und den freien Trägern tauchten solche Frauen ja nicht auf. Die Studentinnen sollten erst einmal eine Untersuchung über das Ausmaß der privaten Gewalt gegen Frauen vorlegen, um den Bedarf für ein solches Krisenzentrum nachzuweisen. Es war klar, dass durch eine solche Untersuchung das Problem erst einmal auf die lange Bank geschoben werden sollte.
Als die Studentinnen von diesem Gespräch berichteten, beschlossen wir, statt einer Untersuchung eine Straßenaktion zum Thema "Prügelnde Männer" durchzuführen. Denn erstens hatten wir kein Geld für eine langwierige Untersuchung, zweitens wussten wir, dass die Ergebnisse einer solchen Untersuchung häufig die Wirklichkeit nicht widerspiegeln und drittens keineswegs zur sozialen oder politischen Veränderung führen.
Wir führten die Straßenaktion an einem verkaufsoffenen Samstag zu Beginn des Sommersemesters 1976 in der Schildergasse durch. Wir hatten Plakate gemalt, Zeitungsausschnitte gesammelt und aufgeklebt. Wir führten Gespräche mit PassantInnen über die Frage, ob sie wüssten, dass in Köln Frauen von ihren Männern geprügelt würden, ob sie dächten, dass dies ein ernstes Problem sei und dass Köln ein Haus für geschlagene Frauen brauche. Der Sozialdezernent habe behauptet, dieses Problem gäbe es nicht. Die Menschen erzählten von vielen ihnen bekannten Fällen von geprügelten Frauen. Wir baten sie dann, einen Aufruf zu unterschreiben, auf dem erstens die Gewalt gegen Frauen in den Familien als Problem offen dargestellt wurde und zweitens die Forderung nach Einrichtung eines Schutzhauses für geprügelte Frauen erhoben wurde. Wir nahmen die Berichte der Menschen über prügelnde Männer auf Kassetten auf. An diesem Tag sammelten wir 2000 Unterschriften für die Gründung eines Frauenhauses.
Eine befreundete Journalistin des Stadtanzeigers nahm an dieser Aktion teil und berichtete am nächsten Tag über unsere Ergebnisse. Gleichzeitig gab sie die Telefonnummer einer Wohngemeinschaft an, in der mehrere der Initiatorinnen dieser Aktion wohnten (die Worringerstraße 18). Unter dieser Telefonnummer sollten sich Frauen melden, die Schutz vor ihren prügelnden Männern suchten. In dem Bericht wurde auch angekündigt, dass sich an einem bestimmten Tag alle die Frauen in der Fachhochschule treffen sollten, die sich für die Errichtung eines Frauenhauses in Köln interessierten, um zu überlegen, wie wir weiter verfahren sollten.
Zu dieser Versammlung erschienen etwa 70 Personen, auch einige Männer kamen. Wir machten ihnen klar, dass ein Haus für geschlagene Frauen erst ein Schutzraum für Frauen sei, zu dem Männer keinen Zutritt haben sollten. Auf dieser Versammlung wurde beschlossen, den Verein Frauen helfen Frauen e.V. (FhF) als Trägerverein für das autonome Frauenhaus Köln zu gründen.
Wir hatten schon eine Konzeption für dieses Frauenhaus ausgearbeitet, die auf dieser Versammlung vorgestellt und verkauft wurde. Das Treffen war der Auslöser für eine rege Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema "Gewalt gegen Frauen". Die aktiven Studentinnen wurden nun dauernd eingeladen, um über die Pläne für ein Frauenhaus zu berichten. Diese Gelegenheiten benutzten wir auch, um Geld für das Frauenhaus zu sammeln.
Um dieselbe Zeit erschien im "Kölner Express" ein Artikel über Christa Thomas, eine damals schon über 70-jährige Bewohnerin der Riehler Heimstätten. Sie forderte von der Stadt, eines der Häuser des Altersheimkomplexes als Zufluchtshaus für geprügelte Frauen zur Verfügung zu stellen, was die Stadtverwaltung natürlich auch gleich ablehnte.
Lie Selter jedoch, eine der Initiatorinnen des Frauenhauses, machte sich sofort auf, um Christa Thomas zu treffen. Christa Thomas und ihre Freundin Anke Rieger schlossen sich daraufhin sofort unserer Initiative "FhF" an und machten aktiv bei allen Veranstaltungen mit. Wir lernten dabei ein weiteres Stück Kölner Frauengeschichte kennen, denn Christa Thomas hatte sich schon nach dem 1. Weltkrieg gegen Krieg und Militarismus gewandt. In den 1950er-Jahren, als es um die Wiederbewaffnung der BRD gegangen war, war sie, die Katholikin, eine vehemente Gegnerin der CDU-Politiker, die Deutschland wieder bewaffnen wollten. Sie wurde sogar verhaftet. Christa Thomas sah einen engen Zusammenhang zwischen öffentlichem Militarismus und privater Männergewalt gegen Frauen.
Bis zu ihrem Tod blieb sie eine Kämpferin für Frieden, Abrüstung, gegen die Atom-Energie und das Patriarchat. Wir freuten uns, dass wir mit ihr drei Generationen von Frauen in unserem Verein vereinigt hatten, die "Töchter", die "Mütter" und die "Großmütter". Bei einem Fest feierten wir dies als die Wiedergeburt der Matronen. Christa Thomas hatte viel Material über den alten Matronenkult in der Umgebung von Bonn und Köln gesammelt.
Genauso wichtig wie die Öffentlichkeitsarbeit aber war die Tatsache, dass sofort nachdem die Telefonnummer unseres Vereins in der Zeitung erschienen war, sich Frauen meldeten, die Zuflucht in dem Frauenhaus suchten, das noch gar nicht existierte. Da wir sie nicht zu ihren prügelnden Männern zurückschicken konnten, brachten wir sie - und häufig auch ihre Kinder - vorübergehend in unseren eigenen Wohnungen unter. Das ging den ganzen Sommer 1976 so und die Lage wurde immer schwieriger. Der Verein FhF war gegründet, hatte aber kein Geld, kein Haus, keine bezahlten Mitarbeiterinnen.
Aber das Problem der prügelnden Männer, der privaten Gewalt gegen Frauen in den Familien war nach unserer Straßenaktion auf dem Tisch, war öffentlich gemacht worden. Die Stadt Köln, bzw. das Sozialamt konnte nicht mehr behaupten, es gebe dieses Problem in Köln nicht. Wir, d.h. der Verein, führten während der ganzen Zeit Verhandlungen mit der Stadt Köln über die Bereitstellung eines Hauses für geschlagene Frauen. Gleichzeitig berichteten wir fortlaufend, wie viele Frauen bereits bei uns Zuflucht suchten. Die Stadtverwaltung geriet durch das Gewicht der Tatsachen und die breite Öffentlichkeit, die dieses Thema erreichte, immer mehr unter Druck.
Sie entschloss sich schließlich, selbst eine Untersuchung in den städtischen und freien Einrichtungen über die Zahl der Frauen durchzuführen, die dort Zuflucht vor gewalttätigen Männern suchen. Am Ende des Sommers 1976 legte die Stadtverwaltung ihre Ergebnisse vor. Sie musste feststellen, dass durchschnittlich 100 Frauen monatlich bei der Polizei und den sozialen Einrichtungen auftauchen, die Schutz vor Männergewalt suchten, dass diese Klagen aber nicht behandelt werden konnten, weil Gewalt in der Familie als Privatangelegenheit galt und die Polizei die Frauen wieder zu ihrem gewalttätigen Männern zurückschicken musste, wenn die Frau keine formelle Anklage gegen den Mann erhob, was selten der Fall war.
Nach dieser Untersuchung stand die Stadt nun unter politischem Handlungsdruck, vor allem auch deshalb, weil Frauen aus den Kirchen, Frauen der SPD und die Presse sich für den Verein FhF engagierten. Der Verein war inzwischen weit über Köln hinaus bekannt geworden. In verschiedenen anderen Städten gründeten Frauengruppen ebenfalls Vereine mit dem Namen "Frauen helfen Frauen e.V.".
Eine unserer wichtigen Aktionen war ein Wohltätigkeitskonzert, das die Gruppe BLÄCK FÖSS für den FhF in der "Flora" gaben. Dieses Konzert gab uns Gelegenheit, die Ziele unseres Vereins und unsere Konzeption, einem breiten Publikum bekannt zu machen. Außerdem lieferte uns dieses Konzert einen ersten finanziellen Grundstock, den wir für den Kampf um ein Frauenhaus brauchten.
Unsere Verhandlungen mit der Stadt gestalteten sich auch deshalb als schwierig, weil wir darauf bestanden, dass nach unserer Konzeption ein Frauenhaus keine weitere soziale Einrichtung sein sollte, dass die Frauen, die dort Zuflucht suchten, keine Sozialfälle seien, die unter der Verwaltung und Kontrolle der Sozialbehörde stünden und dass die Stadt darum kein Recht habe, Belegzahlen und -plätze festzulegen oder gar Berichte über die Frauen anzufordern. Wir bestanden darauf, dass das Frauenhaus eine autonome Einrichtung sei, in der erwachsene Frauen, die sich in einer akuten Notlage befanden, ihr Leben selbständig, gemeinsam und solidarisch organisierten. Die Rolle des Vereins und der Sozialpädagoginnen war lediglich die von Initiatorinnen, Vermittlerinnen und Unterstützerinnen.
Getreu den von uns vertretenen Prinzipien der Basisdemokratie verhandelten immer verschiedene Frauen des Vereins mit der Sozialbehörde. Wir wollten, dass alle Frauen die Erfahrung machen sollten, mit der Bürokratie zu tun zu haben. Auch das war ein Ärgernis für die Stadt. Die zuständigen Beamten fanden es ärgerlich mit stets anderen, jungen Studentinnen verhandeln zu müssen, anstatt mit einer gestandenen, "potenten" Vorstandsfrau, wie sie sich ausdrückten. Außerdem verlangte die Stadt, dass sich der Verein FhF einem etablierten Trägerverband anschloss. Daraufhin traten wir dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) bei.
All diese Manöver und Reibereien hatten den Effekt, dass die Zeit verging und ein Haus für geschlagene Frauen in Köln auch im Herbst 1976 noch nicht in Sicht war. Es war zwar versprochen worden, aber niemand wusste, wann die Stadt ihr Versprechen einhalten würde. Und immer mehr Frauen riefen bei uns an, die Zuflucht vor prügelnden Männern suchten.
Da die Situation so nicht mehr durchzuhalten war, beschlossen wir, dass der Verein FhF selbst ein Haus mieten sollte. Die Frauen, die dort Zuflucht suchten, sollten eine Einheitsmiete zahlen, die sie vom Sozialamt einfordern sollten. Auf diese Weise musste die Stadt dann doch für das Frauenhaus zahlen.
Ein erster Erfolg der Aktion gegen Gewalt gegen Frauen war nämlich gewesen, dass die Tatsache, dass eine Frau Zuflucht bei dem Verein FhF suchte, für die Sozialbehörde ausreichte, um "Hilfe in besonderen Lebenslagen" (§ 72 BSHG) zu gewähren, dazu gehörte die Zahlung von Sozialhilfe und eines Mietbeitrags.
Das Haus – es war ein zum Abriss freigegebenes Haus einer ehemaligen Wohngemeinschaft in Dellbrück - wurde angemietet und mit Hilfe von vielen FreundInnen, SympathisantInnen, den betroffenen Frauen und den Vereinsmitgliedern mit Möbeln, Wäsche, Hausrat usw. eingerichtet. Im November 1976 wurde es bezogen. Und vom ersten Augenblick an war es überfüllt mit Frauen und ihren Kindern.
Die Stadt war - wiederum - vor vollendete Tatsachen gestellt worden und musste sich nun selbst darum kümmern, eines ihrer Häuser für den Verein FhF zur Verfügung zu stellen. Im Dezember 1976 beschloss der Rat außerdem, eine Stelle für eine Sozialpädagogin zu finanzieren, die die Frauen im Frauenhaus betreuen sollte.
Da die Studentinnen, die die Initiative zur Gründung des autonomen Frauenhauses Köln gestartet hatten, um diese Zeit ihr Studium beendeten und eine Anerkennungsstelle suchten, teilten sich vier von ihnen diese eine Stelle und arbeiteten im Frauenhaus. Bis es aber soweit war, dass die Stelle bezahlt wurde, vergingen Wochen und Monate. Während dieser Zeit hatte der Verein einen Tag- und Nacht-Dienst eingerichtet, der unentgeltlich von den Vereinsfrauen wahrgenommen wurde. Es schien uns notwendig, dass dauernd Frauen im Haus waren, die nicht verprügelt worden waren. Denn es bestand die Gefahr, dass die gewalttätigen Männer ihre Frauen suchen und mit Gewalt zurückholen würden. Aus diesem Grunde wurde nicht nur die Adresse geheim gehalten, es musste auch ein umständliches Verfahren durchgeführt werden, um eine bedrohte Frau im Frauenhaus unterbringen zu können. Sie musste sich mit den Frauen vom Verein an einem bestimmten Ort treffen, und wurde erst dann ins Frauenhaus gebracht. Häufig mussten Wertsachen, Papiere, Kinder in Nacht und Nebel-Aktionen aus der Wohnung der Frauen geschafft werden. Für solche Aktionen waren immer mehrere Vereinsfrauen erforderlich.
Während dieses "Dienstes" im Frauenhaus erlebte ich, dass die Frauen, die dort Zuflucht suchten, Tag und Nacht über ihre Gewalterfahrungen, über die Frage, warum ihre Männer so gewalttätig waren, reden wollten. Sie brauchten uns, um sich ihre oft unglaublichen Gewaltgeschichten von der Seele zu reden. Nach einer Zeit wurde mir klar, dass dieses Reden Teil ihres Heilungsprozesses war. Ich schlug vor, die Lebensgeschichten der Frauen aufzuzeichnen. Wir versuchten herauszufinden, wann die "Gewaltkarriere" in den Familien begann, wie die Frauen damit umgingen, warum sie sich oft so lange diesen Grausamkeiten aussetzten und schließlich, wann sie anfingen, die Situation zu verändern.
Eine Gruppe von Studentinnen nahm sich die Aufzeichnung und Aufarbeitung dieser Lebensgeschichten als Projekt vor. Es war als Aktionsforschungsprojekt konzipiert, durch das wir nicht nur Aufschluss über die "Gewaltkarrieren" deutscher Familien gewinnen wollten, sondern auch den betroffenen Frauen helfen wollten, ihre eigenen Situation zu verstehen und zu verändern.
Die Lebensgeschichten und die Ergebnisse des Projekts wurden später in dem Buch "Nachrichten aus dem Ghetto Liebe" (1) veröffentlicht. Die Lebensgeschichten selbst halfen vielen Frauen bei Behörden und Anwälten ihre eigene Sache besser zu vertreten. Den Studentinnen ging bei diesem Projekt der Zusammenhang zwischen dem, was bei uns "Liebe" genannt wird und der Männergewalt auf. Ich verarbeitete diese Erfahrungen in dem Aufsatz: "Methodische Postulate zur Frauenforschung" (2), der 1978 erstmalig erschien. Wichtigste Erkenntnisse dieser praktischen und theoretischen Arbeit waren, dass frau eine Situation verändern muss, wenn frau sie richtig erkennen will. Die Frauen, die Zuflucht im Frauenhaus suchten, hätten bei einer Standardbefragung nie ihre Gewalterfahrungen zugegeben. Erst die Veränderung ihres Elends versetzte sie in die Lage, offen über ihre Erlebnisse zu erzählen.
Das Frauenhaus Köln war das erste autonome Frauenhaus in der BRD, das ohne staatliche Unterstützung gegründet wurde. In Berlin war vorher schon ein Frauenhaus mit Unterstützung des Familienministeriums entstanden. Auch nachdem sich die Stadt Köln später bereit erklärte, ein Haus zur Verfügung zu stellen und Stellen zu bewilligen, hielt der Verein an den Zielen der autonomen Frauenbewegung fest. Und in der BRD entstanden viele andere Vereine "Frauen helfen Frauen", die denselben autonomen Ansatz verfolgten. Das Problem der privaten Männergewalt war öffentlich, d.h. politisch gemacht worden.
Fussnoten:
1 Nachrichten aus dem Ghetto der Liebe. Gewalt gegen Frauen, hg. v. Frauenhaus Köln, Frankfurt 1980 (vergriffen)
2 Mies, Maria: Methodische Postulate zur Frauenforschung – dargestellt am Problem der Gewalt gegen Frauen, in: Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis Nr. 1, München 1978, S. 41-63.
Erstveröffentlichung in "INFOBRIEF gegen Konzernherrschaft und neoliberale Politik", Titel: "Frauen, die letzte Kolonie", Ausgabe 24, November 2006
Das Netzwerk gegen Konzernherrschaft und neoliberale Politik ist im August 1999 aus dem Komitee "Widerstand gegen das M A I" entstanden. Das erste Ziel des Netzwerkes bestand darin, über die sog. Milleniumrunde der Welthandelsorganisation (WTO) Ende November bis Anfang Dezember 1999 in Seattle zu informieren und dagegen zu mobilisieren. Die Betreiber dieser Millenniumrunde verfolgten und verfolgen immer noch die gleichen anti-demokratischen Ziele wie im vorher zu Fall gebrachten M A I. Die Konzernherrschaft in allen Ländern der Welt soll durch weitere Liberalisierungen, Deregulierungen und Privatisierungen auf Dauer etabliert werden. Längst werden diese Bestrebungen - nach dem Desaster in Seattle - auf anderen Ebenen fortgeführt (z.B. auf EU-Ebene, national und lokal). Daher ist es unerlässlich, weiterhin über diese Vorgänge zu informieren, dagegen zu mobilisieren und vor allem lokal "vor Ort" dagegen zu kämpfen. Zur Information und Mobilisierung gab das Netzwerk in unregelmäßigen Abständen (zwei bis dreimal jährlich) bis 2012 den "Infobrief gegen Konzernherrschaft und neoliberale Politik" heraus. Heute geht es mit dem Kampf gegen TTIP, CETA und TISA weiter.
Online-Flyer Nr. 553 vom 16.03.2016
Druckversion
Arbeit und Soziales
Feminismus im Spannungsfeld von Patriarchat und Kapital
Was haben wir gewollt, was ist daraus geworden? (1)
Von Maria Mies
Die internationale Frauenbewegung ist der Geburtsort revolutionärer Ideen. Samenkörner, die aufzugehen in diesem kapitalistischen System zu verhindern gesucht werden. Warum gibt es auf der ganzen Welt Gewalt gegen Frauen, in allen Kulturen, in allen Gesellschaftsschichten? Was für Zusammenhänge finden sich in einem Gesellschaftssystem, das nur Ware und Konsum als glücklich machend verheißt, in dem Menschen selbst zu Waren und Konsumgütern werden? Wir eröffnen eine Reihe mit Texten der Soziologie- und Gesellschaftswissenschaftlerin, Prof. Maria Mies, deren wichtigstes Buch „Patriarchat und Kapital“ erst kürzlich neu aufgelegt worden ist. Die einleitenden drei Artikel (in Folge) erschienen in dem von Maria Mies gegründeten „Infobrief gegen Konzernherrschaft und neoliberale Politik“. Hier Teil 1 mit der Fragestellung: was haben wir gewollt?
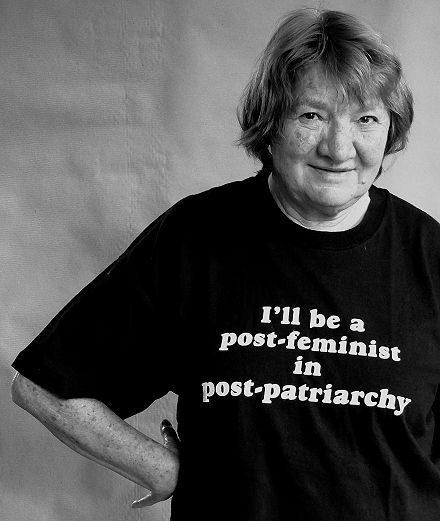
Maria Mies, 2008 (Foto: arbeiterfotografie.com)
Köln, das erste autonome Frauenhaus in Deutschland
Mein Zugang zur Frauenbewegung war nicht die Frage der Gleichheit zwischen Männern und Frauen, die in unserer Verfassung zwar gefordert aber bis heute nirgendwo eingelöst ist sondern die Gewaltfrage. Diese Frage hatte sich mir während meiner Forschungen über indische Frauen schon aufgedrängt. (1968-1970). Dabei entdeckte ich nicht nur, dass es ein System namens Patriarchat gibt, sondern auch, dass dieses Patriarchat nicht nur in Indien existierte sondern auch in Deutschland. Hier äußerte es sich zwar nicht in Kinderheiraten und Witwenverbrennungen, wohl aber in der Gewalt gegen Frauen und Kinder und in frauendiskriminierenden Gesetzen. Diese Gewalt war in Deutschland nicht nur direkte sondern auch strukturelle Gewalt, wie Johan Galtung das nannte.
1972 gab es noch keine "Frauenstudien", geschweige denn "Gender-Studien" an deutschen Hochschulen. Aber es gab hier und dort Kolleginnen, die sich als Feministinnen verstanden und den Spielraum, den sie im Rahmen ihrer Disziplin – Soziologie, Geschichte, Psychologie, Volkswirtschaft usw. hatten - nutzten, um die "Frauenfrage" zu thematisieren. Ich tat dies im Rahmen meiner Studienschwerpunkte Familiensoziologie und Soziologie gesellschaftlicher Minderheiten an der Fachhochschule Köln, Fachbereich Sozialpädagogik.
Mir war schon klar geworden, dass wir - die Frauen der Frauenbewegung - aber auch die Öffentlichkeit keine Ahnung mehr hatten über die Existenz und die Leistungen der älteren Frauenbewegung, die schon während der Französischen Revolution begonnen hatte. Obwohl die Anfänge der Sozialarbeit und Sozialpädagogik auf die Kämpfe der Frauen im 19. Jh. um das Recht auf eine bezahlte Berufstätigkeit zurückgingen, wurde diese Tatsache in den geschichtlichen Darstellungen über die Sozialpädagogik nicht beachtet. Erst als Feministinnen anfingen, diese frühe Geschichte in lokalen Studien zu erforschen, wurde der Beitrag der Frauen zur Schaffung dieses Berufsfeldes deutlich (Meyer-Renschhausen. "Soziologie, Soziale Arbeit und Frauenbewegung – eine Art Familiengeschichte". In: Feministische Studien, 12. Jg. 1994, S. 17-32; Ostbomk-Fischer, 2005: Historische und gegenwärtige Entwicklungen in der Sozialpädagogik, Frauen handeln. Männer schreiben ihre Geschichte. FH Köln, Skript 8).
Im Wesentlichen war es so, wie die Kollegin Elke Ostbomk-Fischer heute noch kritisiert: Die Frauen machen die Geschichte, aber die Männer schreiben sie.
Um dieses Geschichtsdefizit aufzuheben, entstand an vielen Hochschulen das, was "Her-Story"-Kurse, im Gegensatz zu "His-Story" genannt wurde, was meist aus dem Studium großer Männer bestand: Feldherren, Könige, Kaiser und ihrer Kriege. Die Alltagsgeschichte, die Geschichte der Frauen kam nicht vor. Dieses Defizit wollte ich beheben.
Von 1974-1977 führte ich Seminare zur "Geschichte der Internationalen Frauenbewegung" durch. Ich war u.a. inspiriert durch die 1. internationale UN-Frauenkonferenz in Mexiko 1975. Damals begannen viele Studentinnen, sich für die Frauenbewegung zu interessieren. Wir stellten fest, dass wir kaum etwas über die alte Frauenbewegung in Europa, geschweige denn über die Bewegungen in anderen Teilen der Welt wussten.
Nach einem solchen Seminar über die Frauenbewegung im 19. und frühen 20. Jahrhundert bemerkten einige Studentinnen mit Erstaunen, dass viele unserer heutigen Probleme und Forderungen schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts von Feministinnen artikuliert worden waren. Warum war die Frauenbefreiung nicht weitergekommen? Warum war die Frauenbewegung in der Weimarer Republik eingeschlafen? Warum hatten wir ihre Geschichte vergessen?
"Das soll nicht noch einmal passieren", sagten diese Studentinnen - es waren fünfzehn. Sie bildeten eine Gruppe und überlegten, was sie zusammen machen könnten. Eins war bald klar, sie wollten weder eine bloße Selbsterfahrungsgruppe noch ein loser Gesprächskreis sein, sondern wollten die Inhalte, über die sie in Gesprächskreisen reflektiert hatten, praktisch-politisch umsetzen. Da war vor allem die Erfahrung der Gewalt: Um diese Zeit war von Erin Pizzi das erste Haus für geprügelte Frauen im Londoner Stadtteil Chiswick errichtet worden. Die Studentinnen beschlossen, auch in Köln ein Haus für geschlagene Frauen zu gründen.
Um diese Aktion in die Wege zu leiten, ging eine "Abordnung" der Studentinnengruppe zum Sozialamt und trug dem damaligen Sozialdezernenten, Herrn Körner, ihr Anliegen vor. Herr Körner jedoch meinte, in Köln bestünde kein Bedarf für ein solches Frauenhaus, denn bei den bestehenden Einrichtungen der Stadt und den freien Trägern tauchten solche Frauen ja nicht auf. Die Studentinnen sollten erst einmal eine Untersuchung über das Ausmaß der privaten Gewalt gegen Frauen vorlegen, um den Bedarf für ein solches Krisenzentrum nachzuweisen. Es war klar, dass durch eine solche Untersuchung das Problem erst einmal auf die lange Bank geschoben werden sollte.
Als die Studentinnen von diesem Gespräch berichteten, beschlossen wir, statt einer Untersuchung eine Straßenaktion zum Thema "Prügelnde Männer" durchzuführen. Denn erstens hatten wir kein Geld für eine langwierige Untersuchung, zweitens wussten wir, dass die Ergebnisse einer solchen Untersuchung häufig die Wirklichkeit nicht widerspiegeln und drittens keineswegs zur sozialen oder politischen Veränderung führen.
Wir führten die Straßenaktion an einem verkaufsoffenen Samstag zu Beginn des Sommersemesters 1976 in der Schildergasse durch. Wir hatten Plakate gemalt, Zeitungsausschnitte gesammelt und aufgeklebt. Wir führten Gespräche mit PassantInnen über die Frage, ob sie wüssten, dass in Köln Frauen von ihren Männern geprügelt würden, ob sie dächten, dass dies ein ernstes Problem sei und dass Köln ein Haus für geschlagene Frauen brauche. Der Sozialdezernent habe behauptet, dieses Problem gäbe es nicht. Die Menschen erzählten von vielen ihnen bekannten Fällen von geprügelten Frauen. Wir baten sie dann, einen Aufruf zu unterschreiben, auf dem erstens die Gewalt gegen Frauen in den Familien als Problem offen dargestellt wurde und zweitens die Forderung nach Einrichtung eines Schutzhauses für geprügelte Frauen erhoben wurde. Wir nahmen die Berichte der Menschen über prügelnde Männer auf Kassetten auf. An diesem Tag sammelten wir 2000 Unterschriften für die Gründung eines Frauenhauses.
Eine befreundete Journalistin des Stadtanzeigers nahm an dieser Aktion teil und berichtete am nächsten Tag über unsere Ergebnisse. Gleichzeitig gab sie die Telefonnummer einer Wohngemeinschaft an, in der mehrere der Initiatorinnen dieser Aktion wohnten (die Worringerstraße 18). Unter dieser Telefonnummer sollten sich Frauen melden, die Schutz vor ihren prügelnden Männern suchten. In dem Bericht wurde auch angekündigt, dass sich an einem bestimmten Tag alle die Frauen in der Fachhochschule treffen sollten, die sich für die Errichtung eines Frauenhauses in Köln interessierten, um zu überlegen, wie wir weiter verfahren sollten.
Zu dieser Versammlung erschienen etwa 70 Personen, auch einige Männer kamen. Wir machten ihnen klar, dass ein Haus für geschlagene Frauen erst ein Schutzraum für Frauen sei, zu dem Männer keinen Zutritt haben sollten. Auf dieser Versammlung wurde beschlossen, den Verein Frauen helfen Frauen e.V. (FhF) als Trägerverein für das autonome Frauenhaus Köln zu gründen.
Wir hatten schon eine Konzeption für dieses Frauenhaus ausgearbeitet, die auf dieser Versammlung vorgestellt und verkauft wurde. Das Treffen war der Auslöser für eine rege Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema "Gewalt gegen Frauen". Die aktiven Studentinnen wurden nun dauernd eingeladen, um über die Pläne für ein Frauenhaus zu berichten. Diese Gelegenheiten benutzten wir auch, um Geld für das Frauenhaus zu sammeln.
Um dieselbe Zeit erschien im "Kölner Express" ein Artikel über Christa Thomas, eine damals schon über 70-jährige Bewohnerin der Riehler Heimstätten. Sie forderte von der Stadt, eines der Häuser des Altersheimkomplexes als Zufluchtshaus für geprügelte Frauen zur Verfügung zu stellen, was die Stadtverwaltung natürlich auch gleich ablehnte.
Lie Selter jedoch, eine der Initiatorinnen des Frauenhauses, machte sich sofort auf, um Christa Thomas zu treffen. Christa Thomas und ihre Freundin Anke Rieger schlossen sich daraufhin sofort unserer Initiative "FhF" an und machten aktiv bei allen Veranstaltungen mit. Wir lernten dabei ein weiteres Stück Kölner Frauengeschichte kennen, denn Christa Thomas hatte sich schon nach dem 1. Weltkrieg gegen Krieg und Militarismus gewandt. In den 1950er-Jahren, als es um die Wiederbewaffnung der BRD gegangen war, war sie, die Katholikin, eine vehemente Gegnerin der CDU-Politiker, die Deutschland wieder bewaffnen wollten. Sie wurde sogar verhaftet. Christa Thomas sah einen engen Zusammenhang zwischen öffentlichem Militarismus und privater Männergewalt gegen Frauen.
Bis zu ihrem Tod blieb sie eine Kämpferin für Frieden, Abrüstung, gegen die Atom-Energie und das Patriarchat. Wir freuten uns, dass wir mit ihr drei Generationen von Frauen in unserem Verein vereinigt hatten, die "Töchter", die "Mütter" und die "Großmütter". Bei einem Fest feierten wir dies als die Wiedergeburt der Matronen. Christa Thomas hatte viel Material über den alten Matronenkult in der Umgebung von Bonn und Köln gesammelt.
Genauso wichtig wie die Öffentlichkeitsarbeit aber war die Tatsache, dass sofort nachdem die Telefonnummer unseres Vereins in der Zeitung erschienen war, sich Frauen meldeten, die Zuflucht in dem Frauenhaus suchten, das noch gar nicht existierte. Da wir sie nicht zu ihren prügelnden Männern zurückschicken konnten, brachten wir sie - und häufig auch ihre Kinder - vorübergehend in unseren eigenen Wohnungen unter. Das ging den ganzen Sommer 1976 so und die Lage wurde immer schwieriger. Der Verein FhF war gegründet, hatte aber kein Geld, kein Haus, keine bezahlten Mitarbeiterinnen.
Aber das Problem der prügelnden Männer, der privaten Gewalt gegen Frauen in den Familien war nach unserer Straßenaktion auf dem Tisch, war öffentlich gemacht worden. Die Stadt Köln, bzw. das Sozialamt konnte nicht mehr behaupten, es gebe dieses Problem in Köln nicht. Wir, d.h. der Verein, führten während der ganzen Zeit Verhandlungen mit der Stadt Köln über die Bereitstellung eines Hauses für geschlagene Frauen. Gleichzeitig berichteten wir fortlaufend, wie viele Frauen bereits bei uns Zuflucht suchten. Die Stadtverwaltung geriet durch das Gewicht der Tatsachen und die breite Öffentlichkeit, die dieses Thema erreichte, immer mehr unter Druck.
Sie entschloss sich schließlich, selbst eine Untersuchung in den städtischen und freien Einrichtungen über die Zahl der Frauen durchzuführen, die dort Zuflucht vor gewalttätigen Männern suchen. Am Ende des Sommers 1976 legte die Stadtverwaltung ihre Ergebnisse vor. Sie musste feststellen, dass durchschnittlich 100 Frauen monatlich bei der Polizei und den sozialen Einrichtungen auftauchen, die Schutz vor Männergewalt suchten, dass diese Klagen aber nicht behandelt werden konnten, weil Gewalt in der Familie als Privatangelegenheit galt und die Polizei die Frauen wieder zu ihrem gewalttätigen Männern zurückschicken musste, wenn die Frau keine formelle Anklage gegen den Mann erhob, was selten der Fall war.
Nach dieser Untersuchung stand die Stadt nun unter politischem Handlungsdruck, vor allem auch deshalb, weil Frauen aus den Kirchen, Frauen der SPD und die Presse sich für den Verein FhF engagierten. Der Verein war inzwischen weit über Köln hinaus bekannt geworden. In verschiedenen anderen Städten gründeten Frauengruppen ebenfalls Vereine mit dem Namen "Frauen helfen Frauen e.V.".
Eine unserer wichtigen Aktionen war ein Wohltätigkeitskonzert, das die Gruppe BLÄCK FÖSS für den FhF in der "Flora" gaben. Dieses Konzert gab uns Gelegenheit, die Ziele unseres Vereins und unsere Konzeption, einem breiten Publikum bekannt zu machen. Außerdem lieferte uns dieses Konzert einen ersten finanziellen Grundstock, den wir für den Kampf um ein Frauenhaus brauchten.
Unsere Verhandlungen mit der Stadt gestalteten sich auch deshalb als schwierig, weil wir darauf bestanden, dass nach unserer Konzeption ein Frauenhaus keine weitere soziale Einrichtung sein sollte, dass die Frauen, die dort Zuflucht suchten, keine Sozialfälle seien, die unter der Verwaltung und Kontrolle der Sozialbehörde stünden und dass die Stadt darum kein Recht habe, Belegzahlen und -plätze festzulegen oder gar Berichte über die Frauen anzufordern. Wir bestanden darauf, dass das Frauenhaus eine autonome Einrichtung sei, in der erwachsene Frauen, die sich in einer akuten Notlage befanden, ihr Leben selbständig, gemeinsam und solidarisch organisierten. Die Rolle des Vereins und der Sozialpädagoginnen war lediglich die von Initiatorinnen, Vermittlerinnen und Unterstützerinnen.
Getreu den von uns vertretenen Prinzipien der Basisdemokratie verhandelten immer verschiedene Frauen des Vereins mit der Sozialbehörde. Wir wollten, dass alle Frauen die Erfahrung machen sollten, mit der Bürokratie zu tun zu haben. Auch das war ein Ärgernis für die Stadt. Die zuständigen Beamten fanden es ärgerlich mit stets anderen, jungen Studentinnen verhandeln zu müssen, anstatt mit einer gestandenen, "potenten" Vorstandsfrau, wie sie sich ausdrückten. Außerdem verlangte die Stadt, dass sich der Verein FhF einem etablierten Trägerverband anschloss. Daraufhin traten wir dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) bei.
All diese Manöver und Reibereien hatten den Effekt, dass die Zeit verging und ein Haus für geschlagene Frauen in Köln auch im Herbst 1976 noch nicht in Sicht war. Es war zwar versprochen worden, aber niemand wusste, wann die Stadt ihr Versprechen einhalten würde. Und immer mehr Frauen riefen bei uns an, die Zuflucht vor prügelnden Männern suchten.
Da die Situation so nicht mehr durchzuhalten war, beschlossen wir, dass der Verein FhF selbst ein Haus mieten sollte. Die Frauen, die dort Zuflucht suchten, sollten eine Einheitsmiete zahlen, die sie vom Sozialamt einfordern sollten. Auf diese Weise musste die Stadt dann doch für das Frauenhaus zahlen.
Ein erster Erfolg der Aktion gegen Gewalt gegen Frauen war nämlich gewesen, dass die Tatsache, dass eine Frau Zuflucht bei dem Verein FhF suchte, für die Sozialbehörde ausreichte, um "Hilfe in besonderen Lebenslagen" (§ 72 BSHG) zu gewähren, dazu gehörte die Zahlung von Sozialhilfe und eines Mietbeitrags.
Das Haus – es war ein zum Abriss freigegebenes Haus einer ehemaligen Wohngemeinschaft in Dellbrück - wurde angemietet und mit Hilfe von vielen FreundInnen, SympathisantInnen, den betroffenen Frauen und den Vereinsmitgliedern mit Möbeln, Wäsche, Hausrat usw. eingerichtet. Im November 1976 wurde es bezogen. Und vom ersten Augenblick an war es überfüllt mit Frauen und ihren Kindern.
Die Stadt war - wiederum - vor vollendete Tatsachen gestellt worden und musste sich nun selbst darum kümmern, eines ihrer Häuser für den Verein FhF zur Verfügung zu stellen. Im Dezember 1976 beschloss der Rat außerdem, eine Stelle für eine Sozialpädagogin zu finanzieren, die die Frauen im Frauenhaus betreuen sollte.
Da die Studentinnen, die die Initiative zur Gründung des autonomen Frauenhauses Köln gestartet hatten, um diese Zeit ihr Studium beendeten und eine Anerkennungsstelle suchten, teilten sich vier von ihnen diese eine Stelle und arbeiteten im Frauenhaus. Bis es aber soweit war, dass die Stelle bezahlt wurde, vergingen Wochen und Monate. Während dieser Zeit hatte der Verein einen Tag- und Nacht-Dienst eingerichtet, der unentgeltlich von den Vereinsfrauen wahrgenommen wurde. Es schien uns notwendig, dass dauernd Frauen im Haus waren, die nicht verprügelt worden waren. Denn es bestand die Gefahr, dass die gewalttätigen Männer ihre Frauen suchen und mit Gewalt zurückholen würden. Aus diesem Grunde wurde nicht nur die Adresse geheim gehalten, es musste auch ein umständliches Verfahren durchgeführt werden, um eine bedrohte Frau im Frauenhaus unterbringen zu können. Sie musste sich mit den Frauen vom Verein an einem bestimmten Ort treffen, und wurde erst dann ins Frauenhaus gebracht. Häufig mussten Wertsachen, Papiere, Kinder in Nacht und Nebel-Aktionen aus der Wohnung der Frauen geschafft werden. Für solche Aktionen waren immer mehrere Vereinsfrauen erforderlich.
Während dieses "Dienstes" im Frauenhaus erlebte ich, dass die Frauen, die dort Zuflucht suchten, Tag und Nacht über ihre Gewalterfahrungen, über die Frage, warum ihre Männer so gewalttätig waren, reden wollten. Sie brauchten uns, um sich ihre oft unglaublichen Gewaltgeschichten von der Seele zu reden. Nach einer Zeit wurde mir klar, dass dieses Reden Teil ihres Heilungsprozesses war. Ich schlug vor, die Lebensgeschichten der Frauen aufzuzeichnen. Wir versuchten herauszufinden, wann die "Gewaltkarriere" in den Familien begann, wie die Frauen damit umgingen, warum sie sich oft so lange diesen Grausamkeiten aussetzten und schließlich, wann sie anfingen, die Situation zu verändern.
Eine Gruppe von Studentinnen nahm sich die Aufzeichnung und Aufarbeitung dieser Lebensgeschichten als Projekt vor. Es war als Aktionsforschungsprojekt konzipiert, durch das wir nicht nur Aufschluss über die "Gewaltkarrieren" deutscher Familien gewinnen wollten, sondern auch den betroffenen Frauen helfen wollten, ihre eigenen Situation zu verstehen und zu verändern.
Die Lebensgeschichten und die Ergebnisse des Projekts wurden später in dem Buch "Nachrichten aus dem Ghetto Liebe" (1) veröffentlicht. Die Lebensgeschichten selbst halfen vielen Frauen bei Behörden und Anwälten ihre eigene Sache besser zu vertreten. Den Studentinnen ging bei diesem Projekt der Zusammenhang zwischen dem, was bei uns "Liebe" genannt wird und der Männergewalt auf. Ich verarbeitete diese Erfahrungen in dem Aufsatz: "Methodische Postulate zur Frauenforschung" (2), der 1978 erstmalig erschien. Wichtigste Erkenntnisse dieser praktischen und theoretischen Arbeit waren, dass frau eine Situation verändern muss, wenn frau sie richtig erkennen will. Die Frauen, die Zuflucht im Frauenhaus suchten, hätten bei einer Standardbefragung nie ihre Gewalterfahrungen zugegeben. Erst die Veränderung ihres Elends versetzte sie in die Lage, offen über ihre Erlebnisse zu erzählen.
Das Frauenhaus Köln war das erste autonome Frauenhaus in der BRD, das ohne staatliche Unterstützung gegründet wurde. In Berlin war vorher schon ein Frauenhaus mit Unterstützung des Familienministeriums entstanden. Auch nachdem sich die Stadt Köln später bereit erklärte, ein Haus zur Verfügung zu stellen und Stellen zu bewilligen, hielt der Verein an den Zielen der autonomen Frauenbewegung fest. Und in der BRD entstanden viele andere Vereine "Frauen helfen Frauen", die denselben autonomen Ansatz verfolgten. Das Problem der privaten Männergewalt war öffentlich, d.h. politisch gemacht worden.
Fussnoten:
1 Nachrichten aus dem Ghetto der Liebe. Gewalt gegen Frauen, hg. v. Frauenhaus Köln, Frankfurt 1980 (vergriffen)
2 Mies, Maria: Methodische Postulate zur Frauenforschung – dargestellt am Problem der Gewalt gegen Frauen, in: Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis Nr. 1, München 1978, S. 41-63.
Erstveröffentlichung in "INFOBRIEF gegen Konzernherrschaft und neoliberale Politik", Titel: "Frauen, die letzte Kolonie", Ausgabe 24, November 2006
Das Netzwerk gegen Konzernherrschaft und neoliberale Politik ist im August 1999 aus dem Komitee "Widerstand gegen das M A I" entstanden. Das erste Ziel des Netzwerkes bestand darin, über die sog. Milleniumrunde der Welthandelsorganisation (WTO) Ende November bis Anfang Dezember 1999 in Seattle zu informieren und dagegen zu mobilisieren. Die Betreiber dieser Millenniumrunde verfolgten und verfolgen immer noch die gleichen anti-demokratischen Ziele wie im vorher zu Fall gebrachten M A I. Die Konzernherrschaft in allen Ländern der Welt soll durch weitere Liberalisierungen, Deregulierungen und Privatisierungen auf Dauer etabliert werden. Längst werden diese Bestrebungen - nach dem Desaster in Seattle - auf anderen Ebenen fortgeführt (z.B. auf EU-Ebene, national und lokal). Daher ist es unerlässlich, weiterhin über diese Vorgänge zu informieren, dagegen zu mobilisieren und vor allem lokal "vor Ort" dagegen zu kämpfen. Zur Information und Mobilisierung gab das Netzwerk in unregelmäßigen Abständen (zwei bis dreimal jährlich) bis 2012 den "Infobrief gegen Konzernherrschaft und neoliberale Politik" heraus. Heute geht es mit dem Kampf gegen TTIP, CETA und TISA weiter.
Online-Flyer Nr. 553 vom 16.03.2016
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE