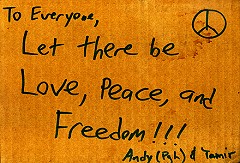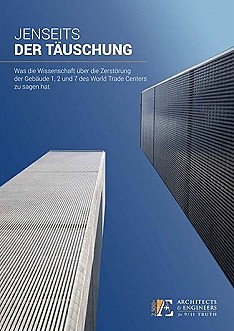SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Literatur
Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Kapitel VI
"Niemandsland"
Von Wolfgang Bittner
Gehe ich bis an die Grenze meines Erinnerungsvermögens, sehe ich Bäume mit hellgefleckten Stämmen, eine steinerne Brücke über den Fluß, einen Hof zwischen hohen Häuserwänden, eine gekalkte Kellerdecke, den Schankraum einer Gastwirtschaft ... Lausche ich weiter in mich hinein, kommen immer mehr Bilder, wie Bruchstücke eines früheren Lebens. Zugleich erinnere ich Soldatenuniformen, Kriegsgerätschaften, bedrohliche Geräusche und Gerüche, die mir Unwohlsein, ja sogar Übelkeit verursachen. Mich friert, die Haut zieht sich zusammen. Und vieles, was früher war, setzt sich bis in die Gegenwart hinein fort; es verursacht dieses unterbewußte Grundgefühl von Heimatlosigkeit. Nur in meinen Aufzeichnungen fühle ich mich geborgen. Vor meinem inneren Auge läuft ein Film ab, aber ich wirke nicht mit, sondern schaue zu.
Aus den Arbeitersiedlungen des Hüttenviertels kommend, führte die Straße entlang der Mauer des Reichsbahnausbesserungswerks unter den alten Platanen in Richtung Innenstadt. Auf der linken Seite vierstöckige Wohn und Geschäftshäuser, in der Nummer 38 eine Metzgerei und die Gastwirtschaft »Zum Haltesignal«. Die schwere Eichentür zum Hausflur stand tagsüber offen. Geradeaus ging eine breite Treppe hinauf zu den oberen Wohnungen, links lag die Küche, rechts der Gastraum. Hinter der Theke mit den Zapfhähnen und umgekehrten Biergläsern stand mein Großvater, ein hochgewachsener wuchtiger Mann mit einem Schnauzbart wie eine Bürste. Er habe, so hieß es, als junger Mann ohne viel Mühe eine mehrere Zentner schwere Rinderhälfte auf dem Rücken in den Keller hinuntertragen können.
Sobald ich Türen zu öffnen verstand, holte ich mir jeden Nachmittag einen Schluck Limonade oder Malzbier ab. Wir wohnten oben im Haus, meine Mutter mit mir und meinem Vater, der fast nie zu Hause war. Er kämpfte in der zunächst noch siegreichen Armee des »Tausendjährigen Reiches«, Heeresabschnitt Süd, an der griechischen Mittelmeerfront. Zum angeblichen Ruhm eines angeblichen Vaterlandes, das schon lange seine Ehre verspielt hatte. In einem Krieg, dessen Beginn vor der Weltöffentlichkeit mit einer Lüge gerechtfertigt worden war: dem vorgetäuschten Überfall auf den Sender Gleiwitz durch polnische Truppen, die sich erst viel später als KZ Häftlinge herausstellten, ermordet in polnischen Uniformen.
Um den Hof standen das Seiten und das Hinterhaus, Werkstätten und ein Garagenschuppen. Dort gab es unter Anleitung älterer Spielgefährten die ersten Fallschirmjägerversuche. Auf der Erde wurde eine Plane ausgebreitet. Das sei sehr weich, man müsse Mut beweisen. Danach waren die Knie verstaucht, und es dauerte mehrere Wochen, bis andere Kriegsspiele stattfinden konnten.
Ich betrachte ein Foto, auf dem eine junge Frau in Rock und Bluse mit einem Kinderwagen zu sehen ist. Meine Mutter. Sie blinzelt in die Sonne und hält ein kleines Kind an der Hand, das bin ich. Daneben ein Brückengeländer. Der Fluß hieß Klodnitz, genannt »Klodka«. Auf einem anderen Foto mein Vater in Uniform mit Orden, Schießschnur und Ehrendolch.
Die Großmutter stand in der Küche. Die Hausschuhe hießen Potschen, die Fußbank wurde Ritsche genannt, der Milchtopf Tippel. »Natsch doch nicht« und »Heb´ deine Kopetten, du Plotsch«. Auf dem Küchentisch wurde Nudelteig ausgerollt und in Streifen geschnitten. Die Großmutter sagte »Herzele«, das sagte sie oft. Der Großvater sagte »Schlawiner«. Oben auf dem Kachelofen war es schön warm, draußen Winter.
An den Sonntagen ging es mit der Bahn nach Auenrode zu Onkel Max und Tante Trudel ins Forsthaus. Oder mit der Straßenbahn über Hindenburg hinüber nach Beuthen zu den anderen Großeltern. Auf dem Tisch stand der Streuselkuchen, auf einer Kommode neben der Balkontür das schwarzumrandete Bild des jüngsten Sohnes, gefallen 1941 in den ersten Tagen des Rußlandfeldzuges. Zwei Söhne waren noch im Krieg. Für alle drei wurde lange und inbrünstig gebetet. »Dieser Irre«, sagte der Großvater, den man vom Schuldienst suspendiert hatte. »Dieser größenwahnsinnige Menschenschlächter.« Die Großmutter legte erschrocken den Finger auf die Lippen und flüsterte: »Wenn dich jemand hört ...«
Bilder wie diese: Meine Mutter steht vor dem geöffneten Kleiderschrank und hält eine schwarzglänzende Pistole in der Hand. Jetzt zieht sie mit der anderen Hand eine Schachtel unter der Wäsche hervor, in der es metallisch klappert. Sie steckt beides in die Taschen ihrer Kostümjacke, die unter dem Gewicht Falten schlägt. Dann nimmt sie mich an der Hand, und wir verlassen die Wohnung. In der Küche hören wir die Großmutter; der Vordereingang ist verbarrikadiert, Querhölzer, abgestützt durch gegen die Treppenstufen verkeilte Balken, unter der Türklinke ein Holzpfahl. Wir gehen durch den hinteren Ausgang über den Hof zum Hinterhaus. Drei, vier Treppen hinauf, eine Wohnungstür, dahinter der Himmel: ein Bombenkrater. Meine Mutter zieht Pistole und Schachtel aus der Tasche, wirft sie in hohem Bogen in die Trümmer.
Im Januar 1945 wurde Schlesien in einer großräumigen Umfassungsoffensive von der sowjetischen Armee eingeschlossen und erobert. Meine Mutter berichtet, sie sei noch zehn Tage vorher bei der Stadtverwaltung und in der Parteizentrale gewesen, um eine Ausreisegenehmigung in den Westen zu beantragen, da wurde sie von den Beamten und NSDAP Funktionären laut ausgelacht. »Die Russen sind weit weg«, wurde gesagt. »Das schaffen die nie. Was meinen Sie, wieviele Truppenverbände von uns dazwischenstehen.« Ohne solche Passierscheine war es unmöglich, auch nur fünfzig Kilometer mit der Bahn zu fahren; andere Transportmöglichkeiten gab es ohnehin nicht mehr.
Wenige Tage später waren Stadtverwaltung und Parteizentrale geschlossen, und die höheren Chargen hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Die Rote Armee marschierte nach heftigen Kämpfen am 21. Januar ein; die Stadt wurde drei Tage lang zur Plünderung freigegeben. Im April folgte die polnische Armee, die Stadt wurde nochmals zur Plünderung freigegeben. Die zurückgebliebene Zivilbevölkerung erlebte die Schreckensherrschaft des Krieges. Und wir mitten darin. Wenn meine Mutter später davon erzählte, was sehr selten vorkam, begann sie immer zu weinen.
Mir ist wenig haften geblieben. Sirenengeheul, die dumpfen Detonationen von Bomben und rieselnder Kalk. Artilleriefeuer, die verbarrikadierten Fenster und Türen, Panzerrasseln, das Knattern der Schüsse. Das Schloß an dem Hoftor wurde aufgeschossen, Soldaten kamen über den Hof und zur Hintertür herein. Fremde Gesichter, Rufe in einer unverständlichen Sprache, Befehle. Die merkwürdig aussehenden Trommeln und Gitterläufe von Maschinenpistolen, die Angst der Erwachsenen. Wie mein Großvater vom Volkssturm zurückgekommen war, sich versteckt hielt, wie er von sowjetischer Militärpolizei abgeholt wurde. Daß er nicht wiederkam - niemals - und daß meine Großmutter blieb, auf ihn zu warten. Hunger, der nagende Hunger. Und die Kälte.
Dann auf dem Dach eines Zuges. Ich sehe die vorbeiziehende Landschaft, Felder, Ortschaften, Brücken, Wald; und ich habe Angst, die Dachschräge hinunterzufallen. Neben und hinter mir sitzen meine Mutter und die Großeltern aus Beuthen mit Decken um die Schultern. Das linke Bein halte ich angewinkelt, so daß es nach unten eine Sperre bildet. Ich lasse eine Dose Kondensmilch hinunterrollen, die jedesmal vom Bein aufgehalten wird, wundere mich, daß meine Mutter sie mir nicht wegnimmt. Plötzlich gibt es einen Ruck, die Dose rollt am Fuß vorbei und verschwindet aus meinem Gesichtsfeld. Am Wagenende klettern Männer herauf, Pistolen und Messer in den Händen. Befehle, Rufe, Schreie. »Uri, Uri! Dawai, dawai!«
Das weiß ich noch, das hat sich irgendwo im Gehirn festgesetzt. Geöffnete Koffer, Schläge, ein Mann wird hinuntergeworfen. Wie der Großvater mit fünf Messerstichen in Brust und Rücken fast verblutet. Daran erinnere ich mich noch. Ich möchte es aber bei dieser Erinnerung belassen.
Gleiwitz, heute Gliwice, eine Stadt mit 200.000 Einwohnern in Polen. Bei meinen Eltern ist das anders. Sie sprechen immer noch von »Zuhause«.

Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München
Der Autor
 Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Online-Flyer Nr. 54 vom 25.07.2006
Druckversion
Literatur
Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Kapitel VI
"Niemandsland"
Von Wolfgang Bittner
Gehe ich bis an die Grenze meines Erinnerungsvermögens, sehe ich Bäume mit hellgefleckten Stämmen, eine steinerne Brücke über den Fluß, einen Hof zwischen hohen Häuserwänden, eine gekalkte Kellerdecke, den Schankraum einer Gastwirtschaft ... Lausche ich weiter in mich hinein, kommen immer mehr Bilder, wie Bruchstücke eines früheren Lebens. Zugleich erinnere ich Soldatenuniformen, Kriegsgerätschaften, bedrohliche Geräusche und Gerüche, die mir Unwohlsein, ja sogar Übelkeit verursachen. Mich friert, die Haut zieht sich zusammen. Und vieles, was früher war, setzt sich bis in die Gegenwart hinein fort; es verursacht dieses unterbewußte Grundgefühl von Heimatlosigkeit. Nur in meinen Aufzeichnungen fühle ich mich geborgen. Vor meinem inneren Auge läuft ein Film ab, aber ich wirke nicht mit, sondern schaue zu.
Aus den Arbeitersiedlungen des Hüttenviertels kommend, führte die Straße entlang der Mauer des Reichsbahnausbesserungswerks unter den alten Platanen in Richtung Innenstadt. Auf der linken Seite vierstöckige Wohn und Geschäftshäuser, in der Nummer 38 eine Metzgerei und die Gastwirtschaft »Zum Haltesignal«. Die schwere Eichentür zum Hausflur stand tagsüber offen. Geradeaus ging eine breite Treppe hinauf zu den oberen Wohnungen, links lag die Küche, rechts der Gastraum. Hinter der Theke mit den Zapfhähnen und umgekehrten Biergläsern stand mein Großvater, ein hochgewachsener wuchtiger Mann mit einem Schnauzbart wie eine Bürste. Er habe, so hieß es, als junger Mann ohne viel Mühe eine mehrere Zentner schwere Rinderhälfte auf dem Rücken in den Keller hinuntertragen können.
Sobald ich Türen zu öffnen verstand, holte ich mir jeden Nachmittag einen Schluck Limonade oder Malzbier ab. Wir wohnten oben im Haus, meine Mutter mit mir und meinem Vater, der fast nie zu Hause war. Er kämpfte in der zunächst noch siegreichen Armee des »Tausendjährigen Reiches«, Heeresabschnitt Süd, an der griechischen Mittelmeerfront. Zum angeblichen Ruhm eines angeblichen Vaterlandes, das schon lange seine Ehre verspielt hatte. In einem Krieg, dessen Beginn vor der Weltöffentlichkeit mit einer Lüge gerechtfertigt worden war: dem vorgetäuschten Überfall auf den Sender Gleiwitz durch polnische Truppen, die sich erst viel später als KZ Häftlinge herausstellten, ermordet in polnischen Uniformen.
Um den Hof standen das Seiten und das Hinterhaus, Werkstätten und ein Garagenschuppen. Dort gab es unter Anleitung älterer Spielgefährten die ersten Fallschirmjägerversuche. Auf der Erde wurde eine Plane ausgebreitet. Das sei sehr weich, man müsse Mut beweisen. Danach waren die Knie verstaucht, und es dauerte mehrere Wochen, bis andere Kriegsspiele stattfinden konnten.
Ich betrachte ein Foto, auf dem eine junge Frau in Rock und Bluse mit einem Kinderwagen zu sehen ist. Meine Mutter. Sie blinzelt in die Sonne und hält ein kleines Kind an der Hand, das bin ich. Daneben ein Brückengeländer. Der Fluß hieß Klodnitz, genannt »Klodka«. Auf einem anderen Foto mein Vater in Uniform mit Orden, Schießschnur und Ehrendolch.
Die Großmutter stand in der Küche. Die Hausschuhe hießen Potschen, die Fußbank wurde Ritsche genannt, der Milchtopf Tippel. »Natsch doch nicht« und »Heb´ deine Kopetten, du Plotsch«. Auf dem Küchentisch wurde Nudelteig ausgerollt und in Streifen geschnitten. Die Großmutter sagte »Herzele«, das sagte sie oft. Der Großvater sagte »Schlawiner«. Oben auf dem Kachelofen war es schön warm, draußen Winter.
An den Sonntagen ging es mit der Bahn nach Auenrode zu Onkel Max und Tante Trudel ins Forsthaus. Oder mit der Straßenbahn über Hindenburg hinüber nach Beuthen zu den anderen Großeltern. Auf dem Tisch stand der Streuselkuchen, auf einer Kommode neben der Balkontür das schwarzumrandete Bild des jüngsten Sohnes, gefallen 1941 in den ersten Tagen des Rußlandfeldzuges. Zwei Söhne waren noch im Krieg. Für alle drei wurde lange und inbrünstig gebetet. »Dieser Irre«, sagte der Großvater, den man vom Schuldienst suspendiert hatte. »Dieser größenwahnsinnige Menschenschlächter.« Die Großmutter legte erschrocken den Finger auf die Lippen und flüsterte: »Wenn dich jemand hört ...«
Bilder wie diese: Meine Mutter steht vor dem geöffneten Kleiderschrank und hält eine schwarzglänzende Pistole in der Hand. Jetzt zieht sie mit der anderen Hand eine Schachtel unter der Wäsche hervor, in der es metallisch klappert. Sie steckt beides in die Taschen ihrer Kostümjacke, die unter dem Gewicht Falten schlägt. Dann nimmt sie mich an der Hand, und wir verlassen die Wohnung. In der Küche hören wir die Großmutter; der Vordereingang ist verbarrikadiert, Querhölzer, abgestützt durch gegen die Treppenstufen verkeilte Balken, unter der Türklinke ein Holzpfahl. Wir gehen durch den hinteren Ausgang über den Hof zum Hinterhaus. Drei, vier Treppen hinauf, eine Wohnungstür, dahinter der Himmel: ein Bombenkrater. Meine Mutter zieht Pistole und Schachtel aus der Tasche, wirft sie in hohem Bogen in die Trümmer.
Im Januar 1945 wurde Schlesien in einer großräumigen Umfassungsoffensive von der sowjetischen Armee eingeschlossen und erobert. Meine Mutter berichtet, sie sei noch zehn Tage vorher bei der Stadtverwaltung und in der Parteizentrale gewesen, um eine Ausreisegenehmigung in den Westen zu beantragen, da wurde sie von den Beamten und NSDAP Funktionären laut ausgelacht. »Die Russen sind weit weg«, wurde gesagt. »Das schaffen die nie. Was meinen Sie, wieviele Truppenverbände von uns dazwischenstehen.« Ohne solche Passierscheine war es unmöglich, auch nur fünfzig Kilometer mit der Bahn zu fahren; andere Transportmöglichkeiten gab es ohnehin nicht mehr.
Wenige Tage später waren Stadtverwaltung und Parteizentrale geschlossen, und die höheren Chargen hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Die Rote Armee marschierte nach heftigen Kämpfen am 21. Januar ein; die Stadt wurde drei Tage lang zur Plünderung freigegeben. Im April folgte die polnische Armee, die Stadt wurde nochmals zur Plünderung freigegeben. Die zurückgebliebene Zivilbevölkerung erlebte die Schreckensherrschaft des Krieges. Und wir mitten darin. Wenn meine Mutter später davon erzählte, was sehr selten vorkam, begann sie immer zu weinen.
Mir ist wenig haften geblieben. Sirenengeheul, die dumpfen Detonationen von Bomben und rieselnder Kalk. Artilleriefeuer, die verbarrikadierten Fenster und Türen, Panzerrasseln, das Knattern der Schüsse. Das Schloß an dem Hoftor wurde aufgeschossen, Soldaten kamen über den Hof und zur Hintertür herein. Fremde Gesichter, Rufe in einer unverständlichen Sprache, Befehle. Die merkwürdig aussehenden Trommeln und Gitterläufe von Maschinenpistolen, die Angst der Erwachsenen. Wie mein Großvater vom Volkssturm zurückgekommen war, sich versteckt hielt, wie er von sowjetischer Militärpolizei abgeholt wurde. Daß er nicht wiederkam - niemals - und daß meine Großmutter blieb, auf ihn zu warten. Hunger, der nagende Hunger. Und die Kälte.
Dann auf dem Dach eines Zuges. Ich sehe die vorbeiziehende Landschaft, Felder, Ortschaften, Brücken, Wald; und ich habe Angst, die Dachschräge hinunterzufallen. Neben und hinter mir sitzen meine Mutter und die Großeltern aus Beuthen mit Decken um die Schultern. Das linke Bein halte ich angewinkelt, so daß es nach unten eine Sperre bildet. Ich lasse eine Dose Kondensmilch hinunterrollen, die jedesmal vom Bein aufgehalten wird, wundere mich, daß meine Mutter sie mir nicht wegnimmt. Plötzlich gibt es einen Ruck, die Dose rollt am Fuß vorbei und verschwindet aus meinem Gesichtsfeld. Am Wagenende klettern Männer herauf, Pistolen und Messer in den Händen. Befehle, Rufe, Schreie. »Uri, Uri! Dawai, dawai!«
Das weiß ich noch, das hat sich irgendwo im Gehirn festgesetzt. Geöffnete Koffer, Schläge, ein Mann wird hinuntergeworfen. Wie der Großvater mit fünf Messerstichen in Brust und Rücken fast verblutet. Daran erinnere ich mich noch. Ich möchte es aber bei dieser Erinnerung belassen.
Gleiwitz, heute Gliwice, eine Stadt mit 200.000 Einwohnern in Polen. Bei meinen Eltern ist das anders. Sie sprechen immer noch von »Zuhause«.

Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München
Der Autor
 Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.Online-Flyer Nr. 54 vom 25.07.2006
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE