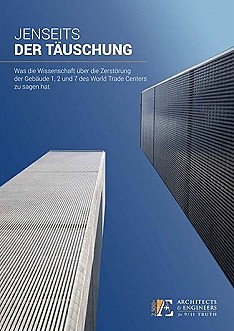SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Literatur
Forsetzungsroman in der NRhZ - Folge 17
Max - Jahrgang 27
Von Lutz Köhlert

Der Buchhalter der Mine, Casals, ist ein mickriges Männchen, vielleicht fünfzig Jahre alt und schon ohne Zähne. Wenn er aufgeregt spricht, was er immer tut, klappt ihm sein Gebiß herunter, und er muß es mit dem Finger wieder festdrücken. Es kommt auch vor, daß es ihm aus dem Mund fällt. Dann hebt er es auf, putzt es am Pullover ab und setzt es mit wackelndem Kiefer wieder ein.
Casals hat einen etwa sieben Jahre alten Sprößling namens André, der schon mal auf der Dorfstraße hinter seinem Vater hergeht, ihm Fledermausohren macht und die Zunge herausstreckt und „Miké! Miké!“ schreit. André fallen mehr Dummheiten ein als er ausführen kann.
Einmal hilft Max beim Erdbeerenpflücken. Casals schichtet die Früchte vorsichtig in einen Korb, den er mit Rhabarberblättern auskleidet und zum Schutz gegen die Hitze mit Blättern zudeckt. André stopft Erdbeeren in sich hinein und langweilt sich. Der muschelförmige Erdbeerkorb sieht wie ein Schaukelsitz aus, die Rhabarberblätter über den Erdbeeren wie ein einladendes Kissen. So sieht es André jedenfalls. Hinter dem Rücken des Vaters läßt er sich sacht auf das Kissen nieder, so daß der rote Saft der Erdbeeren durch das Korbgeflecht wie aus einer Kelter quillt. André beobachtet seinen Vater und bleibt auf dem Sprung.
Als Casals sich umwendet und das Malheur bemerkt, fährt er mit wütendem Geschrei und klapperndem Gebiß auf den Übeltäter zu, der ihm aber leicht und flink entwischt und wieder mit „Miké! Miké!“-Geschrei eine Grimasse schneidet.
Die pädagogischen Wurzeln für dieses bizarre Verhältnis von Vater und Sohn lernt Max wenig später kennen, als er nach dem Holzhacken zum Abendbrot eingeladen wird.
Großmutter, Vater, Mutter, die kleinere Schwester und Max sitzen schon am Tisch, auf dem gebackene Auberginen stehen. André fehlt noch und die Mutter ruft ihn ungefähr zum siebenten Mal zu Tisch. Lässig schlendert er schließlich herein und läßt die Tür hinter sich offen. Vaters Drohung, wenn er künftig nicht pünktlich zum Essen käme, werde er leer ausgehen, quittiert er mit breitem Grinsen. Madame Casals sagt zu ihm: „André, mach die Tür zu!“ André läßt sich zur Antwort auf seinen Platz fallen. Die Mutter wiederholt ihre Aufforderung betonter: „André! Mach die Tür zu!“ André rührt mit der Gabel in seinem Gemüse und schaufelt den ersten Bissen in den Mund. Madame Casals versteift sich: „André!“, und will den Befehl wiederholen, aber Casals, den ersten Bissen schon im Mund, fällt ihr ins Wort: „Bleib sitzen! Wenn Mutter will, daß die Tür zu ist, soll sie sie selber zumachen.“
Max bleibt der Mund offen stehen, er schaut von einem zum anderen, dann aber lieber auf seinen Teller.
Max geht durchs Dorf ohne rechtes Ziel. Er sucht mit sich und der Welt ins reine zu kommen. Der Abend ist mild und stimmt versöhnlich. Einzelne Dorfbewohner sind unterwegs, der Priester kommt von der Abendandacht, Don Rodriguez, der Obersteiger mit dem flotten Bärtchen und dem blinden Auge, ist auf dem Weg zu seiner Freundin, während seine Frau die drei Kinder ins Bett bringt. Philippe, den Schrankenwärter, zieht es zum Doppelkopf in die Kneipe, Max grüßt die, die er kennt, und wird freundlich wieder gegrüßt. Er will sich gerade dem Fußsteg über dem Fluß zuwenden, als er Germaines Stimme hört: „Monsieur Max! Attendez!“
Er bleibt stehen und sieht Germaine auf dem Fahrrad die Steigung vom Kirchberg herunterkommen, sie bremst mit quietschendem Rücktritt, um nicht zu schnell zu werden, und versucht vor Max mit einer flotten Kurve zum Halten zu kommen. Aber das Rad rutscht ihr weg auf dem geschotterten Weg, sie verliert die Balance und stürzt. Max hilft ihr auf, sie hat sich das Knie aufgeschlagen und hinkt jammernd ein paar Probeschritte. Offenbar ist nichts gebrochen, doch das Knie schwillt an, und aus der Abschürfung quellen langsam schwarzrote Blutstropfen.
Max versucht sie zu trösten: „Mais qu’est-ce que tu fais, Germaine!, warum rast du so schnell?“ Er zerrt sein Taschentuch hervor, zögert aber, es auf die Wunde zu drücken, weil es nicht sehr sauber ist. „Non. Das geht nicht. Warte! Stütz dich auf mich, ich nehme dein Rad.“ Er hebt das Fahrrad auf, biegt ein Schutzblech wieder gerade, richtet den Lenker und die Lampe und faßt Germaines Hand: „Viens! Ich bring’ dich nach Hause. Je t’accompagne à la maison!“ Sie hängt sich bei ihm ein und bemüht sich, nicht zu sehr zu hinken, macht auch schon wieder ein heiteres Gesicht. Sie genießt es, Arm in Arm mit Max gehen zu dürfen. So humpeln sie hinauf zum Häuschen der Witwe, unterwegs immer wieder von den Dorfbewohnern befragt: „Was hast du gemacht, Germaine?“ – „Ist es schlimm, meine Kleine?“ – „Bis du heiratest, ist alles wieder gut“ ...
Fast das gleiche hören sie dann noch einmal von der Witwe, die zuerst erschrocken die Hände zusammenschlägt, dann aber sieht, daß kein großes Unglück geschehen ist und Max für die Hilfe dankt: „Oh, monsieur Max, quel bonheur que vous avez été là!“, um im gleichen Atemzug ihrer Tochter Vorwürfe zu machen: „Et toi, Germaine! Tu es toujours trop fugueux!“ Und zu Max: „Elle est un tourbillon. Eine ... wilde Wind. Sie muß immer schnell, schnell!“ Max aber verteidigt Germaine: „Non, non, madame! Sie ist nicht schuld. Sie ist ausgerutscht mit dem Fahrrad, sst!“, und er deutet den Unfall an, „auf dem Weg vom Temple.“
Während Madame Lacombe vorsichtig Germaines Wunde reinigt und verbindet, dankt sie Max nochmals und bittet ihn, das Fahrrad in den Schuppen hinter dem Haus zu stellen, nicht ohne ihm nochmals einen prüfenden Blick nachzuschicken. Sie hat wohl bemerkt, daß Germaine mehr als ein allgemeines Interesse an Max nimmt und daß auch er ihr Töchterchen reizend findet.
Max schaut noch einmal herein, um sich zu verabschieden. „Gute Besserung, Germaine.“ – „Merci, monsieur Max. Es tut schon gar nicht mehr weh.“
Aber Madame Lacombe bittet ihn: „Non, monsieur Max! Sie können nicht so einfach gehen, bleiben Sie noch auf ein Glas.“
In der Grube wechseln gelegentlich die Arbeitsaufgaben und die Arbeitsorte, so daß Max mit der Zeit die Grube und die auch dort beschäftigten Zivilarbeiter kennenlernt. Vorübergehend wird er auch Helfer des alten spanischen Zimmermanns Jorge, der nach dem Franco-Putsch in Collet-de-Dèze hängengeblieben ist.
Jorge ist ein ruhiger Mann, der nicht viel redet und sich mit Max mehr durch Zeichensprache, kurze prägnante Gesten, als durch Worte verständigt. Sie erneuern Stempel des verrotteten Verbaus im alten Stollen, der auf der anderen Seite des Berges aus der Mine hinausführt, etwas tiefer gelegen als das neuere Stollensystem. Das Grubenwasser läuft durch ihn ab, man bekommt schnell nasse Füße, dafür ist man aber nicht an die Förderung gebunden, ist durch nichts getrieben, und der Weg vom und zum Dorf durch den alten Stollen ist wesentlich kürzer. Viele Bruchstellen machen ihn zwar gefährlich, er wird aber als möglicher Rettungsweg einigermaßen freigehalten.
Jorge ist ein Meister seines Fachs und handhabt virtuos die rasiermesserscharfe Zimmermannsaxt. Er vermag zwei Millimeter vom Hirnholz der Stempel abzuschlagen, damit diese lückenlos unter die Schulterhölzer getrieben werden können. Er arbeitet systematisch und effektiv und hat seinen eigenen Rhythmus. Er denkt nicht daran, sich für seinen Brötchengeber zu zerreißen, und wenn er sein Quantum geschafft hat, gewöhnlich nach sechs Stunden, obwohl seine Schicht von zweiundzwanzig bis sechs Uhr dauert, schultert er sein Werkzeug und macht sich auf den Weg nach Hause.
In einer halben Stunde ist Max dann ebenfalls in der Rattenburg und kann sich aufs Ohr hauen, um nachmittags noch eine Sonderschicht (gegen bare Bezahlung) einzulegen. Die findet über den Zeitraum einiger Wochen hinweg beim Straßenbau statt, bei der Begradigung einer besonders gefährlichen unter den hundert Kehren, mit denen sich die Landstraße um die Berge winden muß.
Die Arbeit beim Straßenbau wird gut bezahlt, einhundertzwanzig Francs täglich, für die Gefangenen eine Menge Geld.
Die Zusammenarbeit mit Jorge endet abrupt, weil sich Jorge schwer mit der Axt verletzt, als diese von einem Ast abspringt und seinen Fuß trifft.
Sie arbeiten sich durch Schichtgestein, das losgesprengt wird, um es abtragen zu können. Die Sprengungen werden recht nachlässig vorbereitet, die Bohrlöcher mehr oder weniger zufällig gesetzt, und man tut gut, seinen Kopf rechtzeitig einzuziehen. Hinzu kommt, daß der Berg aus sehr unterschiedlichem Material besteht: Sand- und Schichtgestein, Lehmschiefer, auch schwachen Granit- und Quarzadern, die bei der Sprengung ganz verschieden reagieren. So kann es passieren, daß die Straße nicht weiträumig genug abgesperrt wird und einer der selten vorbeikommenden Pkw eine Ladung von Steinen aufs Dach bekommt. Das hat dann längere, wenn auch erstaunlich friedliche Diskussionen zur Folge.
Max verdient dabei jedenfalls so viel Geld, daß er sich eine neue Armbanduhr bestellen kann, da ihm seine Konfirmationsuhr auf dem Transport von den Amis abgeknöpft worden war.
An der Bahnstrecke von Bremerhaven nach Kreuznach hatten zwar Frauen und Mädchen gestanden und angeboten, Wertsachen für die Gefangenen aufzubewahren, weil sie sonst konfisziert würden, aber die Landser trauten den Angeboten nicht und sahen darin nur einen Trick, ihnen ihre Habseligkeiten abzugaunern.
Wie man später erfährt, haben erstaunlicherweise viele dieser Dinge doch ihre Eigentümer erreicht.
Nun jedenfalls kann sich Max eine neue Uhr kaufen. In Collet gibt es keinen Uhrenladen, also bestellt er sie durch die Witwe Lacombe bei einem Versandhaus. Sie soll so wie seine Einsegnungsuhr aussehen: rund, flach, mit weißem Zifferblatt und Leuchtziffern und mit einem Metallarmband. Vierzehn Tage später erhält er das Päckchen mit der Uhr. Sie ist quadratisch, schwarz, hat goldfarbene Ziffern und ein schwarzes Lederarmband.
Zuerst will er sie zurückschicken. Aber die Witwe Lacombe und Germaine bestätigen ihm, daß es eine außergewöhnliche und hübsche Uhr sei, und er muß das schließlich zugeben. Er behält die Uhr und wird sie später noch als Student tragen.
Mausers Haus steht ein wenig außerhalb des Dorfes, auf einem kleinen Felsplateau zwischen der Straße und dem Flußbett. Eine Mauer aus Schichtgestein grenzt es gegen das Flußbett ab, so daß die Wand dahinter steil zum Fluß abfällt, und zur Straße hin steigt der Felsen gleich hinter dem Gärtchen ebenso steil in die Höhe.
Im Garten spaltet Skroszny Holz. Unter den schmetternden Schlägen der Axt fliegen die Scheite wie Geschosse durch die Gegend. Skroszny hat Jacke und Hemd abgelegt, man sieht seine kräftigen Muskeln spielen, wenn er die Axt schwingt. Er hat kein Bodybuilding nötig. Sein etwas grobes Gesicht zeigt die offensichtliche Freude an seiner Arbeit, daran, wie die Holzkloben unter seinen Hieben auseinanderspritzen. Er macht eine Show aus seiner Arbeit, denn Madame Mauser lädt die Scheite in einen Korb und schleppt sie in den windschiefen Schuppen, und ab und zu wirft sie einen verstohlenen Blick auf das stattliche Mannsbild, das ihr der Himmel ins Haus geschickt hat. Sie verwendet keinen Gedanken darauf, daß das, was sich anbahnt, wider die zehn Gebote ist. Sie selbst ist eine ansehnliche Frau Ende der Zwanzig, etwas kleiner als mittelgroß, mit kräftigen, aber wohlproportionierten Gliedern und hübsch gerundetem Hintern und Busen. Von dem ist etwas mehr als nur der Ansatz im weiten Ausschnitt zu sehen, wenn sie sich herabbeugt, um die Scheite aufzulesen. Sie tut das offensichtlich gern in Richtung ihres Holzhackers, und ein neutraler Beobachter würde sagen: Um ihm Appetit zu machen. Wenn man sich an die etwas verkümmerte Gestalt ihres Mannes erinnert, ist ihr das kaum übelzunehmen. Skroszny ist kein Spielverderber, und Madame Mauser nimmt das vergnügt zur Kenntnis.
Sie läßt die Kiepe stehen, wischt sich den Schweiß von der Stirn, geht ins Haus und kommt mit einer Flasche und zwei geraden Gläsern zurück, drückt eines davon Skroszny in die Hand und gießt beiden Rotwein ein. „Sie werden Durst haben“, sagt sie und prostet ihm zu: „Salut, monsieur!“ Er erwidert höflich: „À votre santé, madame!“, und mustert ausführlich und deutlich ihre Gestalt, was ihr eine Gänsehaut und ein leichtes Kribbeln in den Schenkeln verursacht, und sie wird überraschenderweise ein bißchen rot. Skroszny findet das äußerst sympathisch. Denn wenn er auch in seinem Liebeswerben ziemlich abgebrüht ist, schätzt er doch bei Frauen wenigstens einen Hauch von Scham.
„Machen wir eine kleine Pause“, sagt sie und setzt sich auf den Holzstoß, sehr aufrecht, damit sich ihre aufregen-den Brüste deutlich unter dem Pulli abzeichnen. Skroszny nimmt das zur Kenntnis und holt ein wenig tiefer Luft als gewöhnlich, um seinen Brustkorb zur Geltung zu bringen. Noch etwas zögerlich läßt er sich neben ihr nieder und trinkt ihr zu: „À votre santé, madame!“ – „Et à la votre“, erwidert sie und lächelt ihn über ihr Glas hinweg an.
Skroszny stellt fest, daß er sich dumm hingesetzt hat: Er sitzt links neben ihr und hält sein Glas in der Rechten. Sie bemerkt das und quittiert es mit einem kleinen spöttischen Lachen. Nach einem kleinen Hin und Her wechselt er das Glas in die Linke und legt seine Rechte um ihre Taille. Sie verwehrt ihm das nicht, sagt aber: „Bald kommt mein Mann von der Schicht!“, und als Skroszny seine Hand wieder von ihr nimmt, fährt sie fort: „Morgen ist er abends im Dorfklub, zum Boule.“
Skroszny rückt etwas näher an sie heran.
Als Max und Paule sich das nächste Mal sehen, bringt sie einen Beutel voll Tomaten, Auberginen, Zucchini und Feigen mit. Sie gibt ihn Max: „Hier! Damit du nicht trockenes Brot essen mußt.“
Max wird wieder einmal rot. Er spürt dem Klang ihrer Stimme nach, ob ein Vorwurf damit verbunden oder Ironie im Spiel ist, aber Paule ist immer so geradeaus und einfach, Zweideutigkeiten sind nicht ihre Art, so daß Max sich auch noch seines Verdachts schämt: „Danke schön! Das ist ...“, er will sagen „Das ist sehr nett“, verschluckt das aber, weil es ihm zu sehr nach Konversation klingt, und fragt statt dessen etwas dümmlich: „Ihr habt viel Gemüse und Obst im Garten?“
Paule lächelt denn auch, da er sie vor dem Garten abgeholt hat, und fragt: „Hast du ihn nicht gesehen? Nicht groß, unser Garten, aber ... wie heißt ...“, sie sucht das Wort, „furchtbar?“
Jetzt ist Max amüsiert und berichtigt: „Fruchtbar.“
„Fruchtbar“, wiederholt auch sie und hängt sich an seinen Arm.
Dann sitzen sie wieder über dem Fluß in der Felsnische, die Max das Dornröschenschloß nennt, inmitten von wilden Rosen und Rosmarin. Hinter ihnen steigt der Felsen mit seinem Buschwerk steil an, vor ihnen schauen die blaugrünen Augen der Kolke, des letzten, angestauten Wassers, aus dem Flußbett herauf. Dorf und Straße liegen auf der anderen Seite des Flußbetts im Nachmittagsschlaf.
Paule sitzt seitlich auf einen Arm gestützt, unbewußt in einer Haltung, die ihre schiefe Schulter nicht ahnen läßt. Sie sieht lieblich aus.
Max betrachtet sie verstohlen.
Sie riecht an einer Rose und sagt zu Max, besonders deutlich: „Les roses!“
Max erwidert: „Die Rosen“, und sie wiederholt: „Die Rosen.“ Dann spricht sie drei Zeilen eines Gedichts von Malherbes, an die sie sich vielleicht aus der Schule erinnert: „C’est comme ça – que les plus belle choses ont le pire destin. / Et rose, elle a vecu ce que vivent les roses: / l’espace d’un matin ...“
Max folgt dem Klang ihrer Stimme. Er versucht, ihr ,Dornröschen‘ verständlich zu machen. Er beugt vorsichtig einen Rosenzweig über ihr Gesicht und veranlaßt sie, die Augen zu schließen, so zu tun, als ob sie schliefe. „Dorn-röschen“, sagt er, „stechen – lange schlafen. Hundert Jahr!“
Sie versteht nicht gleich: „Hundert? Jahr?“ Sie übersetzt für sich „cent ans ... ah!“. Sie versteht plötzlich und nennt Max die französische Fassung des Märchens: „La Belle au bois dormant! Dorn-Röschen!“ Und dann stellt sie sich wieder schlafend und sagt: „Aber du mußt mich küssen!“ Max zögert, aber sie hält ihm ihr Gesicht hin: „Allez! Küß misch!“
Max gibt sich einen Ruck und küßt sie vorsichtig auf die Stirn. Sie ‚wacht auf‘ und wirkt ein wenig enttäuscht, sagt aber nichts.
Der Französischunterricht, ein Hin und Her von Worten, Blicken, erklärenden Gesten, findet in leicht schwebendem Zustand seine Fortsetzung. Max streichelt vorsichtig Paules Hand, wobei ihm das Herz bis zum Hals schlägt.
Sie sagt: „Caresser!“, und Max „Streicheln“.
Sie: „Tendresse“, er „Zärtlichkeit“. – „Zartlichkeit“, wiederholt sie, und er: „Zärtlichkeit!“
Er küßt ihre Fingerspitzen: „Deine Finger!“
Paule fährt mit dem Finger die Kontur seiner Lippen entlang: „Deine Mund.“ Sie legt die Arme um ihn.
Er fühlt sich so schwindlig, wie auf einem Karussell. Vorsichtig löst er sich von ihr, sie schaut ihn fragend an.
Es fällt ihm schwer, seine Empfindungen auszudrücken: „Siehst du, ich fahre vielleicht bald nach Hause. Je partirai pour l’Allemagne.“
Sie lächelt: „Ich weiß!“
Max fühlt sich sehr zu ihr hingezogen, aber er will von ihr keine Liebe annehmen, wenn er sie nicht ganz und gar lieben kann. Und er wird bald, so hofft er jedenfalls, heimfahren. Und dann ist da nach wie vor diese Hemmung gegenüber ihrem Körperfehler. Gerade sie soll nicht das Gefühl haben, sitzengelassen zu sein, wenn er fortgeht. Er weiß auch nicht, was sie erwartet. So sucht er weiter nach seinen wahren Empfindungen und nach passenden Worten: „In Deutschland fängt mein Leben an, ein anderes Leben. C’est une vie nouvelle ...“
Sie lächelt noch immer: „Ich weiß.“
Max sucht der liebevollen Spannung zu entkommen: „Vielleicht andere Mädchen.“
Paules Lächeln scheint unveränderbar zu sein: „Mais bien sûr. Andere Mädchen.“
„Ich werde nicht zu dir zurückkommen! Ich ...“, es fällt ihm schwer, das auszusprechen: „liebe dich nicht so, daß ich immer mit dir zusammensein möchte.“ Er kann einen Seitenblick auf ihre Schulter nur schlecht verhehlen und kommt sich wie ein Schuft vor.
Sie bemerkt den Blick, lauscht seinen Worten nach, und ihr Lächeln wird ein winziges kleiner: „C’est dommage. C’est un peu triste ... Das ist ... ein bißchen ... traurisch.“ Aber dann scheint sie wieder heiter zu sein: „Aber noch bist du hier. Und du liebst mich ein bißchen, n’est-ce pas?“
Max möchte vor Rührung heulen: „Je t’aime beaucoup!“
„Dann küß misch!“
Ihre Lippen sind voll, weich, warm, hingebungsvoll und voller Verlangen, aber Max gestattet sich, wieder einmal, nur einen Kuß.
Es ist noch hell, als sie nahe beieinander am Rande des Dorfes stehen, wo die Häuser beginnen, sich zu einer Gemeinschaft zusammenzufinden.
Paule sagt leise: „Vielleicht besser, sisch jetzt trennen ...“
Max will sie nicht lassen: „Wieso denn? Ich bringe dich noch.“
Sie möchte eigentlich auch nicht von ihm gehen und schmiegt sich an ihn: „Comme tu veux.“
Sie gehen weiter und halten sich bei den Händen. Drei Mädchen aus dem Dorf begegnen ihnen, dieselben, die beim Tanz Schmude einen Korb gegeben haben.
Kurz bevor sie auf ihrer Höhe sind, sagt die eine zu den anderen, betont laut: „Die im Krieg mit den Deutschen zusammengearbeitet haben, hängen sich jetzt wieder an sie.“ Eine andere wird noch gehässiger: „Nur Schlampen gehen auf offener Straße umarmt!“ Die dritte gehört zum Bund der Schandmäuler: „La belle épaule!“
Paule schaut geradeaus an den Mädchen vorbei, dann zu Max.
Der versteht nur soviel, daß Paule beschimpft wird, und will stehenbleiben, um etwas zu erwidern, aber Paule zieht ihn weiter: „Cettes sottes sont jalouses à cause de toi. Sie sind ... neidlich auf mir, wegen dir.“
Jetzt ist es Max, der sagt: „Wir sollten doch besser nicht zusammen weitergehen.“
Aber jetzt ist Paule entschlossen: „Warum nischt? Ich schäm mir nischt!“ Sie zieht ihn entschlossen weiter.
Max bringt Paule bis vor ihre Gartentür. Sie will das zuerst wieder nicht haben. Sie möchte zwar gerne mit ihm zusammensein, aber sie möchte doch nicht im Dorf durch diese Freundschaft auffallen. Der Dorfklatsch ist die beliebteste Unterhaltung, und den Dorfbewohnern entgeht nichts. Natürlich sind sie schon gesehen worden. Auch jetzt lassen die Familienmütter hinter Gardinen und Fensterläden ihre Blicke über die Straße schießen. Also tritt sie die Flucht nach vorn an. Vielleicht legt sich ja die anfängliche Auf-regung, und es wird dorffähig, was sie als selbstverständlich empfindet: daß sich ein französisches Mädchen und ein deutscher Junge kennen und treffen und – sie wagt das gar nicht zu Ende zu denken – auch lieben dürfen.
So gestattet sie Max, bis zur Gartentür mitzugehen, obwohl die Sommernacht hell ist und ihre Mutter wachsam, wie sie weiß. Hector schlägt kurz an, dann erkennt er sie und kommt schwanzwedelnd heran. „Tais-toi, Hector!“ befiehlt sie ihm leise, und er läßt sich gerne hinter den Ohren kraulen.
Sie dankt Max für den Spaziergang: „Merci, monsieur Max, auf Wiedersehen!“, und drückt ihm kräftig die Hand. Max möchte sie noch nicht loslassen, aber als er spürt, daß sie sich ihm entzieht, küßt er ihr rasch wieder die Hand, und sie läßt es sich lächelnd gefallen.
In dem Moment schaut die Mutter aus der Tür: „Marie-Paule?!“ ruft sie halb fragend und halb befehlend. „Steh nicht am Tor herum, komm herein! Und Sie, Monsieur, gehen wohl besser in Ihr Quartier!“ Max ist überrascht, daß sie ihn gesehen hat, und gibt Paules Hand frei. Sie ist etwas verwirrt und sagt noch einmal: „Gut Nacht, monsieur Max!“ Und ganz leise: „Auf bald!“ Dann läuft sie dem Haus zu, aus dem die Mutter drängt: „Kommst du jetzt bald?!“
Max tritt etwas zurück in den Schatten, um aus dem Blickfeld der Mutter zu kommen, die jetzt ihre Tochter mit Schelte willkommen heißt. Als die Tür geschlossen ist, steht er noch zwei, drei Minuten und versucht, seine Gefühle und Gedanken zu ordnen. Dann wendet er sich ab und strebt, wie auf Wolken wandelnd, der Rattenburg zu. (PK)
Lesen Sie die Fortsetzung des biografischen Romans in der kommenden Ausgabe, oder - bequemer - bestellen Sie das Buch bei edition winterwork
Online-Flyer Nr. 310 vom 13.07.2011
Druckversion
Literatur
Forsetzungsroman in der NRhZ - Folge 17
Max - Jahrgang 27
Von Lutz Köhlert

Der Buchhalter der Mine, Casals, ist ein mickriges Männchen, vielleicht fünfzig Jahre alt und schon ohne Zähne. Wenn er aufgeregt spricht, was er immer tut, klappt ihm sein Gebiß herunter, und er muß es mit dem Finger wieder festdrücken. Es kommt auch vor, daß es ihm aus dem Mund fällt. Dann hebt er es auf, putzt es am Pullover ab und setzt es mit wackelndem Kiefer wieder ein.
Casals hat einen etwa sieben Jahre alten Sprößling namens André, der schon mal auf der Dorfstraße hinter seinem Vater hergeht, ihm Fledermausohren macht und die Zunge herausstreckt und „Miké! Miké!“ schreit. André fallen mehr Dummheiten ein als er ausführen kann.
Einmal hilft Max beim Erdbeerenpflücken. Casals schichtet die Früchte vorsichtig in einen Korb, den er mit Rhabarberblättern auskleidet und zum Schutz gegen die Hitze mit Blättern zudeckt. André stopft Erdbeeren in sich hinein und langweilt sich. Der muschelförmige Erdbeerkorb sieht wie ein Schaukelsitz aus, die Rhabarberblätter über den Erdbeeren wie ein einladendes Kissen. So sieht es André jedenfalls. Hinter dem Rücken des Vaters läßt er sich sacht auf das Kissen nieder, so daß der rote Saft der Erdbeeren durch das Korbgeflecht wie aus einer Kelter quillt. André beobachtet seinen Vater und bleibt auf dem Sprung.
Als Casals sich umwendet und das Malheur bemerkt, fährt er mit wütendem Geschrei und klapperndem Gebiß auf den Übeltäter zu, der ihm aber leicht und flink entwischt und wieder mit „Miké! Miké!“-Geschrei eine Grimasse schneidet.
Die pädagogischen Wurzeln für dieses bizarre Verhältnis von Vater und Sohn lernt Max wenig später kennen, als er nach dem Holzhacken zum Abendbrot eingeladen wird.
Großmutter, Vater, Mutter, die kleinere Schwester und Max sitzen schon am Tisch, auf dem gebackene Auberginen stehen. André fehlt noch und die Mutter ruft ihn ungefähr zum siebenten Mal zu Tisch. Lässig schlendert er schließlich herein und läßt die Tür hinter sich offen. Vaters Drohung, wenn er künftig nicht pünktlich zum Essen käme, werde er leer ausgehen, quittiert er mit breitem Grinsen. Madame Casals sagt zu ihm: „André, mach die Tür zu!“ André läßt sich zur Antwort auf seinen Platz fallen. Die Mutter wiederholt ihre Aufforderung betonter: „André! Mach die Tür zu!“ André rührt mit der Gabel in seinem Gemüse und schaufelt den ersten Bissen in den Mund. Madame Casals versteift sich: „André!“, und will den Befehl wiederholen, aber Casals, den ersten Bissen schon im Mund, fällt ihr ins Wort: „Bleib sitzen! Wenn Mutter will, daß die Tür zu ist, soll sie sie selber zumachen.“
Max bleibt der Mund offen stehen, er schaut von einem zum anderen, dann aber lieber auf seinen Teller.
*
Max geht durchs Dorf ohne rechtes Ziel. Er sucht mit sich und der Welt ins reine zu kommen. Der Abend ist mild und stimmt versöhnlich. Einzelne Dorfbewohner sind unterwegs, der Priester kommt von der Abendandacht, Don Rodriguez, der Obersteiger mit dem flotten Bärtchen und dem blinden Auge, ist auf dem Weg zu seiner Freundin, während seine Frau die drei Kinder ins Bett bringt. Philippe, den Schrankenwärter, zieht es zum Doppelkopf in die Kneipe, Max grüßt die, die er kennt, und wird freundlich wieder gegrüßt. Er will sich gerade dem Fußsteg über dem Fluß zuwenden, als er Germaines Stimme hört: „Monsieur Max! Attendez!“
Er bleibt stehen und sieht Germaine auf dem Fahrrad die Steigung vom Kirchberg herunterkommen, sie bremst mit quietschendem Rücktritt, um nicht zu schnell zu werden, und versucht vor Max mit einer flotten Kurve zum Halten zu kommen. Aber das Rad rutscht ihr weg auf dem geschotterten Weg, sie verliert die Balance und stürzt. Max hilft ihr auf, sie hat sich das Knie aufgeschlagen und hinkt jammernd ein paar Probeschritte. Offenbar ist nichts gebrochen, doch das Knie schwillt an, und aus der Abschürfung quellen langsam schwarzrote Blutstropfen.
Max versucht sie zu trösten: „Mais qu’est-ce que tu fais, Germaine!, warum rast du so schnell?“ Er zerrt sein Taschentuch hervor, zögert aber, es auf die Wunde zu drücken, weil es nicht sehr sauber ist. „Non. Das geht nicht. Warte! Stütz dich auf mich, ich nehme dein Rad.“ Er hebt das Fahrrad auf, biegt ein Schutzblech wieder gerade, richtet den Lenker und die Lampe und faßt Germaines Hand: „Viens! Ich bring’ dich nach Hause. Je t’accompagne à la maison!“ Sie hängt sich bei ihm ein und bemüht sich, nicht zu sehr zu hinken, macht auch schon wieder ein heiteres Gesicht. Sie genießt es, Arm in Arm mit Max gehen zu dürfen. So humpeln sie hinauf zum Häuschen der Witwe, unterwegs immer wieder von den Dorfbewohnern befragt: „Was hast du gemacht, Germaine?“ – „Ist es schlimm, meine Kleine?“ – „Bis du heiratest, ist alles wieder gut“ ...
Fast das gleiche hören sie dann noch einmal von der Witwe, die zuerst erschrocken die Hände zusammenschlägt, dann aber sieht, daß kein großes Unglück geschehen ist und Max für die Hilfe dankt: „Oh, monsieur Max, quel bonheur que vous avez été là!“, um im gleichen Atemzug ihrer Tochter Vorwürfe zu machen: „Et toi, Germaine! Tu es toujours trop fugueux!“ Und zu Max: „Elle est un tourbillon. Eine ... wilde Wind. Sie muß immer schnell, schnell!“ Max aber verteidigt Germaine: „Non, non, madame! Sie ist nicht schuld. Sie ist ausgerutscht mit dem Fahrrad, sst!“, und er deutet den Unfall an, „auf dem Weg vom Temple.“
Während Madame Lacombe vorsichtig Germaines Wunde reinigt und verbindet, dankt sie Max nochmals und bittet ihn, das Fahrrad in den Schuppen hinter dem Haus zu stellen, nicht ohne ihm nochmals einen prüfenden Blick nachzuschicken. Sie hat wohl bemerkt, daß Germaine mehr als ein allgemeines Interesse an Max nimmt und daß auch er ihr Töchterchen reizend findet.
Max schaut noch einmal herein, um sich zu verabschieden. „Gute Besserung, Germaine.“ – „Merci, monsieur Max. Es tut schon gar nicht mehr weh.“
Aber Madame Lacombe bittet ihn: „Non, monsieur Max! Sie können nicht so einfach gehen, bleiben Sie noch auf ein Glas.“
*
In der Grube wechseln gelegentlich die Arbeitsaufgaben und die Arbeitsorte, so daß Max mit der Zeit die Grube und die auch dort beschäftigten Zivilarbeiter kennenlernt. Vorübergehend wird er auch Helfer des alten spanischen Zimmermanns Jorge, der nach dem Franco-Putsch in Collet-de-Dèze hängengeblieben ist.
Jorge ist ein ruhiger Mann, der nicht viel redet und sich mit Max mehr durch Zeichensprache, kurze prägnante Gesten, als durch Worte verständigt. Sie erneuern Stempel des verrotteten Verbaus im alten Stollen, der auf der anderen Seite des Berges aus der Mine hinausführt, etwas tiefer gelegen als das neuere Stollensystem. Das Grubenwasser läuft durch ihn ab, man bekommt schnell nasse Füße, dafür ist man aber nicht an die Förderung gebunden, ist durch nichts getrieben, und der Weg vom und zum Dorf durch den alten Stollen ist wesentlich kürzer. Viele Bruchstellen machen ihn zwar gefährlich, er wird aber als möglicher Rettungsweg einigermaßen freigehalten.
Jorge ist ein Meister seines Fachs und handhabt virtuos die rasiermesserscharfe Zimmermannsaxt. Er vermag zwei Millimeter vom Hirnholz der Stempel abzuschlagen, damit diese lückenlos unter die Schulterhölzer getrieben werden können. Er arbeitet systematisch und effektiv und hat seinen eigenen Rhythmus. Er denkt nicht daran, sich für seinen Brötchengeber zu zerreißen, und wenn er sein Quantum geschafft hat, gewöhnlich nach sechs Stunden, obwohl seine Schicht von zweiundzwanzig bis sechs Uhr dauert, schultert er sein Werkzeug und macht sich auf den Weg nach Hause.
In einer halben Stunde ist Max dann ebenfalls in der Rattenburg und kann sich aufs Ohr hauen, um nachmittags noch eine Sonderschicht (gegen bare Bezahlung) einzulegen. Die findet über den Zeitraum einiger Wochen hinweg beim Straßenbau statt, bei der Begradigung einer besonders gefährlichen unter den hundert Kehren, mit denen sich die Landstraße um die Berge winden muß.
Die Arbeit beim Straßenbau wird gut bezahlt, einhundertzwanzig Francs täglich, für die Gefangenen eine Menge Geld.
Die Zusammenarbeit mit Jorge endet abrupt, weil sich Jorge schwer mit der Axt verletzt, als diese von einem Ast abspringt und seinen Fuß trifft.
Sie arbeiten sich durch Schichtgestein, das losgesprengt wird, um es abtragen zu können. Die Sprengungen werden recht nachlässig vorbereitet, die Bohrlöcher mehr oder weniger zufällig gesetzt, und man tut gut, seinen Kopf rechtzeitig einzuziehen. Hinzu kommt, daß der Berg aus sehr unterschiedlichem Material besteht: Sand- und Schichtgestein, Lehmschiefer, auch schwachen Granit- und Quarzadern, die bei der Sprengung ganz verschieden reagieren. So kann es passieren, daß die Straße nicht weiträumig genug abgesperrt wird und einer der selten vorbeikommenden Pkw eine Ladung von Steinen aufs Dach bekommt. Das hat dann längere, wenn auch erstaunlich friedliche Diskussionen zur Folge.
Max verdient dabei jedenfalls so viel Geld, daß er sich eine neue Armbanduhr bestellen kann, da ihm seine Konfirmationsuhr auf dem Transport von den Amis abgeknöpft worden war.
An der Bahnstrecke von Bremerhaven nach Kreuznach hatten zwar Frauen und Mädchen gestanden und angeboten, Wertsachen für die Gefangenen aufzubewahren, weil sie sonst konfisziert würden, aber die Landser trauten den Angeboten nicht und sahen darin nur einen Trick, ihnen ihre Habseligkeiten abzugaunern.
Wie man später erfährt, haben erstaunlicherweise viele dieser Dinge doch ihre Eigentümer erreicht.
Nun jedenfalls kann sich Max eine neue Uhr kaufen. In Collet gibt es keinen Uhrenladen, also bestellt er sie durch die Witwe Lacombe bei einem Versandhaus. Sie soll so wie seine Einsegnungsuhr aussehen: rund, flach, mit weißem Zifferblatt und Leuchtziffern und mit einem Metallarmband. Vierzehn Tage später erhält er das Päckchen mit der Uhr. Sie ist quadratisch, schwarz, hat goldfarbene Ziffern und ein schwarzes Lederarmband.
Zuerst will er sie zurückschicken. Aber die Witwe Lacombe und Germaine bestätigen ihm, daß es eine außergewöhnliche und hübsche Uhr sei, und er muß das schließlich zugeben. Er behält die Uhr und wird sie später noch als Student tragen.
Mausers Haus steht ein wenig außerhalb des Dorfes, auf einem kleinen Felsplateau zwischen der Straße und dem Flußbett. Eine Mauer aus Schichtgestein grenzt es gegen das Flußbett ab, so daß die Wand dahinter steil zum Fluß abfällt, und zur Straße hin steigt der Felsen gleich hinter dem Gärtchen ebenso steil in die Höhe.
Im Garten spaltet Skroszny Holz. Unter den schmetternden Schlägen der Axt fliegen die Scheite wie Geschosse durch die Gegend. Skroszny hat Jacke und Hemd abgelegt, man sieht seine kräftigen Muskeln spielen, wenn er die Axt schwingt. Er hat kein Bodybuilding nötig. Sein etwas grobes Gesicht zeigt die offensichtliche Freude an seiner Arbeit, daran, wie die Holzkloben unter seinen Hieben auseinanderspritzen. Er macht eine Show aus seiner Arbeit, denn Madame Mauser lädt die Scheite in einen Korb und schleppt sie in den windschiefen Schuppen, und ab und zu wirft sie einen verstohlenen Blick auf das stattliche Mannsbild, das ihr der Himmel ins Haus geschickt hat. Sie verwendet keinen Gedanken darauf, daß das, was sich anbahnt, wider die zehn Gebote ist. Sie selbst ist eine ansehnliche Frau Ende der Zwanzig, etwas kleiner als mittelgroß, mit kräftigen, aber wohlproportionierten Gliedern und hübsch gerundetem Hintern und Busen. Von dem ist etwas mehr als nur der Ansatz im weiten Ausschnitt zu sehen, wenn sie sich herabbeugt, um die Scheite aufzulesen. Sie tut das offensichtlich gern in Richtung ihres Holzhackers, und ein neutraler Beobachter würde sagen: Um ihm Appetit zu machen. Wenn man sich an die etwas verkümmerte Gestalt ihres Mannes erinnert, ist ihr das kaum übelzunehmen. Skroszny ist kein Spielverderber, und Madame Mauser nimmt das vergnügt zur Kenntnis.
Sie läßt die Kiepe stehen, wischt sich den Schweiß von der Stirn, geht ins Haus und kommt mit einer Flasche und zwei geraden Gläsern zurück, drückt eines davon Skroszny in die Hand und gießt beiden Rotwein ein. „Sie werden Durst haben“, sagt sie und prostet ihm zu: „Salut, monsieur!“ Er erwidert höflich: „À votre santé, madame!“, und mustert ausführlich und deutlich ihre Gestalt, was ihr eine Gänsehaut und ein leichtes Kribbeln in den Schenkeln verursacht, und sie wird überraschenderweise ein bißchen rot. Skroszny findet das äußerst sympathisch. Denn wenn er auch in seinem Liebeswerben ziemlich abgebrüht ist, schätzt er doch bei Frauen wenigstens einen Hauch von Scham.
„Machen wir eine kleine Pause“, sagt sie und setzt sich auf den Holzstoß, sehr aufrecht, damit sich ihre aufregen-den Brüste deutlich unter dem Pulli abzeichnen. Skroszny nimmt das zur Kenntnis und holt ein wenig tiefer Luft als gewöhnlich, um seinen Brustkorb zur Geltung zu bringen. Noch etwas zögerlich läßt er sich neben ihr nieder und trinkt ihr zu: „À votre santé, madame!“ – „Et à la votre“, erwidert sie und lächelt ihn über ihr Glas hinweg an.
Skroszny stellt fest, daß er sich dumm hingesetzt hat: Er sitzt links neben ihr und hält sein Glas in der Rechten. Sie bemerkt das und quittiert es mit einem kleinen spöttischen Lachen. Nach einem kleinen Hin und Her wechselt er das Glas in die Linke und legt seine Rechte um ihre Taille. Sie verwehrt ihm das nicht, sagt aber: „Bald kommt mein Mann von der Schicht!“, und als Skroszny seine Hand wieder von ihr nimmt, fährt sie fort: „Morgen ist er abends im Dorfklub, zum Boule.“
Skroszny rückt etwas näher an sie heran.
*
Als Max und Paule sich das nächste Mal sehen, bringt sie einen Beutel voll Tomaten, Auberginen, Zucchini und Feigen mit. Sie gibt ihn Max: „Hier! Damit du nicht trockenes Brot essen mußt.“
Max wird wieder einmal rot. Er spürt dem Klang ihrer Stimme nach, ob ein Vorwurf damit verbunden oder Ironie im Spiel ist, aber Paule ist immer so geradeaus und einfach, Zweideutigkeiten sind nicht ihre Art, so daß Max sich auch noch seines Verdachts schämt: „Danke schön! Das ist ...“, er will sagen „Das ist sehr nett“, verschluckt das aber, weil es ihm zu sehr nach Konversation klingt, und fragt statt dessen etwas dümmlich: „Ihr habt viel Gemüse und Obst im Garten?“
Paule lächelt denn auch, da er sie vor dem Garten abgeholt hat, und fragt: „Hast du ihn nicht gesehen? Nicht groß, unser Garten, aber ... wie heißt ...“, sie sucht das Wort, „furchtbar?“
Jetzt ist Max amüsiert und berichtigt: „Fruchtbar.“
„Fruchtbar“, wiederholt auch sie und hängt sich an seinen Arm.
Dann sitzen sie wieder über dem Fluß in der Felsnische, die Max das Dornröschenschloß nennt, inmitten von wilden Rosen und Rosmarin. Hinter ihnen steigt der Felsen mit seinem Buschwerk steil an, vor ihnen schauen die blaugrünen Augen der Kolke, des letzten, angestauten Wassers, aus dem Flußbett herauf. Dorf und Straße liegen auf der anderen Seite des Flußbetts im Nachmittagsschlaf.
Paule sitzt seitlich auf einen Arm gestützt, unbewußt in einer Haltung, die ihre schiefe Schulter nicht ahnen läßt. Sie sieht lieblich aus.
Max betrachtet sie verstohlen.
Sie riecht an einer Rose und sagt zu Max, besonders deutlich: „Les roses!“
Max erwidert: „Die Rosen“, und sie wiederholt: „Die Rosen.“ Dann spricht sie drei Zeilen eines Gedichts von Malherbes, an die sie sich vielleicht aus der Schule erinnert: „C’est comme ça – que les plus belle choses ont le pire destin. / Et rose, elle a vecu ce que vivent les roses: / l’espace d’un matin ...“
Max folgt dem Klang ihrer Stimme. Er versucht, ihr ,Dornröschen‘ verständlich zu machen. Er beugt vorsichtig einen Rosenzweig über ihr Gesicht und veranlaßt sie, die Augen zu schließen, so zu tun, als ob sie schliefe. „Dorn-röschen“, sagt er, „stechen – lange schlafen. Hundert Jahr!“
Sie versteht nicht gleich: „Hundert? Jahr?“ Sie übersetzt für sich „cent ans ... ah!“. Sie versteht plötzlich und nennt Max die französische Fassung des Märchens: „La Belle au bois dormant! Dorn-Röschen!“ Und dann stellt sie sich wieder schlafend und sagt: „Aber du mußt mich küssen!“ Max zögert, aber sie hält ihm ihr Gesicht hin: „Allez! Küß misch!“
Max gibt sich einen Ruck und küßt sie vorsichtig auf die Stirn. Sie ‚wacht auf‘ und wirkt ein wenig enttäuscht, sagt aber nichts.
*
Der Französischunterricht, ein Hin und Her von Worten, Blicken, erklärenden Gesten, findet in leicht schwebendem Zustand seine Fortsetzung. Max streichelt vorsichtig Paules Hand, wobei ihm das Herz bis zum Hals schlägt.
Sie sagt: „Caresser!“, und Max „Streicheln“.
Sie: „Tendresse“, er „Zärtlichkeit“. – „Zartlichkeit“, wiederholt sie, und er: „Zärtlichkeit!“
Er küßt ihre Fingerspitzen: „Deine Finger!“
Paule fährt mit dem Finger die Kontur seiner Lippen entlang: „Deine Mund.“ Sie legt die Arme um ihn.
Er fühlt sich so schwindlig, wie auf einem Karussell. Vorsichtig löst er sich von ihr, sie schaut ihn fragend an.
Es fällt ihm schwer, seine Empfindungen auszudrücken: „Siehst du, ich fahre vielleicht bald nach Hause. Je partirai pour l’Allemagne.“
Sie lächelt: „Ich weiß!“
Max fühlt sich sehr zu ihr hingezogen, aber er will von ihr keine Liebe annehmen, wenn er sie nicht ganz und gar lieben kann. Und er wird bald, so hofft er jedenfalls, heimfahren. Und dann ist da nach wie vor diese Hemmung gegenüber ihrem Körperfehler. Gerade sie soll nicht das Gefühl haben, sitzengelassen zu sein, wenn er fortgeht. Er weiß auch nicht, was sie erwartet. So sucht er weiter nach seinen wahren Empfindungen und nach passenden Worten: „In Deutschland fängt mein Leben an, ein anderes Leben. C’est une vie nouvelle ...“
Sie lächelt noch immer: „Ich weiß.“
Max sucht der liebevollen Spannung zu entkommen: „Vielleicht andere Mädchen.“
Paules Lächeln scheint unveränderbar zu sein: „Mais bien sûr. Andere Mädchen.“
„Ich werde nicht zu dir zurückkommen! Ich ...“, es fällt ihm schwer, das auszusprechen: „liebe dich nicht so, daß ich immer mit dir zusammensein möchte.“ Er kann einen Seitenblick auf ihre Schulter nur schlecht verhehlen und kommt sich wie ein Schuft vor.
Sie bemerkt den Blick, lauscht seinen Worten nach, und ihr Lächeln wird ein winziges kleiner: „C’est dommage. C’est un peu triste ... Das ist ... ein bißchen ... traurisch.“ Aber dann scheint sie wieder heiter zu sein: „Aber noch bist du hier. Und du liebst mich ein bißchen, n’est-ce pas?“
Max möchte vor Rührung heulen: „Je t’aime beaucoup!“
„Dann küß misch!“
Ihre Lippen sind voll, weich, warm, hingebungsvoll und voller Verlangen, aber Max gestattet sich, wieder einmal, nur einen Kuß.
Es ist noch hell, als sie nahe beieinander am Rande des Dorfes stehen, wo die Häuser beginnen, sich zu einer Gemeinschaft zusammenzufinden.
Paule sagt leise: „Vielleicht besser, sisch jetzt trennen ...“
Max will sie nicht lassen: „Wieso denn? Ich bringe dich noch.“
Sie möchte eigentlich auch nicht von ihm gehen und schmiegt sich an ihn: „Comme tu veux.“
Sie gehen weiter und halten sich bei den Händen. Drei Mädchen aus dem Dorf begegnen ihnen, dieselben, die beim Tanz Schmude einen Korb gegeben haben.
Kurz bevor sie auf ihrer Höhe sind, sagt die eine zu den anderen, betont laut: „Die im Krieg mit den Deutschen zusammengearbeitet haben, hängen sich jetzt wieder an sie.“ Eine andere wird noch gehässiger: „Nur Schlampen gehen auf offener Straße umarmt!“ Die dritte gehört zum Bund der Schandmäuler: „La belle épaule!“
Paule schaut geradeaus an den Mädchen vorbei, dann zu Max.
Der versteht nur soviel, daß Paule beschimpft wird, und will stehenbleiben, um etwas zu erwidern, aber Paule zieht ihn weiter: „Cettes sottes sont jalouses à cause de toi. Sie sind ... neidlich auf mir, wegen dir.“
Jetzt ist es Max, der sagt: „Wir sollten doch besser nicht zusammen weitergehen.“
Aber jetzt ist Paule entschlossen: „Warum nischt? Ich schäm mir nischt!“ Sie zieht ihn entschlossen weiter.
Max bringt Paule bis vor ihre Gartentür. Sie will das zuerst wieder nicht haben. Sie möchte zwar gerne mit ihm zusammensein, aber sie möchte doch nicht im Dorf durch diese Freundschaft auffallen. Der Dorfklatsch ist die beliebteste Unterhaltung, und den Dorfbewohnern entgeht nichts. Natürlich sind sie schon gesehen worden. Auch jetzt lassen die Familienmütter hinter Gardinen und Fensterläden ihre Blicke über die Straße schießen. Also tritt sie die Flucht nach vorn an. Vielleicht legt sich ja die anfängliche Auf-regung, und es wird dorffähig, was sie als selbstverständlich empfindet: daß sich ein französisches Mädchen und ein deutscher Junge kennen und treffen und – sie wagt das gar nicht zu Ende zu denken – auch lieben dürfen.
So gestattet sie Max, bis zur Gartentür mitzugehen, obwohl die Sommernacht hell ist und ihre Mutter wachsam, wie sie weiß. Hector schlägt kurz an, dann erkennt er sie und kommt schwanzwedelnd heran. „Tais-toi, Hector!“ befiehlt sie ihm leise, und er läßt sich gerne hinter den Ohren kraulen.
Sie dankt Max für den Spaziergang: „Merci, monsieur Max, auf Wiedersehen!“, und drückt ihm kräftig die Hand. Max möchte sie noch nicht loslassen, aber als er spürt, daß sie sich ihm entzieht, küßt er ihr rasch wieder die Hand, und sie läßt es sich lächelnd gefallen.
In dem Moment schaut die Mutter aus der Tür: „Marie-Paule?!“ ruft sie halb fragend und halb befehlend. „Steh nicht am Tor herum, komm herein! Und Sie, Monsieur, gehen wohl besser in Ihr Quartier!“ Max ist überrascht, daß sie ihn gesehen hat, und gibt Paules Hand frei. Sie ist etwas verwirrt und sagt noch einmal: „Gut Nacht, monsieur Max!“ Und ganz leise: „Auf bald!“ Dann läuft sie dem Haus zu, aus dem die Mutter drängt: „Kommst du jetzt bald?!“
Max tritt etwas zurück in den Schatten, um aus dem Blickfeld der Mutter zu kommen, die jetzt ihre Tochter mit Schelte willkommen heißt. Als die Tür geschlossen ist, steht er noch zwei, drei Minuten und versucht, seine Gefühle und Gedanken zu ordnen. Dann wendet er sich ab und strebt, wie auf Wolken wandelnd, der Rattenburg zu. (PK)
Lesen Sie die Fortsetzung des biografischen Romans in der kommenden Ausgabe, oder - bequemer - bestellen Sie das Buch bei edition winterwork
Online-Flyer Nr. 310 vom 13.07.2011
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE
















 Max, Jahrgang 1927, 16jähriger Luftwaffenhelfer, später Kadett der Kriegsmarine auf dem Zerstörer „Hans Lody“, schildert seine Erlebnisse während des Krieges und in französischer Kriegsgefangenschaft. Seine Erinnerungen kreisen um die Arbeit im Bergwerk, um die erste Liebe zu der Französin Marie-Paule, die vergeblichen Fluchten und die endliche Heimkehr in das besetzte Deutschland. Reflexionen über die Sinnlosigkeit und Grausamkeit des Krieges haben angesichts weltweiter kriegerischer Aktivitäten nichts von ihrer Aktualität verloren.
Max, Jahrgang 1927, 16jähriger Luftwaffenhelfer, später Kadett der Kriegsmarine auf dem Zerstörer „Hans Lody“, schildert seine Erlebnisse während des Krieges und in französischer Kriegsgefangenschaft. Seine Erinnerungen kreisen um die Arbeit im Bergwerk, um die erste Liebe zu der Französin Marie-Paule, die vergeblichen Fluchten und die endliche Heimkehr in das besetzte Deutschland. Reflexionen über die Sinnlosigkeit und Grausamkeit des Krieges haben angesichts weltweiter kriegerischer Aktivitäten nichts von ihrer Aktualität verloren.