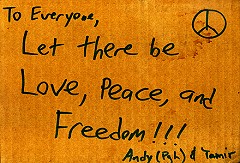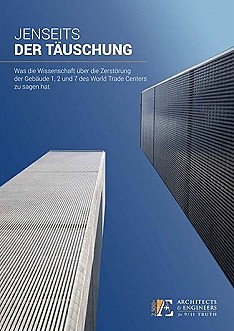SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Literatur
Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 14
Max - Jahrgang 27
Von Lutz Köhlert

Im Wasserloch machen Hein Skroszny und Emil Lehmbäcker eine Doppelschicht. Skroszny hat so viel Material geschossen, daß Bodo Schmude und Sigi Welle es unmöglich allein hätten räumen können. Sie sind schon beim dreizehnten Waggon, und es liegen mindestens noch drei Waggons voll am Boden. Sie könnten sich die Arbeit einteilen und noch was für den nächsten Tag übriglassen, aber Skroszny will alle Rekorde brechen.
In dem an drei Meter tiefen, etwa zweieinhalb Meter breiten Loch schippen Skroszny und Emil schlammiges Geröll in die Tonne.
Schmude lehnt neben dem Loch an einem leeren Hunt und wartet darauf, daß er aufziehen kann. Obwohl sie unter der Last der Arbeit ächzen und ihnen der Schweiß am Körper herabrinnt, machen sie Witze.
„Was machen wir denn mit Bodo, daß er sich nicht so langweilt?“ sagt Skroszny zu Robert Volack, laut genug, daß er es hören muß.
„Vielleicht kann er zwischendurch Mausers Socken stopfen?“ schlägt Robert vor.
„Wenn Schmude die stopft, paßt Mauser nachher nicht mehr rein“, mutmaßt Skroszny und ruft dann nach oben: „Tu mal was zur Unterhaltung. Los, ein Lied! Drei, vier ...“
Und Schmude brüllt los, als ob er auf das Kommando gewartet hätte: „In einem Polenstädtchen, da wohnte einst ein Mädchen, die war so schööön! Und gleich beim allerersten Kuß zog ich den Reißverschluß, aber du, aber du, sprach sie, kriegst grüne Knie!“
„Ich weiß was Besseres“, unkt Skroszny weiter. „Weil er sich hier ausruht, soll er uns was von seiner Ration abgeben.“
„Und er kann uns die Schuhe putzen“, setzt Emil einen drauf.
Inzwischen ist die Tonne voll, Emil wirft eine letzte Schip-pe voll auf und ruft, immer noch lachend: „Zieh auf!“
Die Winde kreischt beim Anlaufen, der Kübel steigt schwankend nach oben. Schmude hängt ihn in einen von der Decke baumelnden Haken, löst das Seil der Winde, hakt es am Boden des Kübels ein und kippt mit Hilfe der Winde den Inhalt in den Hunt. Er wird so voll, daß Steine wieder herunterkollern. Dann läßt er die Tonne wieder hinab, etwas zu flott, so daß sie aufkracht und die beiden in der Grube beiseite springen müssen.
Skroszny flucht: „Gottverdammich! Paß auf, du Pimpf! Sonst fahre ich nachher mit dir Fahrstuhl!“
Schmude ist sauer wegen der Wühlerei: „Ist doch nichts passiert. Du malochst hier wie ’n Verrückter, bloß um dich bei Mauser einzuschleimen.“
Skroszny ärgert sich über den Vorwurf: „Quatsch nicht so dämlich! Du kriegst doch auch fünf Francs für jeden Waggon, den wir jetzt raushauen.“ Und dann grinst er wieder: „Aber bei Madame Mauser käme ich schon mal in Versuchung.“ Er beginnt wieder zu schippen: „Hau ab und quatsche nicht!“
Schmude stemmt den schweren Hunt in Bewegung.
Der Brecher spuckt ununterbrochen zerkrümeltes Erz aus. Als ein steinerner Bach rauscht es zur Schütte des Ofens, der es mit drehendem Maul verschluckt.
Schmelzer kippt seine Ladung wieder in die Schütte: „Mach hinne! Nummer vierzehn.“ Er versucht, einen Waggon gutzumachen.
Frieda macht einen Kreidestrich auf die Tafel, neben viele andere: „Nummer dreizehn! Du hast in der Schule nicht aufgepaßt. Und zwölf und dreizehn – macht fünfundzwanzig! Das ist doch nicht mehr normal! Wenn wir so weitermachen, versauen wir uns jede Norm!“
Schmelzer will darüber nicht nachdenken: „Erst mal müssen sie uns fünf Waggons bezahlen. So ist die Vereinbarung. Und beschissen werden wir so und so. Wozu sich also aufregen?“
Die Schicht ist gelaufen, man hat mehr geschafft, als man sollte, aber dafür gibt es zunächst einmal die Zusatzver-pflegung und dann pro Nase fünfundzwanzig Francs. Das ist nicht viel, aber es summiert sich mit der Zeit. Deshalb haben die Männer beschlossen, vom Zusatzverdienst täglich fünf Francs in einen gemeinsamen Topf zu geben, um sich ein Radio zu kaufen. Sie wollen nicht mehr so von der Welt ab-geschnitten sein.
Das Licht des milden, frühsommerlichen Abends taucht die Landschaft in mattes Gold. Es veredelt Zerfall und Mangel zu Nostalgie und Romantik und macht selbst die Rattenburg und das verwilderte Grundstück anheimelnd. Die Männer sitzen vor dem Haus, am selbstgezimmerten Tisch, auf den mit Steinen und Knüppeln abgestützten Stufen des Hanges, auf Steinen – wo immer man sich niederlasssen kann. Auf einer umgestülpten Karbidtonne wird Karten gespielt. Einer intoniert auf der Mundharmonika das Lied von der Lili Marleen, andere summen mit.
Am Tisch schenkt Hein Skroszny aus einer Limonadenflasche Max einen halben Feldbecher voll: „Da, trink, Student!“, und schaut ihn erwartungsvoll an.
Max nimmt den Becher: „Schönen Dank!“, und gönnt sich einen großen Schluck. Danach reißt er Augen und Mund auf und schnappt nach Luft: „Was ist denn ...“
Skroszny und die anderen am Tisch brechen in Gelächter aus. Die vermeintliche Limonade ist hochprozentiger Treber-schnaps, auf den Max nicht gefaßt war.
„Der Teufel soll dich holen!“ japst er schließlich, immer noch mühsam nach Luft ringend.
Emil gibt therapeutische Ratschläge: „Wenn du damit öfter die Kehle spülst, kriegst du keine Erkältung mehr. Dat beizt dir alle Bakterien weg.“
„Danke für die Roßkur“, krächzt Max.
Skroszny will Max aus einer anderen Flasche Limonade eingießen: „Hier, verdünn mal. Dann schmeckt das Zeug nicht schlecht.“
Max traut ihm nicht und hält die Hand über seinen Becher: „Nee, nee! Wahrscheinlich verdünnst du mit Salzsäure.“
„Kannste ruhig trinken, ist richtige Limonade!“
Schließlich läßt sich Max nachschenken und spült die betäubte Kehle.
Emil strebt wieder nach Harmonie: „Eijentlich janz jemütlich hier. Wenn alles noch ’n bißchen komfortabler wär’, könnte man’s aushalten.“
Frömmich ist nicht so selbstgenügsam: „Ja, wenn wir das Sagen hätten ...“
Emil ärgert die überhebliche Tour: „Sag doch wat!“
Für Frömmich redet Emil zu kleinkariert: „Du weißt, was ich meine!“
Emil wieder hat etwas gegen Frömmichs Großtuerei: „Wozu willste wat sagen, wenn et dir jut jeht?“
Skroszny stimmt Frömmich zu, wenn auch nur, um Emil zu ärgern: „Emil, du bist ’ne Sklavenseele! Willste nicht lieber der Chef sein, als zu malochen?“
„Nee!“ sagt Emil entschieden, „Ich will bloß anständig arbeiten, wohnen und leben können. Und zu Hause ist sowieso alles übern Jordan.“
Max träumt: „Zu Hause haben wir einen Garten, so ’n Stück Wald, da hat mein Vater zwischen drei alte Kiefern ’ne Bank gebaut. Da sitzt es sich noch gemütlicher.“
„Zu Hause sitzt es sich immer gemütlicher“, wirft Karl Pfaffhausen ein, der nebenan an einer Mütze herumstichelt.
Skroszny ist weniger häuslich eingestellt: „Manchmal ist es in der Kneipe gemütlicher. Besonders wenn meine Alte wieder mal über mein Bier herzieht. Und ehe ich mir die Mühe mache, ihr aufs Maul zu hauen, geh’ ich lieber in die Kneipe.“
„Du prügelst deine Frau? Was bist du für ein mieser Kerl!“ Pfaffhausen kann sich solche Bemerkungen leisten. Er wirkt sehr integer und strahlt soviel Rechtschaffenheit aus, daß Skroszny, der kein Rowdy aus Prinzip ist, davor zurückweicht.
„Die braucht das ab und zu“, verteidigt er sich. „Was denkste, wie scharf die ist, wenn ich sie nach der Keile bürste.“
Frömmich kann es nicht lassen, Skroszny herauszufordern: „Wie ist das, wenn du Keile gekriegt hast, bist du dann auch besonders scharf?“
Skroszny sieht ihn von der Seite an: „Leg dich nicht mit mir an!“
„Menschenskinder, seid friedlich!“ sucht Bodo Schmude zu schlichten. „Wir hatten ooch ’ne Laube, und die Banke davor war ooch jemütlich – aba bloß drei Meta von de Nachbarlaube und fünf Meta von de S-Bahn entfernt. Kolonie Jemütlichkeit drei.“
Emil fragt Max: „Sag mal, wat studierst du denn eijentlich?“
„Ich will ja erst anfangen“, gesteht Max. „Vielleicht Meteorologie. Hoffentlich wird mein Kriegsabitur anerkannt.“
Schmude will wissen: „Metrolojie? Wat is ’n det?“
„Wetterfrosch“, übersetzt Frömmich.
Schmude zeigt Unverständnis: „Und wozu det? Det Wetter kannste doch sowieso nich ändern.“
Max: „Aber man will doch wissen, wie das Wetter wird. Wohin die Wolken ziehen, ob die Sonne scheint oder nicht, ob’s Sturm gibt und so weiter.“
Skroszny hält die Sache auch für mehr oder weniger sinnlos: „Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich’s Wetter oder es bleibt, wie es ist! Wolken schieben lernste nicht.“
„Wer weiß? Vielleicht kann man eines Tages auch Wolken schieben. Sieh dir doch an, wie die Flugzeuge mit den Kondensstreifen Wolken machen.“
Emil ist der Menschheit gegenüber skeptisch: „Den Ärger möcht’ ich erleben! Der eine will Sonne, der andre will Regen, der dritte braucht Wind zum Segeln, der vierte Windstille, damit ihn der Staub nicht ärjert.“
„Glaubst du nicht, daß die Menschen mit der Zeit vernünftiger werden und sich besser vertragen?“
„Nee, jlaub’ ich nich. Warum sitzen wir denn hier? Weil die Menschen aus dem ersten Weltkrieg nischt jelernt haben!“
Der mit der Mundharmonika spielt jetzt „Heimat, deine Sterne ...“, und Schmelzer imitiert die Schmalztöne des Herrn Strienz: „In der Fe-herne träum’ ich vom Heimatland!“
Die Gefangenen verrichten im Dorf alle möglichen Arbeiten, um etwas zusätzlich zu verdienen, gelegentlich aber auch, um einfach zu helfen. Sie machen alles, was anfällt, und sie können alles. Behaupten sie jedenfalls.
Max und Schmude haben den Auftrag angenommen, die Küche des Bistros zu streichen. Max hofft, dabei Marie-Paule zu treffen, und beide hoffen sie, mit der Malerei irgendwie klarzukommen.
Erfahrungen waren Max nur von stolzen Eltern, Onkeln und Tanten als Drei- oder Vierjährigem nachgesagt worden. Demzufolge hatte er sich während eines Urlaubsaufenthalts bemüht, den weißen Zimmertüren der Pension das gleiche hoffnungsvoll grüne Aussehen zu verleihen, wie es der Gartenzaun gerade erhielt. Die Bedeutung von Grundierung, Vorstrich, Lösungsmitteln usw. hatte sich ihm dabei leider nicht erschlossen, so daß er dem neuen Unternehmen als einem Abenteuer gegenübertritt. Außerdem stellt ihnen der Patron nur sehr kleine, eigentlich ungeeignete Pinsel zur Verfügung, was das Arbeitstempo von vornherein deutlich belastet.
Der Tag ist warm, das Herdfeuer heizt zusätzlich, sie schwitzen wie die Weltmeister. Sie trinken Wasser aus dem Hahn und schwitzen noch mehr. Schmude steigt von der Leiter und schimpft: „Sie ist zu dick! Verflucht noch mal.“
Max ist von der Hitze ganz döselig: „Wer ist zu dick?“
Schmudes Laune ist auch eingetrocknet, er reagiert sauer: „Na wer schon! Die Farbe. Die trocknet ein, die ist schon wie Sirup.“
Max fällt doch noch eine weitere Erfahrung mit der Malerei ein, an Bord von ‚Hans Lody‘, Januar fünfundvierzig: Im Kesselraum war ein Überhitzerrohr geplatzt, und der sechshundert Grad heiße Dampf hatte den Lack des Schornsteins Blasen schlagen und schwarz werden lassen. So verunziert konnte ein Schiff der Deutschen Kriegsmarine natürlich nicht auslaufen, und so mußten die Kadetten trotz des Frostes den Schornstein entern und neu lackieren. Bei der Kälte war der Lack zäh wie Kleister und die Aussicht, daß er trocknen würde, gleich null. Dafür blieben sie aber mit Händen und Arbeitszeug am Lack kleben und erfuhren unfreiwillig eine Art Tarnanstrich.
Max registriert jetzt ein wenig verwundert, daß Hitze den gleichen Effekt haben soll wie Kälte: „Müssen wir uns Verdünnung geben lassen“, meint er und ruft durch den Flur in die Gaststube: „Hallo! Monsieur le patron!“
Der dicke Wirt kommt hereingewatschelt: „Hä? Qu’est-ce qu’il y a?“
Max rührt demonstrativ in seinem Farbtopf und sucht nach Worten: „La couleur est trop ... dick. Trop ... Mensch! Was heißt dick?“
Schmude zuckt die Schultern.
Max deutet extrem schweres Rühren an: „C’est trop ...“
Der Wirt versteht: „Ah, ça devient trop epais. Ça fait la chaleur. Je comprends: La couleur sèche trop vite. Attendez!“ Aus dem Küchenregal nimmt er eine Flasche Olivenöl: „Voilà! Prenez ça!“
Max findet das eigenartig: „Was denn, Öl?“
Aber der Wirt scheint zu wissen, was er tut: „Mais oui! C’est de l’huile aux olives. C’est très bon.“ Er schüttet einen Schuß Öl in die Farbe: „Remuez maintenant!“ Er deutet das Rühren an.
Max beginnt, heftig zu rühren. Der Wirt geht wieder und läßt ihnen die Flasche da.
Schmude begutachtet die Farbe zweiflerisch: „Noch zu dicke. Jib noch ’n Schuß rin.“
Max ist skeptisch: „Das trocknet doch nie!“
„Is det unsere Sorje? Der Wirt hat jesacht, wir soll ’n et nehm, also nehm wa’t! Außerdem: Bei die Hitze vatrocknet sojar det Schmalz in’t Schwein.“ Sie beginnen wieder zu streichen.
Dann kommt wie erhofft Marie-Paule, mit einem Korb voll Gemüse und Kräutern. Sie grüßt freundlich, unverbindlich: „Bonjour, messieurs!“
Max und Schmude tönen gleichzeitig: „Bonjour, mademoiselle! Bonjour ...“ Sie sehen zu, wie sie ihren Korb absetzt, sich aufreckt und dann nochmals aus der Tür schaut, ob nicht der Wirt wieder zurückkommt.
Sie lächelt den beiden zu und verweilt einen Augenblick länger bei Max, als sie sagt: „Vous ne voulez-pas boire quelque chose? Un canon de rouge? Du vin?“, und sie macht die Geste des Trinkens.
Die beiden schauen sich an, im wesentlichen haben sie verstanden „trinken“, und nicken ihr zu: „Aber ja. S’il vous plaît.“
Marie-Paule langt zwei einfache gerade Gläser aus dem Regal, eine schon offene Flasche aus einer Kühlbox und gießt ein. „A votre santé!“ wünscht sie freundlich.
„Merci beaucoup“, bedankt sich Max höflich und Schmude, der schon trinkt, zieht nach und verschluckt sich dabei beinahe: „Merci. Santé, mademoiselle!“
Max hat nur einen Schluck getrunken und setzt das Glas ab, sie bedeutet ihm aber, auszutrinken: „Videz le!“, damit sie nachschenken kann.
Schmude hat schon ausgetrunken, und Max folgt ge-horsam. Marie-Paule schenkt ihnen erneut ein und nickt: „A votre santé!“
„Merci, mademoiselle!“
Sie wartet mit der Flasche in der Hand, ob sie austrinken wollen, aber Max schüttelt den Kopf: „Non, merci, ça suffit! Merci beaucoup.“ Auch Schmude, der einen Augenblick lang überlegt hat, ob er sein Glas wieder hinhalten soll, besinnt sich, daß zuviel Wein in der Hitze vielleicht doch nicht das Richtige wäre, und stellt sein Glas ab.
Marie-Paule deutet an, daß ihr heiß ist, und sagt, als Französin das H verschluckend: „Eiß!“
Schmude mißversteht: „Ja, Eis wäre auch jut.“
Max korrigiert ihn: „Nee, sie meint ‚heiß‘, nicht ‚Eis‘.“ Und zu Marie-Paule, mit besonderer Betonung: „H-eiß!“
Paule bestätigt: „Aiß! Chaud“, und beginnt, ihr Gemüse auszupacken.
Die beiden Maler wenden sich wieder ihrer Arbeit zu.
Dann steigt Paule auf eine Trittleiter und reckt sich hoch, um vom hohen Küchenschrank einen großen Durchschlag herabzuholen.
Schmude stößt Max an und deutet mit dem Kopf zu ihr hin. Ihr Rock ist nicht allzu lang und ihre wohlgeformten Beine sind noch zwei Handbreit über den Kniekehlen zu sehen.
Max wird es noch wärmer, als ihm schon ist.
Schmude kann seine Zoten nicht lassen und fragt Max: „Kennst du den Witz von dem Mann, der ’ne pucklige Frau geheiratet hat?“
Max schaut entsetzt zu Marie-Paule, die aber nicht sichtbar reagiert, zeigt Schmude einen Vogel und sagt leise: „Du hast sie wohl nicht alle!“
Schmude versteht nicht: „Was haste denn? Die versteht doch kein Deutsch.“
Max findet das gemein und wird wütend: „Das spielt doch keine Rolle! Außerdem: Woher willste ’n das wissen?“
Marie-Paule spült inzwischen die beiden Gläser aus. Beim Abtrocknen lächelt sie Max zu, dann wendet sie sich zum Gehen: „Au revoir, messieurs! Auf ... Wieder-sehn!“ Sie lächelt nochmals und geht.
Max starrt die Türöffnung an, durch die sie verschwunden ist, als ob er hypnotisiert sei.
Schmude grinst: „Da haste ja ’ne Eroberung gemacht! Hübsche Titten scheint sie zu haben.“
„Kannst du denn an nichts andres denken?“ faucht Max.
„Warum soll ick denn?“ grinst Schmude genüßlich, „det sind doch sehr schöne Jedanken.“
Max fühlt sich in Person von Marie-Paule verletzt: „Du hast eine dreckige Phantasie! Kann dir nicht mal was Schönes einfallen?“
Schmude grinst etwas verunsichert, verteidigt aber seine Vision: „Du weeßt bloß nich, wat schön is! Det is doch schön. Mußte bloß mal probieren.“
Max sieht, daß er mit Schmude über Anstand und Liebe nicht diskutieren kann, und er schneidet ein anderes Thema an: „Wie kommste eigentlich mit Skroszny klar?“
Schmude ist leicht abzulenken und gibt Auskunft: „Der hat ’ne große Schnauze, ist aber sonst ganz in Ordnung.“
„Und seine Wühlerei?“
„Wir verdienen ja damit. Und er is im Loch, und ick bin oben. Und wenn die Tonne voll ist, ziehe ick se hoch. Det is alles. Und du? Der Frömmich? Wat is ’n det für ’n Typ?“
„Erzählt hat er, daß er Grobschmied gelernt hat und später Motorenschlosser, er hat auch mal im Steinbruch gearbeitet – und nebenbei war er Motorrad-Rennfahrer. Der hat schon ’ne Menge erlebt.“
„So sieht er auch aus!“ sagt Schmude. „Jib mal noch ’n Schuß Öl in die Farbe.“
Max hat seine Zweifel: „Mann! Hier dürfen wir uns nie wieder sehen lassen.“
Tünnes und Frieda schleppen einen großen Karton von der Poststelle zur Rattenburg, Bodo, Robert, Willi und andere formieren einen Geleitzug. Im Quartier drängt sich sofort ein halbes Dutzend weiterer Kameraden um sie, neugierig auf das neue Radio! Ein Empfänger mit drei Wellenbereichen, zwei Lautsprechern und einem prachtvollen Gehäuse aus Mahagoni-Imitation. Ein richtiges Möbelstück.
Es wird vorsichtig aus dem Karton gehoben. Die beiliegende Zimmerantenne rutscht heraus. „Mensch, paß doch auf!“ Es ist aber nichts passiert. Dann wird der Apparat aus dem Seidenpapier geschält. „Dolles Gerät! Stell’s da auf die Kiste.“ Das Radio erhält seinen Platz auf der Apfelsinenkiste, die Max als Nachtschrank dient.
Max verzichtet gern auf den Komfort seines Nachttischs, wenn dadurch das Radio in seine Reichweite kommt.
„Los, schließ es mal an!“ Die Steckdose ist neben der Tür zur Küche, und am Radio sind gerade mal zwei Meter Anschlußschnur.
„Wartet mal! Im Schuppen lag doch ein Ende Telefonstrippe.“ – „Das hier sind doch hundertzehn Volt! Die kannste doch nicht an eine Telefonstrippe hängen.“ – „Ist ja nur vorübergehend, bis wir ’ne andere Schnur besorgt haben.“ Schmude rennt hinaus und kommt mit einem Knäuel Stahllitze zurück, wie sie für ein Feldtelefon gebraucht wird: „Hier, das muß doch gehen.“ – „Gib mal her!“ Willi entwirrt das Knäuel, nicht ohne Mühe, die Stahlfäden der Litze wollen nicht von ihrer alten Form lassen, schließlich aber schafft er es doch, wenn man einige Locken in Kauf nimmt. Die Enden werden abisoliert und das eine unter die Schrauben des Steckers geklemmt, der mit Papier und einem Lappen isoliert wird, das andere Ende kommt in die Steckdose und wird mit zwei Holzstückchen festgekeilt.
Frieda darf als Lagerältester den Schalter betätigen. Knips! Die Skalenlampe leuchtet auf. Zunächst hört man nichts. Frieda dreht am Knopf für die Senderwahl. Noch nichts! „Der muß doch erst warm werden“, beruhigt Tünnes die Ungeduldigen. Ein Rauschen ertönt. Frieda betätigt wieder den Drehknopf, das Rauschen wird stärker, dann wieder schwächer. Plötzlich kräht Schmude los: „Määnsch! Die Antenne!“ Sie haben vergessen, die Antenne anzuschließen. Willi sucht den Antenneneingang, und als er den Stecker hineinsteckt, ertönt eine Stimme in französischer Sprache und löst spontanes Beifallsgeschrei aus. Robert sagt trocken: „Kann der auch deutsch?“
„Müssen wir suchen. Auf Kurzwelle müssen auch deutsche Sender kommen.“ Wieder wird nach anderen Sendern gesucht, die zum Teil aber nur sehr leise einfallen, Französisch, Englisch, auch einer in arabischer Sprache. „Is ja phantastisch, was wir da kriegen!“ spottet Sigi. „Mensch, wir sind mitten in den Bergen. Wir müssen uns ’ne Antenne bis unters Dach ziehen, dann wirste schon sehen.“
Inzwischen hat Frieda Musik gefunden, Musettewalzer auf dem Akkordeon, und Tünnes ergreift Willi um die Hüfte und beginnt mit ihm um den Tisch zu walzen: „Seht ihr! So viel Französisch versteht jeder von uns!“ Max und Schmude, Frieda und Robert tanzen mit.
Frieda ist außer Puste, als er sagt: „Wir werden einen Informationsdienst einrichten. Wer Französisch oder Englisch kann, hört die Nachrichten und übersetzt sie dann den anderen. (PK)
Lesen Sie die Fortsetzung des biografischen Romans in der kommenden Ausgabe, oder - bequemer - bestellen Sie das Buch bei edition winterwork
Online-Flyer Nr. 307 vom 22.06.2011
Druckversion
Literatur
Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 14
Max - Jahrgang 27
Von Lutz Köhlert

Im Wasserloch machen Hein Skroszny und Emil Lehmbäcker eine Doppelschicht. Skroszny hat so viel Material geschossen, daß Bodo Schmude und Sigi Welle es unmöglich allein hätten räumen können. Sie sind schon beim dreizehnten Waggon, und es liegen mindestens noch drei Waggons voll am Boden. Sie könnten sich die Arbeit einteilen und noch was für den nächsten Tag übriglassen, aber Skroszny will alle Rekorde brechen.
In dem an drei Meter tiefen, etwa zweieinhalb Meter breiten Loch schippen Skroszny und Emil schlammiges Geröll in die Tonne.
Schmude lehnt neben dem Loch an einem leeren Hunt und wartet darauf, daß er aufziehen kann. Obwohl sie unter der Last der Arbeit ächzen und ihnen der Schweiß am Körper herabrinnt, machen sie Witze.
„Was machen wir denn mit Bodo, daß er sich nicht so langweilt?“ sagt Skroszny zu Robert Volack, laut genug, daß er es hören muß.
„Vielleicht kann er zwischendurch Mausers Socken stopfen?“ schlägt Robert vor.
„Wenn Schmude die stopft, paßt Mauser nachher nicht mehr rein“, mutmaßt Skroszny und ruft dann nach oben: „Tu mal was zur Unterhaltung. Los, ein Lied! Drei, vier ...“
Und Schmude brüllt los, als ob er auf das Kommando gewartet hätte: „In einem Polenstädtchen, da wohnte einst ein Mädchen, die war so schööön! Und gleich beim allerersten Kuß zog ich den Reißverschluß, aber du, aber du, sprach sie, kriegst grüne Knie!“
„Ich weiß was Besseres“, unkt Skroszny weiter. „Weil er sich hier ausruht, soll er uns was von seiner Ration abgeben.“
„Und er kann uns die Schuhe putzen“, setzt Emil einen drauf.
Inzwischen ist die Tonne voll, Emil wirft eine letzte Schip-pe voll auf und ruft, immer noch lachend: „Zieh auf!“
Die Winde kreischt beim Anlaufen, der Kübel steigt schwankend nach oben. Schmude hängt ihn in einen von der Decke baumelnden Haken, löst das Seil der Winde, hakt es am Boden des Kübels ein und kippt mit Hilfe der Winde den Inhalt in den Hunt. Er wird so voll, daß Steine wieder herunterkollern. Dann läßt er die Tonne wieder hinab, etwas zu flott, so daß sie aufkracht und die beiden in der Grube beiseite springen müssen.
Skroszny flucht: „Gottverdammich! Paß auf, du Pimpf! Sonst fahre ich nachher mit dir Fahrstuhl!“
Schmude ist sauer wegen der Wühlerei: „Ist doch nichts passiert. Du malochst hier wie ’n Verrückter, bloß um dich bei Mauser einzuschleimen.“
Skroszny ärgert sich über den Vorwurf: „Quatsch nicht so dämlich! Du kriegst doch auch fünf Francs für jeden Waggon, den wir jetzt raushauen.“ Und dann grinst er wieder: „Aber bei Madame Mauser käme ich schon mal in Versuchung.“ Er beginnt wieder zu schippen: „Hau ab und quatsche nicht!“
Schmude stemmt den schweren Hunt in Bewegung.
Der Brecher spuckt ununterbrochen zerkrümeltes Erz aus. Als ein steinerner Bach rauscht es zur Schütte des Ofens, der es mit drehendem Maul verschluckt.
Schmelzer kippt seine Ladung wieder in die Schütte: „Mach hinne! Nummer vierzehn.“ Er versucht, einen Waggon gutzumachen.
Frieda macht einen Kreidestrich auf die Tafel, neben viele andere: „Nummer dreizehn! Du hast in der Schule nicht aufgepaßt. Und zwölf und dreizehn – macht fünfundzwanzig! Das ist doch nicht mehr normal! Wenn wir so weitermachen, versauen wir uns jede Norm!“
Schmelzer will darüber nicht nachdenken: „Erst mal müssen sie uns fünf Waggons bezahlen. So ist die Vereinbarung. Und beschissen werden wir so und so. Wozu sich also aufregen?“
*
Die Schicht ist gelaufen, man hat mehr geschafft, als man sollte, aber dafür gibt es zunächst einmal die Zusatzver-pflegung und dann pro Nase fünfundzwanzig Francs. Das ist nicht viel, aber es summiert sich mit der Zeit. Deshalb haben die Männer beschlossen, vom Zusatzverdienst täglich fünf Francs in einen gemeinsamen Topf zu geben, um sich ein Radio zu kaufen. Sie wollen nicht mehr so von der Welt ab-geschnitten sein.
Das Licht des milden, frühsommerlichen Abends taucht die Landschaft in mattes Gold. Es veredelt Zerfall und Mangel zu Nostalgie und Romantik und macht selbst die Rattenburg und das verwilderte Grundstück anheimelnd. Die Männer sitzen vor dem Haus, am selbstgezimmerten Tisch, auf den mit Steinen und Knüppeln abgestützten Stufen des Hanges, auf Steinen – wo immer man sich niederlasssen kann. Auf einer umgestülpten Karbidtonne wird Karten gespielt. Einer intoniert auf der Mundharmonika das Lied von der Lili Marleen, andere summen mit.
Am Tisch schenkt Hein Skroszny aus einer Limonadenflasche Max einen halben Feldbecher voll: „Da, trink, Student!“, und schaut ihn erwartungsvoll an.
Max nimmt den Becher: „Schönen Dank!“, und gönnt sich einen großen Schluck. Danach reißt er Augen und Mund auf und schnappt nach Luft: „Was ist denn ...“
Skroszny und die anderen am Tisch brechen in Gelächter aus. Die vermeintliche Limonade ist hochprozentiger Treber-schnaps, auf den Max nicht gefaßt war.
„Der Teufel soll dich holen!“ japst er schließlich, immer noch mühsam nach Luft ringend.
Emil gibt therapeutische Ratschläge: „Wenn du damit öfter die Kehle spülst, kriegst du keine Erkältung mehr. Dat beizt dir alle Bakterien weg.“
„Danke für die Roßkur“, krächzt Max.
Skroszny will Max aus einer anderen Flasche Limonade eingießen: „Hier, verdünn mal. Dann schmeckt das Zeug nicht schlecht.“
Max traut ihm nicht und hält die Hand über seinen Becher: „Nee, nee! Wahrscheinlich verdünnst du mit Salzsäure.“
„Kannste ruhig trinken, ist richtige Limonade!“
Schließlich läßt sich Max nachschenken und spült die betäubte Kehle.
Emil strebt wieder nach Harmonie: „Eijentlich janz jemütlich hier. Wenn alles noch ’n bißchen komfortabler wär’, könnte man’s aushalten.“
Frömmich ist nicht so selbstgenügsam: „Ja, wenn wir das Sagen hätten ...“
Emil ärgert die überhebliche Tour: „Sag doch wat!“
Für Frömmich redet Emil zu kleinkariert: „Du weißt, was ich meine!“
Emil wieder hat etwas gegen Frömmichs Großtuerei: „Wozu willste wat sagen, wenn et dir jut jeht?“
Skroszny stimmt Frömmich zu, wenn auch nur, um Emil zu ärgern: „Emil, du bist ’ne Sklavenseele! Willste nicht lieber der Chef sein, als zu malochen?“
„Nee!“ sagt Emil entschieden, „Ich will bloß anständig arbeiten, wohnen und leben können. Und zu Hause ist sowieso alles übern Jordan.“
Max träumt: „Zu Hause haben wir einen Garten, so ’n Stück Wald, da hat mein Vater zwischen drei alte Kiefern ’ne Bank gebaut. Da sitzt es sich noch gemütlicher.“
„Zu Hause sitzt es sich immer gemütlicher“, wirft Karl Pfaffhausen ein, der nebenan an einer Mütze herumstichelt.
Skroszny ist weniger häuslich eingestellt: „Manchmal ist es in der Kneipe gemütlicher. Besonders wenn meine Alte wieder mal über mein Bier herzieht. Und ehe ich mir die Mühe mache, ihr aufs Maul zu hauen, geh’ ich lieber in die Kneipe.“
„Du prügelst deine Frau? Was bist du für ein mieser Kerl!“ Pfaffhausen kann sich solche Bemerkungen leisten. Er wirkt sehr integer und strahlt soviel Rechtschaffenheit aus, daß Skroszny, der kein Rowdy aus Prinzip ist, davor zurückweicht.
„Die braucht das ab und zu“, verteidigt er sich. „Was denkste, wie scharf die ist, wenn ich sie nach der Keile bürste.“
Frömmich kann es nicht lassen, Skroszny herauszufordern: „Wie ist das, wenn du Keile gekriegt hast, bist du dann auch besonders scharf?“
Skroszny sieht ihn von der Seite an: „Leg dich nicht mit mir an!“
„Menschenskinder, seid friedlich!“ sucht Bodo Schmude zu schlichten. „Wir hatten ooch ’ne Laube, und die Banke davor war ooch jemütlich – aba bloß drei Meta von de Nachbarlaube und fünf Meta von de S-Bahn entfernt. Kolonie Jemütlichkeit drei.“
Emil fragt Max: „Sag mal, wat studierst du denn eijentlich?“
„Ich will ja erst anfangen“, gesteht Max. „Vielleicht Meteorologie. Hoffentlich wird mein Kriegsabitur anerkannt.“
Schmude will wissen: „Metrolojie? Wat is ’n det?“
„Wetterfrosch“, übersetzt Frömmich.
Schmude zeigt Unverständnis: „Und wozu det? Det Wetter kannste doch sowieso nich ändern.“
Max: „Aber man will doch wissen, wie das Wetter wird. Wohin die Wolken ziehen, ob die Sonne scheint oder nicht, ob’s Sturm gibt und so weiter.“
Skroszny hält die Sache auch für mehr oder weniger sinnlos: „Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich’s Wetter oder es bleibt, wie es ist! Wolken schieben lernste nicht.“
„Wer weiß? Vielleicht kann man eines Tages auch Wolken schieben. Sieh dir doch an, wie die Flugzeuge mit den Kondensstreifen Wolken machen.“
Emil ist der Menschheit gegenüber skeptisch: „Den Ärger möcht’ ich erleben! Der eine will Sonne, der andre will Regen, der dritte braucht Wind zum Segeln, der vierte Windstille, damit ihn der Staub nicht ärjert.“
„Glaubst du nicht, daß die Menschen mit der Zeit vernünftiger werden und sich besser vertragen?“
„Nee, jlaub’ ich nich. Warum sitzen wir denn hier? Weil die Menschen aus dem ersten Weltkrieg nischt jelernt haben!“
Der mit der Mundharmonika spielt jetzt „Heimat, deine Sterne ...“, und Schmelzer imitiert die Schmalztöne des Herrn Strienz: „In der Fe-herne träum’ ich vom Heimatland!“
*
Die Gefangenen verrichten im Dorf alle möglichen Arbeiten, um etwas zusätzlich zu verdienen, gelegentlich aber auch, um einfach zu helfen. Sie machen alles, was anfällt, und sie können alles. Behaupten sie jedenfalls.
Max und Schmude haben den Auftrag angenommen, die Küche des Bistros zu streichen. Max hofft, dabei Marie-Paule zu treffen, und beide hoffen sie, mit der Malerei irgendwie klarzukommen.
Erfahrungen waren Max nur von stolzen Eltern, Onkeln und Tanten als Drei- oder Vierjährigem nachgesagt worden. Demzufolge hatte er sich während eines Urlaubsaufenthalts bemüht, den weißen Zimmertüren der Pension das gleiche hoffnungsvoll grüne Aussehen zu verleihen, wie es der Gartenzaun gerade erhielt. Die Bedeutung von Grundierung, Vorstrich, Lösungsmitteln usw. hatte sich ihm dabei leider nicht erschlossen, so daß er dem neuen Unternehmen als einem Abenteuer gegenübertritt. Außerdem stellt ihnen der Patron nur sehr kleine, eigentlich ungeeignete Pinsel zur Verfügung, was das Arbeitstempo von vornherein deutlich belastet.
Der Tag ist warm, das Herdfeuer heizt zusätzlich, sie schwitzen wie die Weltmeister. Sie trinken Wasser aus dem Hahn und schwitzen noch mehr. Schmude steigt von der Leiter und schimpft: „Sie ist zu dick! Verflucht noch mal.“
Max ist von der Hitze ganz döselig: „Wer ist zu dick?“
Schmudes Laune ist auch eingetrocknet, er reagiert sauer: „Na wer schon! Die Farbe. Die trocknet ein, die ist schon wie Sirup.“
Max fällt doch noch eine weitere Erfahrung mit der Malerei ein, an Bord von ‚Hans Lody‘, Januar fünfundvierzig: Im Kesselraum war ein Überhitzerrohr geplatzt, und der sechshundert Grad heiße Dampf hatte den Lack des Schornsteins Blasen schlagen und schwarz werden lassen. So verunziert konnte ein Schiff der Deutschen Kriegsmarine natürlich nicht auslaufen, und so mußten die Kadetten trotz des Frostes den Schornstein entern und neu lackieren. Bei der Kälte war der Lack zäh wie Kleister und die Aussicht, daß er trocknen würde, gleich null. Dafür blieben sie aber mit Händen und Arbeitszeug am Lack kleben und erfuhren unfreiwillig eine Art Tarnanstrich.
Max registriert jetzt ein wenig verwundert, daß Hitze den gleichen Effekt haben soll wie Kälte: „Müssen wir uns Verdünnung geben lassen“, meint er und ruft durch den Flur in die Gaststube: „Hallo! Monsieur le patron!“
Der dicke Wirt kommt hereingewatschelt: „Hä? Qu’est-ce qu’il y a?“
Max rührt demonstrativ in seinem Farbtopf und sucht nach Worten: „La couleur est trop ... dick. Trop ... Mensch! Was heißt dick?“
Schmude zuckt die Schultern.
Max deutet extrem schweres Rühren an: „C’est trop ...“
Der Wirt versteht: „Ah, ça devient trop epais. Ça fait la chaleur. Je comprends: La couleur sèche trop vite. Attendez!“ Aus dem Küchenregal nimmt er eine Flasche Olivenöl: „Voilà! Prenez ça!“
Max findet das eigenartig: „Was denn, Öl?“
Aber der Wirt scheint zu wissen, was er tut: „Mais oui! C’est de l’huile aux olives. C’est très bon.“ Er schüttet einen Schuß Öl in die Farbe: „Remuez maintenant!“ Er deutet das Rühren an.
Max beginnt, heftig zu rühren. Der Wirt geht wieder und läßt ihnen die Flasche da.
Schmude begutachtet die Farbe zweiflerisch: „Noch zu dicke. Jib noch ’n Schuß rin.“
Max ist skeptisch: „Das trocknet doch nie!“
„Is det unsere Sorje? Der Wirt hat jesacht, wir soll ’n et nehm, also nehm wa’t! Außerdem: Bei die Hitze vatrocknet sojar det Schmalz in’t Schwein.“ Sie beginnen wieder zu streichen.
Dann kommt wie erhofft Marie-Paule, mit einem Korb voll Gemüse und Kräutern. Sie grüßt freundlich, unverbindlich: „Bonjour, messieurs!“
Max und Schmude tönen gleichzeitig: „Bonjour, mademoiselle! Bonjour ...“ Sie sehen zu, wie sie ihren Korb absetzt, sich aufreckt und dann nochmals aus der Tür schaut, ob nicht der Wirt wieder zurückkommt.
Sie lächelt den beiden zu und verweilt einen Augenblick länger bei Max, als sie sagt: „Vous ne voulez-pas boire quelque chose? Un canon de rouge? Du vin?“, und sie macht die Geste des Trinkens.
Die beiden schauen sich an, im wesentlichen haben sie verstanden „trinken“, und nicken ihr zu: „Aber ja. S’il vous plaît.“
Marie-Paule langt zwei einfache gerade Gläser aus dem Regal, eine schon offene Flasche aus einer Kühlbox und gießt ein. „A votre santé!“ wünscht sie freundlich.
„Merci beaucoup“, bedankt sich Max höflich und Schmude, der schon trinkt, zieht nach und verschluckt sich dabei beinahe: „Merci. Santé, mademoiselle!“
Max hat nur einen Schluck getrunken und setzt das Glas ab, sie bedeutet ihm aber, auszutrinken: „Videz le!“, damit sie nachschenken kann.
Schmude hat schon ausgetrunken, und Max folgt ge-horsam. Marie-Paule schenkt ihnen erneut ein und nickt: „A votre santé!“
„Merci, mademoiselle!“
Sie wartet mit der Flasche in der Hand, ob sie austrinken wollen, aber Max schüttelt den Kopf: „Non, merci, ça suffit! Merci beaucoup.“ Auch Schmude, der einen Augenblick lang überlegt hat, ob er sein Glas wieder hinhalten soll, besinnt sich, daß zuviel Wein in der Hitze vielleicht doch nicht das Richtige wäre, und stellt sein Glas ab.
Marie-Paule deutet an, daß ihr heiß ist, und sagt, als Französin das H verschluckend: „Eiß!“
Schmude mißversteht: „Ja, Eis wäre auch jut.“
Max korrigiert ihn: „Nee, sie meint ‚heiß‘, nicht ‚Eis‘.“ Und zu Marie-Paule, mit besonderer Betonung: „H-eiß!“
Paule bestätigt: „Aiß! Chaud“, und beginnt, ihr Gemüse auszupacken.
Die beiden Maler wenden sich wieder ihrer Arbeit zu.
Dann steigt Paule auf eine Trittleiter und reckt sich hoch, um vom hohen Küchenschrank einen großen Durchschlag herabzuholen.
Schmude stößt Max an und deutet mit dem Kopf zu ihr hin. Ihr Rock ist nicht allzu lang und ihre wohlgeformten Beine sind noch zwei Handbreit über den Kniekehlen zu sehen.
Max wird es noch wärmer, als ihm schon ist.
Schmude kann seine Zoten nicht lassen und fragt Max: „Kennst du den Witz von dem Mann, der ’ne pucklige Frau geheiratet hat?“
Max schaut entsetzt zu Marie-Paule, die aber nicht sichtbar reagiert, zeigt Schmude einen Vogel und sagt leise: „Du hast sie wohl nicht alle!“
Schmude versteht nicht: „Was haste denn? Die versteht doch kein Deutsch.“
Max findet das gemein und wird wütend: „Das spielt doch keine Rolle! Außerdem: Woher willste ’n das wissen?“
Marie-Paule spült inzwischen die beiden Gläser aus. Beim Abtrocknen lächelt sie Max zu, dann wendet sie sich zum Gehen: „Au revoir, messieurs! Auf ... Wieder-sehn!“ Sie lächelt nochmals und geht.
Max starrt die Türöffnung an, durch die sie verschwunden ist, als ob er hypnotisiert sei.
Schmude grinst: „Da haste ja ’ne Eroberung gemacht! Hübsche Titten scheint sie zu haben.“
„Kannst du denn an nichts andres denken?“ faucht Max.
„Warum soll ick denn?“ grinst Schmude genüßlich, „det sind doch sehr schöne Jedanken.“
Max fühlt sich in Person von Marie-Paule verletzt: „Du hast eine dreckige Phantasie! Kann dir nicht mal was Schönes einfallen?“
Schmude grinst etwas verunsichert, verteidigt aber seine Vision: „Du weeßt bloß nich, wat schön is! Det is doch schön. Mußte bloß mal probieren.“
Max sieht, daß er mit Schmude über Anstand und Liebe nicht diskutieren kann, und er schneidet ein anderes Thema an: „Wie kommste eigentlich mit Skroszny klar?“
Schmude ist leicht abzulenken und gibt Auskunft: „Der hat ’ne große Schnauze, ist aber sonst ganz in Ordnung.“
„Und seine Wühlerei?“
„Wir verdienen ja damit. Und er is im Loch, und ick bin oben. Und wenn die Tonne voll ist, ziehe ick se hoch. Det is alles. Und du? Der Frömmich? Wat is ’n det für ’n Typ?“
„Erzählt hat er, daß er Grobschmied gelernt hat und später Motorenschlosser, er hat auch mal im Steinbruch gearbeitet – und nebenbei war er Motorrad-Rennfahrer. Der hat schon ’ne Menge erlebt.“
„So sieht er auch aus!“ sagt Schmude. „Jib mal noch ’n Schuß Öl in die Farbe.“
Max hat seine Zweifel: „Mann! Hier dürfen wir uns nie wieder sehen lassen.“
*
Tünnes und Frieda schleppen einen großen Karton von der Poststelle zur Rattenburg, Bodo, Robert, Willi und andere formieren einen Geleitzug. Im Quartier drängt sich sofort ein halbes Dutzend weiterer Kameraden um sie, neugierig auf das neue Radio! Ein Empfänger mit drei Wellenbereichen, zwei Lautsprechern und einem prachtvollen Gehäuse aus Mahagoni-Imitation. Ein richtiges Möbelstück.
Es wird vorsichtig aus dem Karton gehoben. Die beiliegende Zimmerantenne rutscht heraus. „Mensch, paß doch auf!“ Es ist aber nichts passiert. Dann wird der Apparat aus dem Seidenpapier geschält. „Dolles Gerät! Stell’s da auf die Kiste.“ Das Radio erhält seinen Platz auf der Apfelsinenkiste, die Max als Nachtschrank dient.
Max verzichtet gern auf den Komfort seines Nachttischs, wenn dadurch das Radio in seine Reichweite kommt.
„Los, schließ es mal an!“ Die Steckdose ist neben der Tür zur Küche, und am Radio sind gerade mal zwei Meter Anschlußschnur.
„Wartet mal! Im Schuppen lag doch ein Ende Telefonstrippe.“ – „Das hier sind doch hundertzehn Volt! Die kannste doch nicht an eine Telefonstrippe hängen.“ – „Ist ja nur vorübergehend, bis wir ’ne andere Schnur besorgt haben.“ Schmude rennt hinaus und kommt mit einem Knäuel Stahllitze zurück, wie sie für ein Feldtelefon gebraucht wird: „Hier, das muß doch gehen.“ – „Gib mal her!“ Willi entwirrt das Knäuel, nicht ohne Mühe, die Stahlfäden der Litze wollen nicht von ihrer alten Form lassen, schließlich aber schafft er es doch, wenn man einige Locken in Kauf nimmt. Die Enden werden abisoliert und das eine unter die Schrauben des Steckers geklemmt, der mit Papier und einem Lappen isoliert wird, das andere Ende kommt in die Steckdose und wird mit zwei Holzstückchen festgekeilt.
Frieda darf als Lagerältester den Schalter betätigen. Knips! Die Skalenlampe leuchtet auf. Zunächst hört man nichts. Frieda dreht am Knopf für die Senderwahl. Noch nichts! „Der muß doch erst warm werden“, beruhigt Tünnes die Ungeduldigen. Ein Rauschen ertönt. Frieda betätigt wieder den Drehknopf, das Rauschen wird stärker, dann wieder schwächer. Plötzlich kräht Schmude los: „Määnsch! Die Antenne!“ Sie haben vergessen, die Antenne anzuschließen. Willi sucht den Antenneneingang, und als er den Stecker hineinsteckt, ertönt eine Stimme in französischer Sprache und löst spontanes Beifallsgeschrei aus. Robert sagt trocken: „Kann der auch deutsch?“
„Müssen wir suchen. Auf Kurzwelle müssen auch deutsche Sender kommen.“ Wieder wird nach anderen Sendern gesucht, die zum Teil aber nur sehr leise einfallen, Französisch, Englisch, auch einer in arabischer Sprache. „Is ja phantastisch, was wir da kriegen!“ spottet Sigi. „Mensch, wir sind mitten in den Bergen. Wir müssen uns ’ne Antenne bis unters Dach ziehen, dann wirste schon sehen.“
Inzwischen hat Frieda Musik gefunden, Musettewalzer auf dem Akkordeon, und Tünnes ergreift Willi um die Hüfte und beginnt mit ihm um den Tisch zu walzen: „Seht ihr! So viel Französisch versteht jeder von uns!“ Max und Schmude, Frieda und Robert tanzen mit.
Frieda ist außer Puste, als er sagt: „Wir werden einen Informationsdienst einrichten. Wer Französisch oder Englisch kann, hört die Nachrichten und übersetzt sie dann den anderen. (PK)
Lesen Sie die Fortsetzung des biografischen Romans in der kommenden Ausgabe, oder - bequemer - bestellen Sie das Buch bei edition winterwork
Online-Flyer Nr. 307 vom 22.06.2011
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE
















 Max, Jahrgang 1927, 16jähriger Luftwaffenhelfer, später Kadett der Kriegsmarine auf dem Zerstörer „Hans Lody“, schildert seine Erlebnisse während des Krieges und in französischer Kriegsgefangenschaft. Seine Erinnerungen kreisen um die Arbeit im Bergwerk, um die erste Liebe zu der Französin Marie-Paule, die vergeblichen Fluchten und die endliche Heimkehr in das besetzte Deutschland. Reflexionen über die Sinnlosigkeit und Grausamkeit des Krieges haben angesichts weltweiter kriegerischer Aktivitäten nichts von ihrer Aktualität verloren.
Max, Jahrgang 1927, 16jähriger Luftwaffenhelfer, später Kadett der Kriegsmarine auf dem Zerstörer „Hans Lody“, schildert seine Erlebnisse während des Krieges und in französischer Kriegsgefangenschaft. Seine Erinnerungen kreisen um die Arbeit im Bergwerk, um die erste Liebe zu der Französin Marie-Paule, die vergeblichen Fluchten und die endliche Heimkehr in das besetzte Deutschland. Reflexionen über die Sinnlosigkeit und Grausamkeit des Krieges haben angesichts weltweiter kriegerischer Aktivitäten nichts von ihrer Aktualität verloren.