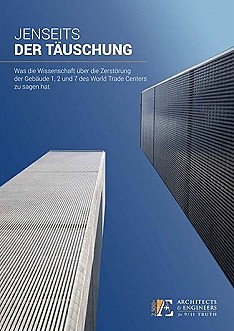SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Literatur
Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 11
Max - Jahrgang 27
Von Lutz Köhlert

Max nimmt sich täglich zehn Worte Französisch vor und beginnt mit den Zahlen.
„Un, deux, trois, quatre, cinq, six ...“, zählt er seine Schritte hinter dem Hunt. Das hilft über die Monotonie der Arbeit hinweg und wird für ihn nützlich. Andere Kumpel quälen sich nicht mit der fremden Sprache, aber für Max ist das Lernen Vergnügen.
Auf dem Schrägaufzug wartet ein leeren Wagen. Max zerrt ihn herab und schubst ihn auf das Ausweichgleis. Er wuchtet den vollen Wagen mit einer halben Tonne Erz auf die Bühne. Wenn man weiß, wie man anfassen und das Körpergewicht einsetzen muß, läßt sich der schwere Karren ankippen, drehen, regieren. Max klinkt die Sicherung ein und schreit nach oben: „Nummer zehn fertig!“
Von oben tönt Mausers Stimme: „Komm auf! Viens ici.“
Max schreit wieder nach oben: „Und der leere Waggon?“
Mauser bescheidet: „Laß stehen. Karl-Heinz kommt unten.“
Max quetscht sich neben den Hunt auf die Aufzugsbühne: „Fertig! Zieh auf.“
Das Seil strafft sich, der Aufzug ruckt heftig an, so daß Max sich festhalten muß, und rollt dann an der Stollenwand schrapend nach oben. Aus dem Lichtkreis der Glühbirne taucht er fünfzig Meter tief in die Dunkelheit, kaum aufgehellt vom Licht seiner Grubenlampe, bis er oben wieder im Lichtkreis der Glühbirne auftaucht. Der Aufzug schlägt hart an den Prellbalken, der Hunt wackelt bedenklich, Max beeilt sich abzuspringen. Mauser hat den Aufzug gefahren. Neben ihm warten Schmelzer mit einem leeren Hunt und Karl-Heinz Witting, der schmale blonde junge Mann mit den weichen Bewegungen und der sanften Stimme. Er war im Krieg Sanitäter bei einer U-Boot-Versorgungseinheit und will einmal Arzt werden.
Jetzt begrüßt er Max: „Hallo! Wie geht’s?“
„Es geht wie man geht“, sagt Max. „Was willst ’n hier?“
„Ich soll dich ablösen.“
Max wundert sich und sieht Mauser an: „Nanu?“
Der erklärt ihm: „Salamah sein krank, du an ascenseur. Du kann doch Auto fahren, ja?“
Max ist sich da nicht so sicher. Er hat es noch nie probiert. Aber er will eine Schwäche nicht so ohne weiteres zugeben: „Auto? Wieso? Na ja ...“
Schmelzer versucht, sich ranzuschmeißen: „Vielleicht kann ich ...?“
Aber Mauser mag ihn offenbar nicht: „Du dicken Hintern besser bewegen! Nimm Waggon, und Abmarsch!“ Er winkt ihm, den vollen Hunt vom Aufzug zu ziehen, und schiebt selber den leeren auf die Bühne. Zu Max: „Du sitz hier! Tout est popelleicht. Hier Schalter Motor: Ein! Langsam! Schnell! Da Schalter Auf! und Ab! Und das hier c’est le frein, comment s’appelle ...?“
Karl-Heinz hilft ihm: „Bremse.“
„Ja, der Bremse. Du aufpass, schön doucement, zartlich, ganz langsam, brems langsam, mais avec du force, kraftlich. Compris?“ Er winkt Karl-Heinz, aufzusteigen: „Allez!“
Der stellt sich neben den Hunt auf den Aufzug, legt militärisch grüßend die Hand an die Pudelmütze: „Tauchtanks fluten!“, und singt: „Denn wir fahren, denn wir fahren, denn wir fahren gegen Engelland ...!“
Mauser führt Max die Hand auf dem Schalthebel, und Karl-Heinz klammert sich vorsichtshalber am Hunt fest. Mauser: „Allons! Doucement, zartlich ...“ Der Aufzug setzt sich in Bewegung und rollt abwärts. Das Licht der Grubenlampe wird schnell zur Funzel. Mauser deutet auf eine Markierung an der Seiltrommel: „Attention! Hier rot Strich, nur noch drei Mal Seil ...“, er zeigt, daß er drei Seilschlingen auf der Trommel meint, „das ist fünf Meter, und ... lentement, lentement! Und brems! Dann unten ...“
Das Seil erschlafft, und Karl-Heinz brüllt von unten: „Haalt! Ende.“
Mauser sagt befriedigt: „Gutt! Jetzt wart bis neue Waggon! Du sitz hier, dann ...“, er deutet das Aufziehen an, „monter, auf!“
Max befühlt die Hebel und betrachtet mißtrauisch die wenig vertrauenerweckende Anlage. Die Trommel wackelt und klappert, das freiliegende Zahnradgetriebe klirrt, die fin-gerdicken Drehstromkabel für den 50-kW-Motor sind weder ordentlich isoliert noch angeklemmt, sondern einfach um die Anschlußklemme herumgewickelt.
Mauser sieht Max’ skeptische Blicke und will beschwichtigen: „Motor gut. Seil gut. Du nix anfass, du nur hier!“ Und er deutet auf die Hebel. Er setzt sich neben Max auf ein paar Stempel Bauholz: „Ich wart ein Waggon. Besser für dir.“
Beide schweigen.
Dann will Max ein wenig Konversation machen: „Sie haben eine schöne Frau.“
Mauser nimmt das Kompliment gerne entgegen: „Mais oui! Mein Frau ist schön. Tu l’as vue a Noël. Bei Kirche. Sie sag, du sehr gentil. Versteh’ gentil? Gentil – nettlich. Du sehr nettlich.“
„Nett“, korrigiert Max.
„Gut, nett, nett für ma femme.“
„Wie heißt deine Frau?“ will Max wissen.
„Elle s’appelle Amélie.“
„Amélie. Schöner Name.“
Mauser ist erfreut: „Mais oui! Schön Frau, schön Name.“
Von unten hört man das Rollen eines Hunts, dann das Rumpeln, wenn er auf den Aufzug geschoben wird, dann Karl-Heinz’ Stimme: „Nummer elf, fertig. Zieh auf!“
Mauser zu Max: „Alors! Va t’en!“ Zögernd betätigt Max den Regler, der Motor brummt auf, das Seil strafft sich, wird aber noch nicht eingeholt. Mauser faßt zu: „Plus encore!“, und drückt den Hebel kräftiger herunter. Die Seiltrommel beginnt sich zu drehen, Mauser läßt den Hebel los, und Max führt den Aufzug nach oben und landet ihn sanft. Er atmet durch, entspannt sich und schaut Mauser erwartungsvoll lächelnd an.
Mauser lobt ihn: „Très bien! Gut, gut. Tout va bien. Du jetzt conducteur.“
Inzwischen kommt auch Schmelzer mit einem neuen leeren Hunt und sagt mit neidischem Unterton: „Fährst ja wie ’n Alter. Steht deiner Karriere nichts mehr im Wege.“ Er zerrt den vollen Hunt vom Aufzug und schiebt den leeren hinauf.
Max ahmt Mauser nach: „Du dicken Hintern besser bewegen!“
Aber Schmelzer versteht wenig Spaß und reagiert wütend: „Du besser das Maul halten, Arschkriecher! Sonst kriste was drauf.“
Angesichts der wenig beeindruckenden Erscheinung Schmelzers läßt sich Max nicht einschüchtern: „Du wirst doch nicht meinen Hund beißen?“
Mauser unterbricht das Geplänkel und bedeutet Max: „Abfahrt! Descendre.“ Und zu Schmelzer: „Du auch Abfahrt!“ Er deutet Richtung Stollen.
Schmelzer setzt seinen Hunt in Bewegung: „Ach, leck mich Fett!“
Max löst die Bremse und läßt den Aufzug in die Tiefe gleiten.
An einem trüben Januarmorgen steht um halb sechs ein Dutzend Gefangener vor dem Haus, bereit zum Abmarsch zur Mine. Es ist dunkel, feucht, windig und kalt. Sie treten von einem Fuß auf den anderen, haben die Ohrenklappen der Feldmützen, soweit sie eine haben, herunter- und den Kragen hochgeklappt, Schals umgewickelt oder das Kinn in den Rollkragenpullover gezogen. Umgehängte Taschen oder Brotbeutel enthalten das magere Frühstück.
„Wie spät hammer’s denn?“
Einer schaut auf die Uhr: „Viertel vor sechs.“
„Kommer zu spät!“
„Na und? Wartet denn einer auf uns?“
Bodo Schmude schaut aus der Küchentür. Er kaut noch an einem Stück Brot und hält eine Konservendose, aus der Tee dampft: „Isser immer noch nicht da? Steh dir nicht die Beine in’ Bauch, Max, komm wieder rein, hier drin isses warm!“
Skroszny bläst in die Hände und wendet sich dem Haus zu: „Denn wer ich mal anfangen, mich wieder auszuziehn. Wenn der Posten nicht kommt, ist die Schicht schon zu Ende.“
Robert ergreift sofort das Angebot, sich vor der Arbeit zu drücken: „Wenn sie uns nicht zur Arbeit holen, muß die Arbeit sehn, wie sie selber fertig wird.“
Max findet das stur. Wieso sollen sie zeigen, daß sie ohne Posten nicht auskommen? Die Arbeit wird ihnen nicht geschenkt. Er sagt, was er denkt: „Das ist doch doof! Wir ärgern uns andauernd, daß uns die Posten in die Hacken treten, und kommt der Posten nun mal nicht, fühlen wir uns verlassen! Warum gehen wir nicht allein zur Arbeit?“
Skroszny fühlt sich angegriffen und droht: „Wer ist hier doof? Willste dich einkratzen, Student? Du paß auf!“
Robert beeilt sich, beizupflichten: „Wer Arbeit kennt und danach rennt und sich nicht drückt, der ist verrückt!“
Frömmich aber begreift: „Du bist wirklich blöde, Hein. Der Junge hat doch recht. Wenn wir jetzt allein zur Mine gehen, ist das ’n Schritt zur Normalisierung, ’n Schritt in die Freiheit. Gehn wir nicht, können wir uns auch nicht übers Essen beschweren. Außerdem kommt in einer halben Stunde ein anderer Posten angeschissen oder der Steiger und treibt uns an die Arbeit. Also, was haben wir davon?“
Skroszny, pomadig: „’ne halbe Stunde Pause.“
Frömmich: „Und weiter ständig die Posten. Gehen wir aber selber, ist das ein Zeichen, daß man uns trauen kann. Daß wir halbwegs normale Menschen sind. Da merken sie, daß wir gar keinen Posten brauchen! Die rechnen doch auch!“ Er wendet sich an Schmude, der immer noch in der Tür steht: „Bodo, hol doch mal die anderen raus. Laß uns abstimmen, ob wir allein zur Mine gehen oder nicht.“
Robert: „Na ich lieber nicht.“
Und Skroszny: „Ihr stimmt ab, ob ich freiwillig maloche? Bin ich denn blöde?“
Frömmich grinst: „Das wird sich zeigen ...“ Er wendet sich ab: „Hört mal her!“
Er erläutert kurz die beiden Möglichkeiten und ihre Folgen. Die Debatte dauert nicht lange. Die Mehrzahl beschließt, auch ohne Posten zur Mine zu marschieren. Maulend schließen sich auch die Faulpelze an.
Am nächsten Tag ist der Posten wieder da, auch am übernächsten, aber er erscheint ohne Gewehr. Und als er am dritten Tag eine Viertelstunde zu spät kommt, sind die Gefangenen schon auf dem Weg zur Mine.
Am vierten Tag erscheint kein Posten mehr! Sie können sich jetzt im Dorf frei bewegen.
Max und Schmude räumen wieder das Geschossene der letzten Nacht. Die Arbeit ist eintönig und schwer, besonders weil man sich mit der Schaufel im engen Stollen nur schlecht bewegen kann. Die Schaufeln haben große, schwere Blätter, die schon leer die Arme ermüden. „Herzblättchen“, sagt Emil.
Bodo Schmude handhabt unlustig und kraftlos seine Schippe und stöhnt: „Mann, is det öde!“ Dann entdeckt er im Abraum eine gelbe, an fünfzehn Zentimeter lange, vielleicht drei Zentimeter dicke Stange Gummidynamit, die nicht gezündet hat. Er hält sie Max hin: „Wem wollen wir die in die Hose stecken?“
Max traut dem Ding nicht: „He, sei vorsichtig!“
Schmude untersucht, ob vielleicht noch eine Sprengkapsel drin ist, und da er nichts findet, haut er mit der Stange auf einen Erzbrocken. Max schrickt zurück, aber Schmude be-ruhigt ihn: „Da! Da kannste mit dem Hammer druffhauen, da passiert jarnischt. Wenn de keene Sprengkapsel hast, jeht det Ding nich los. Außerdem muß et verdämmt sein. Ringsrum einjeschlossen, vastehste?“
Max betrachtet die Dynamitstange skeptisch: „Und was soll’n wir damit machen?“
„Wir könnten se abbrennen. Paß mal auf!“
Während Max noch warnt: „Mensch, sei bloß vorsichtig!“, entzündet Schmude die Stange schon an seiner Grubenlam-pe. Sie beginnt, erst zögernd, dann heftiger, mit fauchender gelber Flamme zu brennen. Nun wird das Ding auch Schmude unheimlich. Er wirft es in einen halb verschütteten alten Querstollen hinter den Abraum. Wie Bengalisches Feuer leuchtet es orangegelb aus dem dunklen Stollen. Die Jungen amüsieren sich. Dann aber beginnt dicker gelbgrauer Qualm aus dem Feuer aufzusteigen, über den Abraum zu wallen und aus dem Stollen hervorzuquellen.
„Au Scheiße!“ flucht Schmude und versucht, die Qualmwolke durch Wedeln mit seiner Jacke zu zerstreuen. Eher könnte er Beton mit einem Staubwedel verteilen. Er beginnt hektisch, mehr Abraum in den Stollen zu schütten in der Hoffnung, er könne ihn schließen: „Mensch, mach doch mal mit!“ schnauzt er Max an, und der greift schnell seine Schaufel und unterstützt Schmudes Versuch.
Aber das ist völlig vergeblich. Sie brauchten mindestens zwei Tonnen Abraum, um den Stollen zu schließen, und dafür entwickelt der Qualm sich viel zu schnell und in viel zu großer Menge. Er beißt in die Augen und kratzt im Hals. Die beiden müssen husten und weichen vor dem Qualm zurück, der in Richtung Hauptstollen zieht. Der Qualm wälzt sich langsam, massig und unaufhaltsam vorwärts.
Max ergreift Hemd, Jacke, Schaufel und Grubenlampe: „Wir können hier nicht bleiben! Wir müssen raus!“
„Willste durch den Qualm da?“ Bodo Schmude will eher zurückweichen, Max drängt aber: „Willste warten, bis du hier geräuchert wirst? Los! Durch!“ Er preßt sein Taschentuch vor Mund und Nase und läuft in den Qualm hinein, dem Ausgang zu. Schmude folgt ihm.
Wenig später schon dringt schwerer Qualm aus dem Grubenausgang. Die anderen haben sich vor dem Qualm nach draußen in Sicherheit gebracht. Sie wissen nicht, was los ist.
Willi hält am Brecher inne: „Wat ist denn dat? Brennt die Grube?“
„Da ist doch nischt zum Brennen drin“, winkt Witting ab.
Emil weiß es besser: „Wenn dat Grubenholz erst emal brennt und sich der Luftzug durch dat Feuer verstärkt, dann sollste mal sehen, wat dat für ein Feuerwerk ist!“
Mauser kommt in Panik angewetzt: „Was los? Was brennt da? Wer hat gemacht Feuer in Mine? Das Sabotage! Muß ich Feuerwehr holen. Mine einstürzen. Fini! Alles Ende. Noch Mann in Mine?“
Alle sehen sich suchend um. Die Arbeiter einer Schicht sind nicht so zahlreich, daß man nicht schnell erkennen könnte, daß alle draußen sind. Max stellt erleichtert fest: „Alle da!“ Wo ist Jorge, der Zimmermann? „Ist schon gegangen!“
Mauser drängt auf Erklärung: „Also was? Wer weiß? Was passieren?“
Max und Schmude sehen sich an. Es hat kaum Zweck, zu hoffen, daß ihre Dämlichkeit unbemerkt bleibt. Lieber Farbe bekennen, damit sich die Aufregung legt.
Max setzt an zu beschwichtigen: „Na ja ... es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Es ist bloß ’ne Stange Dynamit, die brennt.“
Bodo Schmude unterstützt eifrig die Harmlosigkeit der Erklärung: „Ja! Bloß so ’n Stücke Dynamit.“ Er schaut Max an, wie es weitergehen soll.
Max wiegelt weiter ab: „Ja, bloß ’n bißchen Dynamit. Das liegt im alten Querstollen hinter dem Abraum. Da ist kein Holz, da kann gar nichts passieren!“
Mauser fährt auf ihn los und giftet, nicht ganz zu Unrecht: „So! Du gemacht scheiß Sabotage! Mit Dynamit! Du wieder in Lager Alès! Du in Prison, gefangen!“
Max ist feige, und er will nicht zurück ins Lager: „Ce n’était pas moi! C’était lui ...“, schwärzt er den Kumpel an. Und wenn es auch stimmt, was er sagt, fühlt er sich doch beschissen dabei.
Schmude hat nicht ganz verstanden, was Max gesagt hat, fühlt sich aber angesprochen: „Ick bin doch bloß aus Versehen mit de Lampe dranjekommen! Und denn ham wa det Zeuch in den alten Stollen jeschmissen, damit nischt passiert. Wer kann denn ahnen, det det Zeuch so qualmt!“
Obwohl Mauser noch wütend ist, dämpft die Erleichterung darüber seinen Ärger, daß der Qualm offenbar keine gefährliche Ursache hat und kein Kumpel gefährdet ist. Dennoch blafft er alle an: „Ihr hier arbeit! Ihr hier nicht spiel! Ihr überhaupt zu wenig arbeit!“
„Wir sind ja nicht freiwillig hier“, kontert Skroszny, den das Spektakel mehr amüsiert als aufregt.
„Und überhaupt: Bei dem Hungerfraß, den wir hier kriegen, kann man gar nicht arbeiten.“ Erheitert reiht sich Willi in die Front der Kritiker ein.
Auch Schmude sieht im Angriff die beste Verteidigung: „Arbeiten, arbeiten! Aber uns nicht wie Menschen behandeln. In der Rattenburg wohnen, Maden im Käse, nicht mal ein Pfund Brot und keine Schuhe!“ Er hebt ein Bein und zeigt einen offenen Schuh mit Holzsohle, an dem die Schnürsenkel herumflattern.
Bei Widerspruch aus dieser Richtung kommt Mauser wieder in Fahrt: „Du halt Maul! Du mach nur Scheiß! Mit dir redt Ingenieur! Und wenn du nicht kusch, du zurück in Lager!“
Aber Schmude läßt sich nicht so leicht einschüchtern: „Da mach ick mir vielleicht wat draus!“
Willi hebt jetzt den kleinen Ärger auf eine allgemeine Ebene: „Jut! Soll der Ingenieur zu uns kommen! Da werden wir mit ihm reden. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, aber: Wer kein Essen kriegt, soll auch nicht arbeiten! Et wird Zeit, daß wir ’n bißchen besser versorgt werden, dann können wir vielleicht auch besser arbeiten. Sach dat dem Ingenieur!“
Nicht alle sind mit dieser Konsequenz einverstanden, einige maulen: „Versprich mal nicht zu viel, Willi!“ – „Wir wolln ja hier gar nicht arbeiten.“ – „Soll’n sie uns doch nach Hause schicken.“
Max erinnert sich, wie sie als Pennäler während des Krieges allerlei Versuche mit Sprengstoff und Brandsätzen gemacht hatten. Eines Tages hatte er mit seinen Freunden Horst und Werner auf der nahen, mit kleinen Kiefern bestandenen Wiese eine Brandmischung mit rotem Phosphor zur Entzündung gebracht, worauf dicker, beißender Qualm die ganze Wiese einnebelte. Die Wiese brannte nicht, aber sie war so gut wie unsichtbar. Sie hatten sich aus dem Staube gemacht und aus sicherer Entfernung beobachtet, daß die Feuerwehr anrückte und auch nichts gegen den Nebel ausrichten konnte.
Abends gibt’s in der großen Stube eine erregte Debatte. Die Männer hocken auf Bänken und Betten, manche thronen auf dem oberen Bett über dem Lärm. Das Stimmengewirr zerquirlt den Qualm der Selbstgedrehten. Frieda hat als Versammlungsleiter Mühe, die Reden zu entwirren.
Die Meinungen sind widersprüchlich, die Argumente teils wichtig, teils kleinkariert. Man kann zustimmen, daß einer Schnittkäse haben will, ein anderer eine Zeitung. Wichtiger ist aber die Frage, ob man arbeiten will oder nicht. Im Grunde gibt es zwei entgegengesetzte Haltungen: Die einen wollen „dem Franzosen nicht dienen“, also lieber unter miesen Bedingungen auf der faulen Haut liegen, die anderen sind bereit – da sie nun einmal an der Gefangenschaft nichts grundsätzlich ändern können –, ordentlich zu arbeiten, wenn man ihnen erträgliche Bedingungen bietet, das heißt aus-reichende Verpflegung und ordentliche Kleidung.
Man hat also die Wahl: entweder bei kümmerlicher Ver-pflegung im Hauptlager hinter Stacheldraht auf dem Sack liegen, oder aber hier halbwegs vernünftig zu arbeiten, dafür ordentlich verpflegt zu werden und eine gewisse Bewe-gungsfreiheit zu haben. Die Landschaft ist schön, die Leute sind freundlich und haben ihren eigenen Reiz, wer will, kann sich – zumindest in seiner Freizeit – wie im Urlaub fühlen. Im Hauptlager wären sie wirklich Gefangene, hier haben sie einen Trumpf in der Hand: ihre Arbeit.
Trotz allerlei munterer Sprüche wählt keiner ernsthaft die erste Möglichkeit. Skroszny schlägt einen Akkordlohn vor, bei dem jeder nach seinen Leistungen bezahlt wird. Vielleicht sogar in ‚richtigem‘ Geld.
„Akkord ist Mord!“ kolportiert Tanne eine sozialdemokratische Losung.
Man einigt sich schließlich darauf, die Leistung so anzu-heben, das sie sich vom Bummeltempo der letzten Wochen abhebt, aber auch nicht zu übertreiben. Achtzehn bis zwan-zig Hunte am Tag, je nach Art des Steins, wären keine zu an-strengende Sache. Bisher haben sie zwölf bis fünfzehn täglich gefördert. Frieda, Tünnes und Willi Breitenbach werden als die Delegation gewählt, die am nächsten Tag mit dem Ingenieur reden soll.
Sie bleiben ziemlich lange weg, und die Erwartungen gehen weit auseinander.
Die Emissäre haben undurchdringliche Mienen, als sie zurückkommen, sie machen verbissene Gesichter. Aber ihr vor sich hergetragenes Selbstbewußtsein paßt nicht so recht dazu.
Alle wollen wissen, wie alles gelaufen ist: „Na los, erzählt mal!“ – „Hat er euch angehört?“ – „Wer war denn alles dabei?“
Aber sie lassen nur spärliche Bemerkungen fallen wie: „Der Alte ist schwierig“, oder „Der Ingenieur hat keinen Kohldampf“. Ihre Geheimnistuerei halten sie eine Minute lang durch, dann platzen sie stolz mit dem positiven Ergebnis heraus, sich gegenseitig ins Wort fallend: Bei achtzehn Waggons täglich gibt es ein Supplement von Brot, Käse, Hülsenfrüchten, Mehl und Zucker! Ab zwanzig Waggons dazu Zigaretten und Wein, und ab zweiundzwanzig auch eine Geldprämie!
Der Sieg wird lauthals bejubelt. Bodo umfaßt Max, schwenkt ihn in der Küche herum und rempelt dabei die anderen an. Skroszny bremst den Überschwang: „Macht mal halblang, ihr Tanzaffen! Tobt euch morgen am Berg aus.“ (PK)
Lesen Sie die Fortsetzung des biografischen Romans in der kommenden Ausgabe, oder - bequemer - bestellen Sie das Buch bei edition winterwork
Online-Flyer Nr. 304 vom 01.06.2011
Druckversion
Literatur
Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 11
Max - Jahrgang 27
Von Lutz Köhlert

Max nimmt sich täglich zehn Worte Französisch vor und beginnt mit den Zahlen.
„Un, deux, trois, quatre, cinq, six ...“, zählt er seine Schritte hinter dem Hunt. Das hilft über die Monotonie der Arbeit hinweg und wird für ihn nützlich. Andere Kumpel quälen sich nicht mit der fremden Sprache, aber für Max ist das Lernen Vergnügen.
Auf dem Schrägaufzug wartet ein leeren Wagen. Max zerrt ihn herab und schubst ihn auf das Ausweichgleis. Er wuchtet den vollen Wagen mit einer halben Tonne Erz auf die Bühne. Wenn man weiß, wie man anfassen und das Körpergewicht einsetzen muß, läßt sich der schwere Karren ankippen, drehen, regieren. Max klinkt die Sicherung ein und schreit nach oben: „Nummer zehn fertig!“
Von oben tönt Mausers Stimme: „Komm auf! Viens ici.“
Max schreit wieder nach oben: „Und der leere Waggon?“
Mauser bescheidet: „Laß stehen. Karl-Heinz kommt unten.“
Max quetscht sich neben den Hunt auf die Aufzugsbühne: „Fertig! Zieh auf.“
Das Seil strafft sich, der Aufzug ruckt heftig an, so daß Max sich festhalten muß, und rollt dann an der Stollenwand schrapend nach oben. Aus dem Lichtkreis der Glühbirne taucht er fünfzig Meter tief in die Dunkelheit, kaum aufgehellt vom Licht seiner Grubenlampe, bis er oben wieder im Lichtkreis der Glühbirne auftaucht. Der Aufzug schlägt hart an den Prellbalken, der Hunt wackelt bedenklich, Max beeilt sich abzuspringen. Mauser hat den Aufzug gefahren. Neben ihm warten Schmelzer mit einem leeren Hunt und Karl-Heinz Witting, der schmale blonde junge Mann mit den weichen Bewegungen und der sanften Stimme. Er war im Krieg Sanitäter bei einer U-Boot-Versorgungseinheit und will einmal Arzt werden.
Jetzt begrüßt er Max: „Hallo! Wie geht’s?“
„Es geht wie man geht“, sagt Max. „Was willst ’n hier?“
„Ich soll dich ablösen.“
Max wundert sich und sieht Mauser an: „Nanu?“
Der erklärt ihm: „Salamah sein krank, du an ascenseur. Du kann doch Auto fahren, ja?“
Max ist sich da nicht so sicher. Er hat es noch nie probiert. Aber er will eine Schwäche nicht so ohne weiteres zugeben: „Auto? Wieso? Na ja ...“
Schmelzer versucht, sich ranzuschmeißen: „Vielleicht kann ich ...?“
Aber Mauser mag ihn offenbar nicht: „Du dicken Hintern besser bewegen! Nimm Waggon, und Abmarsch!“ Er winkt ihm, den vollen Hunt vom Aufzug zu ziehen, und schiebt selber den leeren auf die Bühne. Zu Max: „Du sitz hier! Tout est popelleicht. Hier Schalter Motor: Ein! Langsam! Schnell! Da Schalter Auf! und Ab! Und das hier c’est le frein, comment s’appelle ...?“
Karl-Heinz hilft ihm: „Bremse.“
„Ja, der Bremse. Du aufpass, schön doucement, zartlich, ganz langsam, brems langsam, mais avec du force, kraftlich. Compris?“ Er winkt Karl-Heinz, aufzusteigen: „Allez!“
Der stellt sich neben den Hunt auf den Aufzug, legt militärisch grüßend die Hand an die Pudelmütze: „Tauchtanks fluten!“, und singt: „Denn wir fahren, denn wir fahren, denn wir fahren gegen Engelland ...!“
Mauser führt Max die Hand auf dem Schalthebel, und Karl-Heinz klammert sich vorsichtshalber am Hunt fest. Mauser: „Allons! Doucement, zartlich ...“ Der Aufzug setzt sich in Bewegung und rollt abwärts. Das Licht der Grubenlampe wird schnell zur Funzel. Mauser deutet auf eine Markierung an der Seiltrommel: „Attention! Hier rot Strich, nur noch drei Mal Seil ...“, er zeigt, daß er drei Seilschlingen auf der Trommel meint, „das ist fünf Meter, und ... lentement, lentement! Und brems! Dann unten ...“
Das Seil erschlafft, und Karl-Heinz brüllt von unten: „Haalt! Ende.“
Mauser sagt befriedigt: „Gutt! Jetzt wart bis neue Waggon! Du sitz hier, dann ...“, er deutet das Aufziehen an, „monter, auf!“
Max befühlt die Hebel und betrachtet mißtrauisch die wenig vertrauenerweckende Anlage. Die Trommel wackelt und klappert, das freiliegende Zahnradgetriebe klirrt, die fin-gerdicken Drehstromkabel für den 50-kW-Motor sind weder ordentlich isoliert noch angeklemmt, sondern einfach um die Anschlußklemme herumgewickelt.
Mauser sieht Max’ skeptische Blicke und will beschwichtigen: „Motor gut. Seil gut. Du nix anfass, du nur hier!“ Und er deutet auf die Hebel. Er setzt sich neben Max auf ein paar Stempel Bauholz: „Ich wart ein Waggon. Besser für dir.“
Beide schweigen.
Dann will Max ein wenig Konversation machen: „Sie haben eine schöne Frau.“
Mauser nimmt das Kompliment gerne entgegen: „Mais oui! Mein Frau ist schön. Tu l’as vue a Noël. Bei Kirche. Sie sag, du sehr gentil. Versteh’ gentil? Gentil – nettlich. Du sehr nettlich.“
„Nett“, korrigiert Max.
„Gut, nett, nett für ma femme.“
„Wie heißt deine Frau?“ will Max wissen.
„Elle s’appelle Amélie.“
„Amélie. Schöner Name.“
Mauser ist erfreut: „Mais oui! Schön Frau, schön Name.“
Von unten hört man das Rollen eines Hunts, dann das Rumpeln, wenn er auf den Aufzug geschoben wird, dann Karl-Heinz’ Stimme: „Nummer elf, fertig. Zieh auf!“
Mauser zu Max: „Alors! Va t’en!“ Zögernd betätigt Max den Regler, der Motor brummt auf, das Seil strafft sich, wird aber noch nicht eingeholt. Mauser faßt zu: „Plus encore!“, und drückt den Hebel kräftiger herunter. Die Seiltrommel beginnt sich zu drehen, Mauser läßt den Hebel los, und Max führt den Aufzug nach oben und landet ihn sanft. Er atmet durch, entspannt sich und schaut Mauser erwartungsvoll lächelnd an.
Mauser lobt ihn: „Très bien! Gut, gut. Tout va bien. Du jetzt conducteur.“
Inzwischen kommt auch Schmelzer mit einem neuen leeren Hunt und sagt mit neidischem Unterton: „Fährst ja wie ’n Alter. Steht deiner Karriere nichts mehr im Wege.“ Er zerrt den vollen Hunt vom Aufzug und schiebt den leeren hinauf.
Max ahmt Mauser nach: „Du dicken Hintern besser bewegen!“
Aber Schmelzer versteht wenig Spaß und reagiert wütend: „Du besser das Maul halten, Arschkriecher! Sonst kriste was drauf.“
Angesichts der wenig beeindruckenden Erscheinung Schmelzers läßt sich Max nicht einschüchtern: „Du wirst doch nicht meinen Hund beißen?“
Mauser unterbricht das Geplänkel und bedeutet Max: „Abfahrt! Descendre.“ Und zu Schmelzer: „Du auch Abfahrt!“ Er deutet Richtung Stollen.
Schmelzer setzt seinen Hunt in Bewegung: „Ach, leck mich Fett!“
Max löst die Bremse und läßt den Aufzug in die Tiefe gleiten.
An einem trüben Januarmorgen steht um halb sechs ein Dutzend Gefangener vor dem Haus, bereit zum Abmarsch zur Mine. Es ist dunkel, feucht, windig und kalt. Sie treten von einem Fuß auf den anderen, haben die Ohrenklappen der Feldmützen, soweit sie eine haben, herunter- und den Kragen hochgeklappt, Schals umgewickelt oder das Kinn in den Rollkragenpullover gezogen. Umgehängte Taschen oder Brotbeutel enthalten das magere Frühstück.
„Wie spät hammer’s denn?“
Einer schaut auf die Uhr: „Viertel vor sechs.“
„Kommer zu spät!“
„Na und? Wartet denn einer auf uns?“
Bodo Schmude schaut aus der Küchentür. Er kaut noch an einem Stück Brot und hält eine Konservendose, aus der Tee dampft: „Isser immer noch nicht da? Steh dir nicht die Beine in’ Bauch, Max, komm wieder rein, hier drin isses warm!“
Skroszny bläst in die Hände und wendet sich dem Haus zu: „Denn wer ich mal anfangen, mich wieder auszuziehn. Wenn der Posten nicht kommt, ist die Schicht schon zu Ende.“
Robert ergreift sofort das Angebot, sich vor der Arbeit zu drücken: „Wenn sie uns nicht zur Arbeit holen, muß die Arbeit sehn, wie sie selber fertig wird.“
Max findet das stur. Wieso sollen sie zeigen, daß sie ohne Posten nicht auskommen? Die Arbeit wird ihnen nicht geschenkt. Er sagt, was er denkt: „Das ist doch doof! Wir ärgern uns andauernd, daß uns die Posten in die Hacken treten, und kommt der Posten nun mal nicht, fühlen wir uns verlassen! Warum gehen wir nicht allein zur Arbeit?“
Skroszny fühlt sich angegriffen und droht: „Wer ist hier doof? Willste dich einkratzen, Student? Du paß auf!“
Robert beeilt sich, beizupflichten: „Wer Arbeit kennt und danach rennt und sich nicht drückt, der ist verrückt!“
Frömmich aber begreift: „Du bist wirklich blöde, Hein. Der Junge hat doch recht. Wenn wir jetzt allein zur Mine gehen, ist das ’n Schritt zur Normalisierung, ’n Schritt in die Freiheit. Gehn wir nicht, können wir uns auch nicht übers Essen beschweren. Außerdem kommt in einer halben Stunde ein anderer Posten angeschissen oder der Steiger und treibt uns an die Arbeit. Also, was haben wir davon?“
Skroszny, pomadig: „’ne halbe Stunde Pause.“
Frömmich: „Und weiter ständig die Posten. Gehen wir aber selber, ist das ein Zeichen, daß man uns trauen kann. Daß wir halbwegs normale Menschen sind. Da merken sie, daß wir gar keinen Posten brauchen! Die rechnen doch auch!“ Er wendet sich an Schmude, der immer noch in der Tür steht: „Bodo, hol doch mal die anderen raus. Laß uns abstimmen, ob wir allein zur Mine gehen oder nicht.“
Robert: „Na ich lieber nicht.“
Und Skroszny: „Ihr stimmt ab, ob ich freiwillig maloche? Bin ich denn blöde?“
Frömmich grinst: „Das wird sich zeigen ...“ Er wendet sich ab: „Hört mal her!“
Er erläutert kurz die beiden Möglichkeiten und ihre Folgen. Die Debatte dauert nicht lange. Die Mehrzahl beschließt, auch ohne Posten zur Mine zu marschieren. Maulend schließen sich auch die Faulpelze an.
Am nächsten Tag ist der Posten wieder da, auch am übernächsten, aber er erscheint ohne Gewehr. Und als er am dritten Tag eine Viertelstunde zu spät kommt, sind die Gefangenen schon auf dem Weg zur Mine.
Am vierten Tag erscheint kein Posten mehr! Sie können sich jetzt im Dorf frei bewegen.
*
Max und Schmude räumen wieder das Geschossene der letzten Nacht. Die Arbeit ist eintönig und schwer, besonders weil man sich mit der Schaufel im engen Stollen nur schlecht bewegen kann. Die Schaufeln haben große, schwere Blätter, die schon leer die Arme ermüden. „Herzblättchen“, sagt Emil.
Bodo Schmude handhabt unlustig und kraftlos seine Schippe und stöhnt: „Mann, is det öde!“ Dann entdeckt er im Abraum eine gelbe, an fünfzehn Zentimeter lange, vielleicht drei Zentimeter dicke Stange Gummidynamit, die nicht gezündet hat. Er hält sie Max hin: „Wem wollen wir die in die Hose stecken?“
Max traut dem Ding nicht: „He, sei vorsichtig!“
Schmude untersucht, ob vielleicht noch eine Sprengkapsel drin ist, und da er nichts findet, haut er mit der Stange auf einen Erzbrocken. Max schrickt zurück, aber Schmude be-ruhigt ihn: „Da! Da kannste mit dem Hammer druffhauen, da passiert jarnischt. Wenn de keene Sprengkapsel hast, jeht det Ding nich los. Außerdem muß et verdämmt sein. Ringsrum einjeschlossen, vastehste?“
Max betrachtet die Dynamitstange skeptisch: „Und was soll’n wir damit machen?“
„Wir könnten se abbrennen. Paß mal auf!“
Während Max noch warnt: „Mensch, sei bloß vorsichtig!“, entzündet Schmude die Stange schon an seiner Grubenlam-pe. Sie beginnt, erst zögernd, dann heftiger, mit fauchender gelber Flamme zu brennen. Nun wird das Ding auch Schmude unheimlich. Er wirft es in einen halb verschütteten alten Querstollen hinter den Abraum. Wie Bengalisches Feuer leuchtet es orangegelb aus dem dunklen Stollen. Die Jungen amüsieren sich. Dann aber beginnt dicker gelbgrauer Qualm aus dem Feuer aufzusteigen, über den Abraum zu wallen und aus dem Stollen hervorzuquellen.
„Au Scheiße!“ flucht Schmude und versucht, die Qualmwolke durch Wedeln mit seiner Jacke zu zerstreuen. Eher könnte er Beton mit einem Staubwedel verteilen. Er beginnt hektisch, mehr Abraum in den Stollen zu schütten in der Hoffnung, er könne ihn schließen: „Mensch, mach doch mal mit!“ schnauzt er Max an, und der greift schnell seine Schaufel und unterstützt Schmudes Versuch.
Aber das ist völlig vergeblich. Sie brauchten mindestens zwei Tonnen Abraum, um den Stollen zu schließen, und dafür entwickelt der Qualm sich viel zu schnell und in viel zu großer Menge. Er beißt in die Augen und kratzt im Hals. Die beiden müssen husten und weichen vor dem Qualm zurück, der in Richtung Hauptstollen zieht. Der Qualm wälzt sich langsam, massig und unaufhaltsam vorwärts.
Max ergreift Hemd, Jacke, Schaufel und Grubenlampe: „Wir können hier nicht bleiben! Wir müssen raus!“
„Willste durch den Qualm da?“ Bodo Schmude will eher zurückweichen, Max drängt aber: „Willste warten, bis du hier geräuchert wirst? Los! Durch!“ Er preßt sein Taschentuch vor Mund und Nase und läuft in den Qualm hinein, dem Ausgang zu. Schmude folgt ihm.
Wenig später schon dringt schwerer Qualm aus dem Grubenausgang. Die anderen haben sich vor dem Qualm nach draußen in Sicherheit gebracht. Sie wissen nicht, was los ist.
Willi hält am Brecher inne: „Wat ist denn dat? Brennt die Grube?“
„Da ist doch nischt zum Brennen drin“, winkt Witting ab.
Emil weiß es besser: „Wenn dat Grubenholz erst emal brennt und sich der Luftzug durch dat Feuer verstärkt, dann sollste mal sehen, wat dat für ein Feuerwerk ist!“
Mauser kommt in Panik angewetzt: „Was los? Was brennt da? Wer hat gemacht Feuer in Mine? Das Sabotage! Muß ich Feuerwehr holen. Mine einstürzen. Fini! Alles Ende. Noch Mann in Mine?“
Alle sehen sich suchend um. Die Arbeiter einer Schicht sind nicht so zahlreich, daß man nicht schnell erkennen könnte, daß alle draußen sind. Max stellt erleichtert fest: „Alle da!“ Wo ist Jorge, der Zimmermann? „Ist schon gegangen!“
Mauser drängt auf Erklärung: „Also was? Wer weiß? Was passieren?“
Max und Schmude sehen sich an. Es hat kaum Zweck, zu hoffen, daß ihre Dämlichkeit unbemerkt bleibt. Lieber Farbe bekennen, damit sich die Aufregung legt.
Max setzt an zu beschwichtigen: „Na ja ... es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Es ist bloß ’ne Stange Dynamit, die brennt.“
Bodo Schmude unterstützt eifrig die Harmlosigkeit der Erklärung: „Ja! Bloß so ’n Stücke Dynamit.“ Er schaut Max an, wie es weitergehen soll.
Max wiegelt weiter ab: „Ja, bloß ’n bißchen Dynamit. Das liegt im alten Querstollen hinter dem Abraum. Da ist kein Holz, da kann gar nichts passieren!“
Mauser fährt auf ihn los und giftet, nicht ganz zu Unrecht: „So! Du gemacht scheiß Sabotage! Mit Dynamit! Du wieder in Lager Alès! Du in Prison, gefangen!“
Max ist feige, und er will nicht zurück ins Lager: „Ce n’était pas moi! C’était lui ...“, schwärzt er den Kumpel an. Und wenn es auch stimmt, was er sagt, fühlt er sich doch beschissen dabei.
Schmude hat nicht ganz verstanden, was Max gesagt hat, fühlt sich aber angesprochen: „Ick bin doch bloß aus Versehen mit de Lampe dranjekommen! Und denn ham wa det Zeuch in den alten Stollen jeschmissen, damit nischt passiert. Wer kann denn ahnen, det det Zeuch so qualmt!“
Obwohl Mauser noch wütend ist, dämpft die Erleichterung darüber seinen Ärger, daß der Qualm offenbar keine gefährliche Ursache hat und kein Kumpel gefährdet ist. Dennoch blafft er alle an: „Ihr hier arbeit! Ihr hier nicht spiel! Ihr überhaupt zu wenig arbeit!“
„Wir sind ja nicht freiwillig hier“, kontert Skroszny, den das Spektakel mehr amüsiert als aufregt.
„Und überhaupt: Bei dem Hungerfraß, den wir hier kriegen, kann man gar nicht arbeiten.“ Erheitert reiht sich Willi in die Front der Kritiker ein.
Auch Schmude sieht im Angriff die beste Verteidigung: „Arbeiten, arbeiten! Aber uns nicht wie Menschen behandeln. In der Rattenburg wohnen, Maden im Käse, nicht mal ein Pfund Brot und keine Schuhe!“ Er hebt ein Bein und zeigt einen offenen Schuh mit Holzsohle, an dem die Schnürsenkel herumflattern.
Bei Widerspruch aus dieser Richtung kommt Mauser wieder in Fahrt: „Du halt Maul! Du mach nur Scheiß! Mit dir redt Ingenieur! Und wenn du nicht kusch, du zurück in Lager!“
Aber Schmude läßt sich nicht so leicht einschüchtern: „Da mach ick mir vielleicht wat draus!“
Willi hebt jetzt den kleinen Ärger auf eine allgemeine Ebene: „Jut! Soll der Ingenieur zu uns kommen! Da werden wir mit ihm reden. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, aber: Wer kein Essen kriegt, soll auch nicht arbeiten! Et wird Zeit, daß wir ’n bißchen besser versorgt werden, dann können wir vielleicht auch besser arbeiten. Sach dat dem Ingenieur!“
Nicht alle sind mit dieser Konsequenz einverstanden, einige maulen: „Versprich mal nicht zu viel, Willi!“ – „Wir wolln ja hier gar nicht arbeiten.“ – „Soll’n sie uns doch nach Hause schicken.“
*
Max erinnert sich, wie sie als Pennäler während des Krieges allerlei Versuche mit Sprengstoff und Brandsätzen gemacht hatten. Eines Tages hatte er mit seinen Freunden Horst und Werner auf der nahen, mit kleinen Kiefern bestandenen Wiese eine Brandmischung mit rotem Phosphor zur Entzündung gebracht, worauf dicker, beißender Qualm die ganze Wiese einnebelte. Die Wiese brannte nicht, aber sie war so gut wie unsichtbar. Sie hatten sich aus dem Staube gemacht und aus sicherer Entfernung beobachtet, daß die Feuerwehr anrückte und auch nichts gegen den Nebel ausrichten konnte.
*
Abends gibt’s in der großen Stube eine erregte Debatte. Die Männer hocken auf Bänken und Betten, manche thronen auf dem oberen Bett über dem Lärm. Das Stimmengewirr zerquirlt den Qualm der Selbstgedrehten. Frieda hat als Versammlungsleiter Mühe, die Reden zu entwirren.
Die Meinungen sind widersprüchlich, die Argumente teils wichtig, teils kleinkariert. Man kann zustimmen, daß einer Schnittkäse haben will, ein anderer eine Zeitung. Wichtiger ist aber die Frage, ob man arbeiten will oder nicht. Im Grunde gibt es zwei entgegengesetzte Haltungen: Die einen wollen „dem Franzosen nicht dienen“, also lieber unter miesen Bedingungen auf der faulen Haut liegen, die anderen sind bereit – da sie nun einmal an der Gefangenschaft nichts grundsätzlich ändern können –, ordentlich zu arbeiten, wenn man ihnen erträgliche Bedingungen bietet, das heißt aus-reichende Verpflegung und ordentliche Kleidung.
Man hat also die Wahl: entweder bei kümmerlicher Ver-pflegung im Hauptlager hinter Stacheldraht auf dem Sack liegen, oder aber hier halbwegs vernünftig zu arbeiten, dafür ordentlich verpflegt zu werden und eine gewisse Bewe-gungsfreiheit zu haben. Die Landschaft ist schön, die Leute sind freundlich und haben ihren eigenen Reiz, wer will, kann sich – zumindest in seiner Freizeit – wie im Urlaub fühlen. Im Hauptlager wären sie wirklich Gefangene, hier haben sie einen Trumpf in der Hand: ihre Arbeit.
Trotz allerlei munterer Sprüche wählt keiner ernsthaft die erste Möglichkeit. Skroszny schlägt einen Akkordlohn vor, bei dem jeder nach seinen Leistungen bezahlt wird. Vielleicht sogar in ‚richtigem‘ Geld.
„Akkord ist Mord!“ kolportiert Tanne eine sozialdemokratische Losung.
Man einigt sich schließlich darauf, die Leistung so anzu-heben, das sie sich vom Bummeltempo der letzten Wochen abhebt, aber auch nicht zu übertreiben. Achtzehn bis zwan-zig Hunte am Tag, je nach Art des Steins, wären keine zu an-strengende Sache. Bisher haben sie zwölf bis fünfzehn täglich gefördert. Frieda, Tünnes und Willi Breitenbach werden als die Delegation gewählt, die am nächsten Tag mit dem Ingenieur reden soll.
Sie bleiben ziemlich lange weg, und die Erwartungen gehen weit auseinander.
Die Emissäre haben undurchdringliche Mienen, als sie zurückkommen, sie machen verbissene Gesichter. Aber ihr vor sich hergetragenes Selbstbewußtsein paßt nicht so recht dazu.
Alle wollen wissen, wie alles gelaufen ist: „Na los, erzählt mal!“ – „Hat er euch angehört?“ – „Wer war denn alles dabei?“
Aber sie lassen nur spärliche Bemerkungen fallen wie: „Der Alte ist schwierig“, oder „Der Ingenieur hat keinen Kohldampf“. Ihre Geheimnistuerei halten sie eine Minute lang durch, dann platzen sie stolz mit dem positiven Ergebnis heraus, sich gegenseitig ins Wort fallend: Bei achtzehn Waggons täglich gibt es ein Supplement von Brot, Käse, Hülsenfrüchten, Mehl und Zucker! Ab zwanzig Waggons dazu Zigaretten und Wein, und ab zweiundzwanzig auch eine Geldprämie!
Der Sieg wird lauthals bejubelt. Bodo umfaßt Max, schwenkt ihn in der Küche herum und rempelt dabei die anderen an. Skroszny bremst den Überschwang: „Macht mal halblang, ihr Tanzaffen! Tobt euch morgen am Berg aus.“ (PK)
Lesen Sie die Fortsetzung des biografischen Romans in der kommenden Ausgabe, oder - bequemer - bestellen Sie das Buch bei edition winterwork
Online-Flyer Nr. 304 vom 01.06.2011
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE
















 Max, Jahrgang 1927, 16jähriger Luftwaffenhelfer, später Kadett der Kriegsmarine auf dem Zerstörer „Hans Lody“, schildert seine Erlebnisse während des Krieges und in französischer Kriegsgefangenschaft. Seine Erinnerungen kreisen um die Arbeit im Bergwerk, um die erste Liebe zu der Französin Marie-Paule, die vergeblichen Fluchten und die endliche Heimkehr in das besetzte Deutschland. Reflexionen über die Sinnlosigkeit und Grausamkeit des Krieges haben angesichts weltweiter kriegerischer Aktivitäten nichts von ihrer Aktualität verloren.
Max, Jahrgang 1927, 16jähriger Luftwaffenhelfer, später Kadett der Kriegsmarine auf dem Zerstörer „Hans Lody“, schildert seine Erlebnisse während des Krieges und in französischer Kriegsgefangenschaft. Seine Erinnerungen kreisen um die Arbeit im Bergwerk, um die erste Liebe zu der Französin Marie-Paule, die vergeblichen Fluchten und die endliche Heimkehr in das besetzte Deutschland. Reflexionen über die Sinnlosigkeit und Grausamkeit des Krieges haben angesichts weltweiter kriegerischer Aktivitäten nichts von ihrer Aktualität verloren.