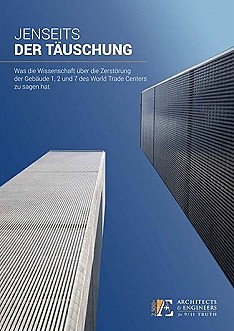SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Literatur
Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 6
Max - Jahrgang 27
Von Lutz Köhlert
Sie biegen von der Dorfstraße ab und steigen hinunter ins Tal. Der Nieselregen hat aufgehört, ein Lüftchen schiebt die Wolken vor sich her. Flußaufwärts muß es stärker geregnet haben, denn der Gardon springt mit ärgerlichen Schaumspritzern über das Geröll. Der Nebel verweht, die Berge stehen wie eine Kulisse gegen das Bühnenlicht des jungen Tages.
Eine klapprige Fußgängerbrücke führt über das Flußbett, und drüben steigt der schottrige Weg wieder an und windet sich um den Hang in die Höhe. Neben dem Weg wuchert wildes Buschwerk, unterbrochen von gelbgrünen Matten, später dann beherrschen die grün-bronzenen Blattkronen der Kastanienwälder die Hänge.
Nach einer knappen halben Stunde weht vor ihnen über den Bäumen Rauch auf, und als sie die nächste Kehre genommen haben, sehen sie die Grube vor sich. Eine Plattform aus rötlich-grauem Stein und Geröll, der Rumpf eines abgetragenen Bergrückens, führt in sanfter Neigung zu einem dunklen Schlund und in den Bauch des Berges. Zwei dünne silberne Fäden, die Gleise einer Schmalspurbahn, verlieren sich darin. Wie ein rostiger Eisenwurm hocken Kipploren auf den Schienen und warten auf Einlaß. Seitlich fällt eine Abraumhalde steil in das Tal ab.
Eine kleine Baracke bewacht den Grubeneingang. Hier werden mit Strichen auf einer Kreidetafel die Hunte gezählt, die entweder den Abraum ins Tal kippen, oder das Antimonerz dem Brecher zuführen, der schon seinen Rachen aufreißt, noch aber seine gierigen Backen stillhält.
Vom Brecher aus führt ein Förderband zu einer Schütte über dem Röstofen. Der besteht aus einer langen, schwarzrostigen, schrägliegenden, sich ständig drehenden Eisenröhre, in die oben das Erz geschüttet wird und deren unteres Ende in einen mit Koks gefütterten Ofen mündet. Seine Flammen lodern über das Erz hinweg und lassen das Antimon aus dem Erz sublimieren. Der Ofen dreht sich langsam und pausenlos, speit ständig rotgelben Qualm aus, verdaut das Mineral und scheidet es in staubförmiges Antimonoxyd, wertlose Schlacke und giftige Abgase. Das Antimonoxyd, ein graues bis rötliches Pulver, wird unter anderem für Lagermetalle in Hochleistungsmotoren und für Drucktypen gebraucht.
Die Gefangenen, die den Ofen in Gang halten, sind unterernährt und vom Schwefel und Arsen der Abgase vergiftet. Aber sie funktionieren wie der Ofen rund um die Uhr, weil sie keine andere Wahl haben.
Das Antimon wird nach drei Güteklassen in Papiersäcke gefüllt, das rötliche Pulver ist das Wertvollste. Die rauchende Schlacke kommt auf die Halde, den Hang hinab. Sie enthält noch unverbrannte, krümelige Koksreste, die sich die Gefangenen auflesen dürfen, um ihre Bruchbude zu heizen.
Am Ofen wirtschaftet schlaff eine müde Gestalt mit grauem Gesicht und geröteten Augen, der ‚Anarchist‘ Tanne, ein anderer hockt daneben, den Brotbeutel umgehängt, und erwartet die Ablösung. Es ist Reinhard Balke, ehemals Spieß in einer Versorgungseinheit, davor Bankkassierer, ein mittelgroßer, leicht verfetteter Mann mit hängenden Lidern, phlegmatischem Temperament und schleppender Sprechweise. Er wirkt pomadig und maulig, ist mißtrauisch aus Erfahrung, im Grunde aber eher gemütlich.
„Guten Morgen allerseits!“ begrüßt Gottlieb trällernd und betont munter die Ofenbesatzung. Reinhard Balke betrachtet ihn wie einen armen Irren.
Tanne meckert: „Wird auch Zeit, daß ihr kommt!“
Robert frotzelt: „Gut geschlafen?“, und: „Habt ihr wieder die Schütte leergefahren?“
„Mann, fang nicht schon wieder so an!“
„Bringt mal am Nachmittag noch was Koks mit, es wird langsam kalt nachts. Aber nicht so ’ne Krümel!“ Gemeint sind damit ein paar größere Brocken Grubenkoks, die zwar nicht erlaubt sind, aber besser brennen.
Als die Kolonne zum Stehen kommt, eilt aus der Baracke ein Mann herbei. Er ist mittleren Alters, mittelgroß, dürr und hat ein verkniffenes Gesicht und verhuschte Bewegungen. „Salut, Matthieu!“ grüßt er den Posten.
„Salut, Stani. Voilà l’équipe!“ grüßt der zurück. „C’est une troupe bien melée, n’est-ce-pas?“
„On va voir ...“, antwortet der andere unbestimmt. „Alors ...“, er wendet sich in gebrochenem Deutsch an die Gefangenen: „Also, ich bin Mauser, euer Steiger. Ihr sollt auf mir horchen! Wenn ihr hier gutt arbeiten, dann ihr gutt leben!“
Tanne mault: „Ach, du lieber Himmel! Das nennt der ‚gutt leben‘ ...“
Während der Posten den dreien vom Ofen winkt und sich mit ihnen zum Gehen wendet, teilt Mauser die anderen zur Arbeit ein. Max und Schmude werden Räumer und Lorenschieber. Schmude erklärt es Max: „Das ist nicht so schlecht. Da kannste deinen eigenen Trott gehen. Die Strecken sind miserabel, aber wenn die Lore entgleist, haste Pause und wartest, bis dir einer helfen kommt. Du mußt nur deine Lampe auspusten, am besten auch den Brenner wegschmeißen, weil du sie dann nicht mehr anzünden kannst. Das kannste natürlich nicht allzuoft machen, sonst reden sie von Sabotage und schicken dich ins Lager zurück.“
Elektrisches Licht gibt es nur bis zum Aufzug, für die Stollen bekommen sie Karbidlampen. Die bestehen aus zwei übereinander angeordneten Blechtöpfen und einem oben eingeschraubten Brenner. In den unteren Topf wird Karbid gefüllt, in den oberen Wasser. Läßt man Wasser auf das Karbid tropfen, entsteht Azethylengas und am Brenner eine leuchtende Flamme. Die Flamme darf nicht ausgehen, denn es gibt keine Streichhölzer, um sie wieder anzuzünden. Und vor allem darf man nicht zur falschen Zeit den Brenner verlieren, sonst steht man im Dunkeln.
Die Lampen werden angezündet, sie gehen in den Berg.
Der Stollen ist mit Kastanienhölzern verbaut und so schmal, daß gerade die kleinen Hunte hindurchpassen und neben den Gleisen noch Platz für einen Graben ist, der das Sickerwasser aus der Grube hinausführt. Ständig tropft und zieht es. Belüftet wird die Grube nur durch den natürlichen Luftzug zwischen den höher gelegenen neuen und einem tiefer gelegenen alten Stollen. Der führt auf der anderen Seite aus dem Berg hinaus. Der Berg ist durchbohrt. Der Weg durch den alten Stollen zum Lager ist viel kürzer, aber wegen der Einsturzgefahr gesperrt.
Einige hundert Meter weit stapfen sie horizontal in den Berg, bemüht, nicht über die Schwellen zu stolpern und sich nicht an den niedrigen Scheitelhölzern den Schädel einzuschlagen. Max spürt eine leichte Platzangst, behält sie aber unter Kontrolle. Schließlich kommen sie an einen Schrägaufzug, mit dem es weiter in die Tiefe geht. Der Aufzug ist eine einfache hölzerne Plattform auf Schienen, ohne Geländer, und führt mit etwa fünfundvierzig Grad Neigung in eine finstere Tiefe, aus der die funzligen Glühbirnen wie verlöschende Sterne scheinen. Er dient zum Transport der Hunte und der Bergleute. Sie stellen sich nebeneinander auf die Plattform und halten sich aneinander fest, um nicht durch das Rütteln des Schlittens das Gleichgewicht zu verlieren und sich am rauhen Felsen der Schachtwände Kleidung und Haut aufzureißen.
Nach weiteren zweihundert Metern Weg auf der unteren Sohle sind Max und Bodo an ihrem Arbeitsplatz. Das ist ein Vortrieb, in dem das Hängende heruntergebrochen ist und zu zwei Dritteln die drei bis vier Meter hohe Höhle ausfüllt. Die Wände bestehen aus blättrigem, unzuverlässigem Schichtgestein. Hier ist noch nichts verbaut, die Strecke muß erst geräumt werden, bevor die Zimmerleute arbeiten können. Max hebt einen der glatten, glänzenden Brocken auf und betrachtet ihn von allen Seiten. Als er ihn fester packt, zerbröselt er ihm unter den Händen.
Bodo erklärt ihm: „Glimmerschiefer. Sieht aus wie Marmor und ist bloß Mist.“
Obwohl er nicht an Klaustrophobie leidet, glaubt Max sekundenlang das ohrenbetäubende Kreischen zu hören, das die zehntausend Umdrehungen der Kreiselpumpen im Maschinenraum des Zerstörers ‚Hans Lody‘ verursacht haben.
Bodo beobachtet Max und versucht ihn abzulenken: „Kipp mir bloß nicht um. Hier musst du ’n Jemüt wie ’n Maulwurf haben.“
Max reißt sich zusammen: „Quatsch. Aber wenn ich den Haufen sehe, den wir wegschippen sollen, wird mir mulmig.“
Max leidet nicht an Platzangst, aber er hat doch lieber Raum um sich her. Als Kind hatte er wiederholt einen ihm unerklärlich angenehmen Traum: Er hatte ein Spielzeughaus, vielleicht tischhoch, in dem er durch enge Flure, Treppen und Räume kriechen mußte, so eng, daß er sich gerade hindurchwinden konnte. Aber das verursachte ihm keine Angst.
Wirklich beeindruckend waren Erlebnisse in seiner Zeit als Maschinengast auf dem Zerstörer.
Das Schiff hatte in drei Kesselräumen sechs Dampfkessel. Sie konnten in einer Stunde dreihundertzwanzig Kubikmeter Wasser in sechshundert Grad heißen Dampf verwandeln. Die Kesselräume waren so vollgestopft mit Rohrleitungen, Ventilen, Manometern und Pumpen, daß Max beim ersten Betreten dieses Labyrinths den Ausgang nicht wiederfand, als er sich einmal umgedreht hatte.
Als das Schiff aus der Werft kam, mußte er einmal auf den noch heißen (wenn auch isolierten) Kessel klettern, über dem vielleicht sechzig Zentimeter Platz war, und allen Reparaturschrott herabwerfen, der dort liegengeblieben war.
Ein anderes Mal mußte er in das vier Meter große Lüfterrad kriechen, um den fingerdicken Staub herauszufegen, und er wurde den Gedanken nicht los, daß der Lüfter durch irgendeinen blödsinnigen Umstand in Gang gesetzt werden könnte, während er in dieser blechernen Schleuder steckte.
Der schlimmste Alptraum war, als er während der Fahrt in den Doppelboden unter der Bilge kriechen mußte, eine nur etwa fünfzig Zentimeter hohe Kammer unmittelbar über dem Schiffsboden, um den dort abgelagerten schmierigen Salzschlamm herauszukratzen. Nur sechs Millimeter Stahl waren zwischen ihm und der Meerestiefe, und das Schiff, auf Geleitfahrt von Flugzeugen angegriffen, krängte bald nach Backbord, bald nach Steuerbord, und kein Mensch wußte, was im nächsten Moment passieren würde.
Bodo Schmude erklärt Max, was Erz und was Abraum ist, welchem Stein er vertrauen kann und vor welchem er sich in Acht nehmen muß. Das trügerische Schichtgestein blättert wie Glimmer in glitzernden Schichten auseinander, die Antimonblende findet sich in hartem Quarz, der blaukristallen und silbern funkelt.
„Ick muß mal“, sagt Bodo und verdrückt sich in einen stillgelegten Quertrieb.
Max bemüht sich derweil im Schein der Karbidlampe in dem engen Raum zwischen Bruchstein und Stollenwand, das Erz vom Abraum zu trennen. Er haut mit dem Ellbogen an die rauhe Wand. „Verfluchter Mist!“ Wie lange wird er in diesem Loch arbeiten müssen?
Bodo erscheint wieder, sich die Hose zuschnürend, und mißbilligt Max’ Eifer: „Kratz doch das bißchen Dreck nicht noch auseinander! Was haste davon? Alles rin in den Karren und weg damit.“
Er hilft, den Hunt vollzuladen, und stützt sich dann auf die Schaufel, wie ein Arbeiterdenkmal: „Schieb ab! Und paß in der Kurve auf, daß er dir nicht aus den Schienen springt.“
Max hängt seine Lampe an die Vorderwand des Hunts, wirft sich mit seinem Körpergewicht gegen die vollgeladene Lore und bringt sie langsam in Bewegung. Aus dem ersten Quertrieb stinkt es. Max verzieht angeekelt das Gesicht.
An der Ausweichstelle warten Sigi Welle mit einem leeren Hunt und Mauser. Der blafft Max an: „Was machen ihr? Finger im Arsch drehen? Sigi stehen und trampeln ...“
Sigi wiegelt ab: „Och, ich hab’ Zeit ...“
Mauser redet sich in Wut: „Kein Erz bei Brecher, Stollen nicht frei, Hunt warum nicht voll?“
Max verteidigt sich: „Der ist doch voll! Wenn noch mehr drin ist, schiebt er sich zu schwer durch die Kurven.“
„Was schwer? Du dummfaul!“
Er blickt in den Hunt und kramt einen Brocken Erz heraus: „Und was Erz in Abraum? Oben kein Erz, wo sein soll, und hier Erz, wo kein sein soll! Ihr dummfaul! Besser aufpassen. Arbeiten, nicht sein faul. Marsch, marsch!“ Er winkt Max, den leeren Hunt zu nehmen, und stapft ihm voraus zum Vortrieb.
Sigi schneidet ihm eine Grimasse und tippt sich mit dem kleinen Finger an die Schläfe: „Selber dummfaul.“ Er schiebt den vollen Hunt zum Aufzug, und Max beeilt sich, Mauser mit der leeren Lore zu folgen. Um Bodo vor Mausers Kommen zu warnen, beginnt er laut zu singen: „Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist des ...“
Mauser wendet sich wütend um: „Was du tönen? Halt Schnauze und schieb!“ Als Mauser am Quertrieb vorbeikommt, verzieht er ebenfalls angewidert das Gesicht und stoppt, so daß Max ihm beinahe in die Hacken fährt. Er leuchtet in den Quertrieb hinein: „Scheiße! Hingescheißt! Ihr Mistkerle.“
Max ist zwar auch angeekelt, aber er verteidigt Bodo: „Wohin soll’n wir denn gehen? Hier ist doch keine Latrine.“
Mauser: „Könnt wenigstens zuschippen, nicht? Aber zu faul!“
Er geht weiter und Max singt wieder: „Vom Wasser haben wir’s gelernt, vom Wasser haben wir’s gelernt, vom Wa-has-ser!“
Mauser stößt einen ellenlangen spanischen Fluch aus, in dem „Puta Madre de Dios!“ mehrmals vorkommt, läßt Max aber singen.
Als sie Bodo erreichen, stochert der kraftlos im Gestein.
Mauser beginnt sofort wieder zu schimpfen: „Viel Stein, wenig Waggon! Was ihr machen?“
Bodo mault: „Hier kann man sich nicht bewegen.“
„Wenig bewegen für wenig Platz, dann mehr Platz, dann mehr bewegen!“ erklärt Mauser. Er ergreift Schmudes Schaufel und führt geschickt vor, wie man in dem engen Raum schippen kann. Schmude lehnt sich grinsend an die Wand und schaut zu.
Mauser sieht das und schmeißt wütend die Schippe hin: „Na los, du! Bewegen! Und nicht in Stollen scheißen.“
Schmude spielt den Entrüsteten: „Wir? Wo denn? Das war wer anders! Das muß schon gewesen sein.“
„War nicht gewesen. Ist ganz neu. Sie dämpft ja noch!“ Zu Max: „Los, geh zuschippen.“
„Ich??“
„Ja du! Wer scheißt, schippt. Und jetzt arbeiten. Nicht arbeiten, dann nicht essen.“
Schmude verteidigt seinen Gefangenenstatus: „Für das bißchen Fressen arbeiten wir jenuch.“
„Franzosen haben auch nicht mehr essen! Ihr fleißig in Krieg, jetzt faul in Frieden.“
„Wo warste denn im Krieg? Warste da nicht auch fleißig?“
Mauser richtet sich auf und sagt fast würdevoll: „Ich war Spanien bis Krieg! Dann Résistance, dann Frankreich KZ!“
Max will Schmude gegenüber mit Kenntnissen glänzen und fordert Mauser heraus. Er artikuliert deutlich: „Dann zeigen Sie mal Ihre KZ-Nummer!“
Mauser preßt die Lippen zusammen und zögert ein paar Sekunden, dann streift er den Hemdsärmel hoch und weist seinen Unterarm vor. Dort ist eine blaue Nummer eintätowiert.
In Max kommt eine heiße Welle von Scham hoch. „Entschuldigen Sie ...“, sagt er betreten.
Mauser wendet sich ohne weitere Worte und stapft davon.
Schmude ist unbeeindruckt: „Blöde Sau! Will ick hier arbeiten? Nee!“
Max will mehr über Mauser wissen: „Was isser eigentlich für ein Mensch?“
„Sein Vater is woll Pole, aber ’n halber Deutscher, und die Mutter tschechisch oder balkanesisch oder so wat. Gloob ick jedenfalls. Und seine Frau ist aus Spanien.“
Aber auch Bodo Schmude ist nicht so wurstig, wie er tut: „Is immer hin- und herjeschubst worden. Eijentlich ’n armet Schwein. Hier arbeiten übrijens noch mehr Spanier, als Zimmerleute in der Nachtschicht.“
Max kehrt zur niederen Gegenwart zurück: „Aber deine Kacke kannste wirklich zuschippen! Stinkt ja bestialisch.“
Nach acht Stunden in der Mine (oder nach neun Stunden wieder im Quartier) greifen sie verstaubt, verschwitzt und ungewaschen nach ihren Kochgeschirren und Eßnäpfen und reihen sich in der Küche auf, wo Tünnes das Mittagessen austeilt. Es gibt Suppe aus braunen Bohnen.
Bevor Tünnes die Suppe austeilt, schöpft er von der Oberfläche die Käfer ab, die beim Kochen aus ihren nahrhaften Quartieren ausgetrieben worden sind und nun als Proteinbeigabe die Suppe zieren. Da niemand weiß, wie die Suppe ohne Käfer schmecken würde, beeinträchtigen sie nicht den Geschmack. Einige Kameraden schimpfen, andere verziehen angeekelt das Gesicht, aber alle essen letzten Endes. Max löffelt ohne Protest, er hat Hunger.
Weil der Hunger auch nach dem Essen anhält, zieht er mit Bodo los, Kastanien organisieren, sprich: klauen.
Der Posten, es ist wieder Marcel, hockt bei Tünnes in der Küche und trinkt einen Becher Roten. Den dreien oder vieren, die in der Küche herumlungern, bietet er eine Selbstgedrehte an.
Max und Bodo schleichen sich hinten ums Haus und steigen durch das Buschwerk zum Bahndamm der Schmalspurbahn hoch, die hinter dem Haus am Hang entlangfährt. Dahinter führt der Weg in den Kastanienwald. Der näher gelegene Teil ist schon abgegrast, sie müssen weiter nach oben steigen und bemühen sich, ungesehen zu bleiben. Bald liegen die glänzenden reifen Kastanien dichter beieinander am Boden.
Max sammelt sie in seinen Brotbeutel, Schmude hat einen selbstgenähten länglichen Sack mitgenommen. Max beschließt, sich möglichst bald etwas ähnliches anzufertigen, damit sich ein Beutezug besser lohnt. Als Max keine Kastanien mehr findet, wirft er einen abgebrochenen trockenen Ast in den Baum, um mehr Kastanien herunterzuholen.
Bodo ist erschrocken: „Biste verrückt? Willste erwischt werden?“
„Wieso? Ist keiner zu sehen.“
„Die Waldhüter schleichen sich manchmal an!“
Max spielt den Pomadigen: „Na und? Was können sie uns.“
„Erst mal können se uns verdreschen!“
„Wenn sie uns kriegen ...“
„Und wenn se uns hier ohne Posten erwischen, schicken se uns int Lager zurück, da kannste wieder Gras fressen! Et reicht überhaupt, laß uns jehn!“
Bevor sie dazu kommen, kracht ein Schuß.
Max wirft sich hin: „Au verflucht!“
Schmude ergreift seinen Sack: „Nischt wie weg!“, und hastet davon. Max folgt ihm. An der Schmalspurbahn lassen sie sich atemlos in das Gebüsch an der Böschung fallen.
Schmude keucht: „Die Mistkerle! Schießen uff allet und jeden. Schießen sojar die Singvögel und fressen se uff.“
„Vielleicht war bloß einer jagen.“
„Daruff will ick mir nich verlassen ...“
Auf dem Weg neben den Geleisen nähern sich Mädchenstimmen. „Los, in Deckung!“ Sie kriechen vorsichtig tiefer in das dichte Brombeergesträuch, an dem noch dicke Beeren hängen. Max kostet sie und sagt leise: „Mann! Ganz süß. Will anscheinend keiner haben. Da gehn wir doch morgen Brombeeren pflücken.“
„Jetzt halt die Schnauze!“
Drei Mädchen, um die Fünfzehn, kommen schwatzend und kichernd vorbei.
Schmude flüstert: „Ick nehm die Schwarze mit den dicken Titten. Der möcht’ ick et mal besorjen!“
Max verfolgt die Mädchen interessiert, sagt aber nichts. Er stellt sich Christina vor und vergleicht mit der Oberweite der Schwarzen. Das gegenwärtige Beispiel ist eindrucksvoller, geht aber leider zu schnell vorbei.
Als die Mädchen fort sind, tauchen die Jungen aus dem Gebüsch auf und machen sich auf den Heimweg.
Bodo ist neugierig: „Haste eijentlich schon mal wat mit Mädchen jemacht?“
„Als wir Luftwaffenhelfer waren, da haben wir sie abgeknutscht“, berichtet Max. Er verschweigt lieber, daß er nach diesem Ereignis seine Mutter befragt hatte, ob ihm das schaden könne, wenn er ein Mädchen küßt!
Bodo will es genauer wissen: „Knutschen? Und weiter? Haste schon mal eene jepimpert?“
Max ist peinlich berührt und antwortet schroff: „Nee! Bin ick nicht zu gekommen.“
Bodo schwelgt: „Is ’ne dolle Sache!“ Dann spielt er den Lasterhaften und singt: „Fotze lecken, das muß schmecken, besser als die Zigaretten, ejehjeh ...!“
Max fühlt sich abgestoßen: „Hör auf, du Sau!“
„Wat haste denn? Na ja, kommste schon noch dahinter.“
Das einzige Mädchen, das Max länger gekannt hatte – abgesehen von der älteren und längeren Jutta aus der entfernten Verwandtschaft –, war Püppi, die Nachbarstochter von gegenüber. Sie war zwei Jahre jünger als er, dünn und sommersprossig, und hatte zwei vom Kopf abstehende blonde Rattenschwänze. Beim Buddeln hatte sie ihm einmal mit dem Spaten über die Nase gehauen, und er hatte geblutet wie ein abgestochenes Schwein. Später, als er vielleicht vierzehn war, kam es vor, daß sie an einem Familiengeburtstag in Anwesenheit ihrer Mütter um den Tisch tanzten, und daß er sie an sich quetschte, so daß seine Mutter bremste: „Na na, man nicht zu dichte!“ Doch Püppis Mama hielt dagegen: „Laß sie doch! Sonst haben sie ja gar nichts davon.“ Was Max davon gehabt hatte, war ein leicht erregendes, schwer erklärbares, aber nicht unangenehmes Gefühl.
Max’ Vater bemerkte das Bildungsdefizit seines Sprößlings und bot ihm an: „Willst du nicht mal eine Fete machen?“
„Was für ’ne Fete?“ Max ist wenig begeistert, sein Vater ist enttäuscht, er versucht es weiter: „Hast du nicht Lust zu tanzen?“ Er macht ein paar Walzerschritte und schießt Püppi einen ermunternden Blick zu. Angesichts dieser Verschwörung klappt Max die Läden zu: „Ich hab’ auch meinen Dominik noch nicht ausgelesen. Der Vater ist ein wenig enttäuscht und gibt auf: „Na, wie du willst.“
Püppi hatte einen drei Jahre älterer Bruder, Karl-Heinz, ein Jahr älter als Max, und drei Jahre weiter – vielleicht weil er eine Schwester hatte. Gelegentlich erzählte er Max, er dürfe mit Püppi alles tun, was er wolle, und Max verstand nicht so recht, was er denn wollen könne.
Sie saßen an einem der träge machenden Sommernachmittage am Sandberg unter den Kiefern, und Karl-Heinz kratzte den Zuckersand beiseite, um auf dem feuchteren, festeren Boden etwas zu zeichnen und zu kommentieren: Über einem waagerechten Strich – einem See – ein Dreieck mit einem senkrechten Strich in der Mitte – ein Zelt. Darunter ein Dreieck kopfstehend, ein Rhombus – das Spiegelbild des Zeltes. Um das Zelt büschelige Kringel – der Rauch des Lagerfeuers. Und dann stieß der steife Zeigefinger heftig in das Zelt – die Feuerwehr kommt, um zu löschen.
Max verstand gar nichts, und Karl-Heinz wurde konkret: „Haste noch nichts vom Ficken gehört?“ – „Was is ’n das?“ Karl-Heinz gab die Aufklärungsversuche auf.
Max wollte dennoch mehr wissen, packte den Löwen bei der Mähne und befragte seine Mutter, die gerade Kohlrouladen wickelte: „Mutti, was heißt ‚ficken‘“? Überrascht und geniert errötete sie und reagierte nicht sehr pädagogisch: „Woher haste denn das?! Dazu biste noch viel zu jung! Das lernste erst später.“ Ihr gestraffter Hals, die leicht hochgezogenen Augenbrauen, überrascht geweitete Augen und ein verschwörerischer Zug um den Mund verrieten ihm aber ihr Beteiligtsein bei dieser geheimnisvollen Sache. Aber Max verzichtete auf weitere Fragen, weil ihm das Ganze nicht geheuer vorkam. (PK)
Lesen Sie die Fortsetzung des biografischen Romans in der kommenden Ausgabe, oder - bequemer - bestellen Sie das Buch bei edition winterwork
Online-Flyer Nr. 299 vom 27.04.2011
Druckversion
Literatur
Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 6
Max - Jahrgang 27
Von Lutz Köhlert
Sie biegen von der Dorfstraße ab und steigen hinunter ins Tal. Der Nieselregen hat aufgehört, ein Lüftchen schiebt die Wolken vor sich her. Flußaufwärts muß es stärker geregnet haben, denn der Gardon springt mit ärgerlichen Schaumspritzern über das Geröll. Der Nebel verweht, die Berge stehen wie eine Kulisse gegen das Bühnenlicht des jungen Tages.
Eine klapprige Fußgängerbrücke führt über das Flußbett, und drüben steigt der schottrige Weg wieder an und windet sich um den Hang in die Höhe. Neben dem Weg wuchert wildes Buschwerk, unterbrochen von gelbgrünen Matten, später dann beherrschen die grün-bronzenen Blattkronen der Kastanienwälder die Hänge.
Nach einer knappen halben Stunde weht vor ihnen über den Bäumen Rauch auf, und als sie die nächste Kehre genommen haben, sehen sie die Grube vor sich. Eine Plattform aus rötlich-grauem Stein und Geröll, der Rumpf eines abgetragenen Bergrückens, führt in sanfter Neigung zu einem dunklen Schlund und in den Bauch des Berges. Zwei dünne silberne Fäden, die Gleise einer Schmalspurbahn, verlieren sich darin. Wie ein rostiger Eisenwurm hocken Kipploren auf den Schienen und warten auf Einlaß. Seitlich fällt eine Abraumhalde steil in das Tal ab.
Eine kleine Baracke bewacht den Grubeneingang. Hier werden mit Strichen auf einer Kreidetafel die Hunte gezählt, die entweder den Abraum ins Tal kippen, oder das Antimonerz dem Brecher zuführen, der schon seinen Rachen aufreißt, noch aber seine gierigen Backen stillhält.
Vom Brecher aus führt ein Förderband zu einer Schütte über dem Röstofen. Der besteht aus einer langen, schwarzrostigen, schrägliegenden, sich ständig drehenden Eisenröhre, in die oben das Erz geschüttet wird und deren unteres Ende in einen mit Koks gefütterten Ofen mündet. Seine Flammen lodern über das Erz hinweg und lassen das Antimon aus dem Erz sublimieren. Der Ofen dreht sich langsam und pausenlos, speit ständig rotgelben Qualm aus, verdaut das Mineral und scheidet es in staubförmiges Antimonoxyd, wertlose Schlacke und giftige Abgase. Das Antimonoxyd, ein graues bis rötliches Pulver, wird unter anderem für Lagermetalle in Hochleistungsmotoren und für Drucktypen gebraucht.
Die Gefangenen, die den Ofen in Gang halten, sind unterernährt und vom Schwefel und Arsen der Abgase vergiftet. Aber sie funktionieren wie der Ofen rund um die Uhr, weil sie keine andere Wahl haben.
Das Antimon wird nach drei Güteklassen in Papiersäcke gefüllt, das rötliche Pulver ist das Wertvollste. Die rauchende Schlacke kommt auf die Halde, den Hang hinab. Sie enthält noch unverbrannte, krümelige Koksreste, die sich die Gefangenen auflesen dürfen, um ihre Bruchbude zu heizen.
Am Ofen wirtschaftet schlaff eine müde Gestalt mit grauem Gesicht und geröteten Augen, der ‚Anarchist‘ Tanne, ein anderer hockt daneben, den Brotbeutel umgehängt, und erwartet die Ablösung. Es ist Reinhard Balke, ehemals Spieß in einer Versorgungseinheit, davor Bankkassierer, ein mittelgroßer, leicht verfetteter Mann mit hängenden Lidern, phlegmatischem Temperament und schleppender Sprechweise. Er wirkt pomadig und maulig, ist mißtrauisch aus Erfahrung, im Grunde aber eher gemütlich.
„Guten Morgen allerseits!“ begrüßt Gottlieb trällernd und betont munter die Ofenbesatzung. Reinhard Balke betrachtet ihn wie einen armen Irren.
Tanne meckert: „Wird auch Zeit, daß ihr kommt!“
Robert frotzelt: „Gut geschlafen?“, und: „Habt ihr wieder die Schütte leergefahren?“
„Mann, fang nicht schon wieder so an!“
„Bringt mal am Nachmittag noch was Koks mit, es wird langsam kalt nachts. Aber nicht so ’ne Krümel!“ Gemeint sind damit ein paar größere Brocken Grubenkoks, die zwar nicht erlaubt sind, aber besser brennen.
Als die Kolonne zum Stehen kommt, eilt aus der Baracke ein Mann herbei. Er ist mittleren Alters, mittelgroß, dürr und hat ein verkniffenes Gesicht und verhuschte Bewegungen. „Salut, Matthieu!“ grüßt er den Posten.
„Salut, Stani. Voilà l’équipe!“ grüßt der zurück. „C’est une troupe bien melée, n’est-ce-pas?“
„On va voir ...“, antwortet der andere unbestimmt. „Alors ...“, er wendet sich in gebrochenem Deutsch an die Gefangenen: „Also, ich bin Mauser, euer Steiger. Ihr sollt auf mir horchen! Wenn ihr hier gutt arbeiten, dann ihr gutt leben!“
Tanne mault: „Ach, du lieber Himmel! Das nennt der ‚gutt leben‘ ...“
Während der Posten den dreien vom Ofen winkt und sich mit ihnen zum Gehen wendet, teilt Mauser die anderen zur Arbeit ein. Max und Schmude werden Räumer und Lorenschieber. Schmude erklärt es Max: „Das ist nicht so schlecht. Da kannste deinen eigenen Trott gehen. Die Strecken sind miserabel, aber wenn die Lore entgleist, haste Pause und wartest, bis dir einer helfen kommt. Du mußt nur deine Lampe auspusten, am besten auch den Brenner wegschmeißen, weil du sie dann nicht mehr anzünden kannst. Das kannste natürlich nicht allzuoft machen, sonst reden sie von Sabotage und schicken dich ins Lager zurück.“
Elektrisches Licht gibt es nur bis zum Aufzug, für die Stollen bekommen sie Karbidlampen. Die bestehen aus zwei übereinander angeordneten Blechtöpfen und einem oben eingeschraubten Brenner. In den unteren Topf wird Karbid gefüllt, in den oberen Wasser. Läßt man Wasser auf das Karbid tropfen, entsteht Azethylengas und am Brenner eine leuchtende Flamme. Die Flamme darf nicht ausgehen, denn es gibt keine Streichhölzer, um sie wieder anzuzünden. Und vor allem darf man nicht zur falschen Zeit den Brenner verlieren, sonst steht man im Dunkeln.
*
Die Lampen werden angezündet, sie gehen in den Berg.
Der Stollen ist mit Kastanienhölzern verbaut und so schmal, daß gerade die kleinen Hunte hindurchpassen und neben den Gleisen noch Platz für einen Graben ist, der das Sickerwasser aus der Grube hinausführt. Ständig tropft und zieht es. Belüftet wird die Grube nur durch den natürlichen Luftzug zwischen den höher gelegenen neuen und einem tiefer gelegenen alten Stollen. Der führt auf der anderen Seite aus dem Berg hinaus. Der Berg ist durchbohrt. Der Weg durch den alten Stollen zum Lager ist viel kürzer, aber wegen der Einsturzgefahr gesperrt.
Einige hundert Meter weit stapfen sie horizontal in den Berg, bemüht, nicht über die Schwellen zu stolpern und sich nicht an den niedrigen Scheitelhölzern den Schädel einzuschlagen. Max spürt eine leichte Platzangst, behält sie aber unter Kontrolle. Schließlich kommen sie an einen Schrägaufzug, mit dem es weiter in die Tiefe geht. Der Aufzug ist eine einfache hölzerne Plattform auf Schienen, ohne Geländer, und führt mit etwa fünfundvierzig Grad Neigung in eine finstere Tiefe, aus der die funzligen Glühbirnen wie verlöschende Sterne scheinen. Er dient zum Transport der Hunte und der Bergleute. Sie stellen sich nebeneinander auf die Plattform und halten sich aneinander fest, um nicht durch das Rütteln des Schlittens das Gleichgewicht zu verlieren und sich am rauhen Felsen der Schachtwände Kleidung und Haut aufzureißen.
Nach weiteren zweihundert Metern Weg auf der unteren Sohle sind Max und Bodo an ihrem Arbeitsplatz. Das ist ein Vortrieb, in dem das Hängende heruntergebrochen ist und zu zwei Dritteln die drei bis vier Meter hohe Höhle ausfüllt. Die Wände bestehen aus blättrigem, unzuverlässigem Schichtgestein. Hier ist noch nichts verbaut, die Strecke muß erst geräumt werden, bevor die Zimmerleute arbeiten können. Max hebt einen der glatten, glänzenden Brocken auf und betrachtet ihn von allen Seiten. Als er ihn fester packt, zerbröselt er ihm unter den Händen.
Bodo erklärt ihm: „Glimmerschiefer. Sieht aus wie Marmor und ist bloß Mist.“
Obwohl er nicht an Klaustrophobie leidet, glaubt Max sekundenlang das ohrenbetäubende Kreischen zu hören, das die zehntausend Umdrehungen der Kreiselpumpen im Maschinenraum des Zerstörers ‚Hans Lody‘ verursacht haben.
Bodo beobachtet Max und versucht ihn abzulenken: „Kipp mir bloß nicht um. Hier musst du ’n Jemüt wie ’n Maulwurf haben.“
Max reißt sich zusammen: „Quatsch. Aber wenn ich den Haufen sehe, den wir wegschippen sollen, wird mir mulmig.“
*
Max leidet nicht an Platzangst, aber er hat doch lieber Raum um sich her. Als Kind hatte er wiederholt einen ihm unerklärlich angenehmen Traum: Er hatte ein Spielzeughaus, vielleicht tischhoch, in dem er durch enge Flure, Treppen und Räume kriechen mußte, so eng, daß er sich gerade hindurchwinden konnte. Aber das verursachte ihm keine Angst.
Wirklich beeindruckend waren Erlebnisse in seiner Zeit als Maschinengast auf dem Zerstörer.
Das Schiff hatte in drei Kesselräumen sechs Dampfkessel. Sie konnten in einer Stunde dreihundertzwanzig Kubikmeter Wasser in sechshundert Grad heißen Dampf verwandeln. Die Kesselräume waren so vollgestopft mit Rohrleitungen, Ventilen, Manometern und Pumpen, daß Max beim ersten Betreten dieses Labyrinths den Ausgang nicht wiederfand, als er sich einmal umgedreht hatte.
Als das Schiff aus der Werft kam, mußte er einmal auf den noch heißen (wenn auch isolierten) Kessel klettern, über dem vielleicht sechzig Zentimeter Platz war, und allen Reparaturschrott herabwerfen, der dort liegengeblieben war.
Ein anderes Mal mußte er in das vier Meter große Lüfterrad kriechen, um den fingerdicken Staub herauszufegen, und er wurde den Gedanken nicht los, daß der Lüfter durch irgendeinen blödsinnigen Umstand in Gang gesetzt werden könnte, während er in dieser blechernen Schleuder steckte.
Der schlimmste Alptraum war, als er während der Fahrt in den Doppelboden unter der Bilge kriechen mußte, eine nur etwa fünfzig Zentimeter hohe Kammer unmittelbar über dem Schiffsboden, um den dort abgelagerten schmierigen Salzschlamm herauszukratzen. Nur sechs Millimeter Stahl waren zwischen ihm und der Meerestiefe, und das Schiff, auf Geleitfahrt von Flugzeugen angegriffen, krängte bald nach Backbord, bald nach Steuerbord, und kein Mensch wußte, was im nächsten Moment passieren würde.
*
Bodo Schmude erklärt Max, was Erz und was Abraum ist, welchem Stein er vertrauen kann und vor welchem er sich in Acht nehmen muß. Das trügerische Schichtgestein blättert wie Glimmer in glitzernden Schichten auseinander, die Antimonblende findet sich in hartem Quarz, der blaukristallen und silbern funkelt.
„Ick muß mal“, sagt Bodo und verdrückt sich in einen stillgelegten Quertrieb.
Max bemüht sich derweil im Schein der Karbidlampe in dem engen Raum zwischen Bruchstein und Stollenwand, das Erz vom Abraum zu trennen. Er haut mit dem Ellbogen an die rauhe Wand. „Verfluchter Mist!“ Wie lange wird er in diesem Loch arbeiten müssen?
Bodo erscheint wieder, sich die Hose zuschnürend, und mißbilligt Max’ Eifer: „Kratz doch das bißchen Dreck nicht noch auseinander! Was haste davon? Alles rin in den Karren und weg damit.“
Er hilft, den Hunt vollzuladen, und stützt sich dann auf die Schaufel, wie ein Arbeiterdenkmal: „Schieb ab! Und paß in der Kurve auf, daß er dir nicht aus den Schienen springt.“
Max hängt seine Lampe an die Vorderwand des Hunts, wirft sich mit seinem Körpergewicht gegen die vollgeladene Lore und bringt sie langsam in Bewegung. Aus dem ersten Quertrieb stinkt es. Max verzieht angeekelt das Gesicht.
An der Ausweichstelle warten Sigi Welle mit einem leeren Hunt und Mauser. Der blafft Max an: „Was machen ihr? Finger im Arsch drehen? Sigi stehen und trampeln ...“
Sigi wiegelt ab: „Och, ich hab’ Zeit ...“
Mauser redet sich in Wut: „Kein Erz bei Brecher, Stollen nicht frei, Hunt warum nicht voll?“
Max verteidigt sich: „Der ist doch voll! Wenn noch mehr drin ist, schiebt er sich zu schwer durch die Kurven.“
„Was schwer? Du dummfaul!“
Er blickt in den Hunt und kramt einen Brocken Erz heraus: „Und was Erz in Abraum? Oben kein Erz, wo sein soll, und hier Erz, wo kein sein soll! Ihr dummfaul! Besser aufpassen. Arbeiten, nicht sein faul. Marsch, marsch!“ Er winkt Max, den leeren Hunt zu nehmen, und stapft ihm voraus zum Vortrieb.
Sigi schneidet ihm eine Grimasse und tippt sich mit dem kleinen Finger an die Schläfe: „Selber dummfaul.“ Er schiebt den vollen Hunt zum Aufzug, und Max beeilt sich, Mauser mit der leeren Lore zu folgen. Um Bodo vor Mausers Kommen zu warnen, beginnt er laut zu singen: „Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist des ...“
Mauser wendet sich wütend um: „Was du tönen? Halt Schnauze und schieb!“ Als Mauser am Quertrieb vorbeikommt, verzieht er ebenfalls angewidert das Gesicht und stoppt, so daß Max ihm beinahe in die Hacken fährt. Er leuchtet in den Quertrieb hinein: „Scheiße! Hingescheißt! Ihr Mistkerle.“
Max ist zwar auch angeekelt, aber er verteidigt Bodo: „Wohin soll’n wir denn gehen? Hier ist doch keine Latrine.“
Mauser: „Könnt wenigstens zuschippen, nicht? Aber zu faul!“
Er geht weiter und Max singt wieder: „Vom Wasser haben wir’s gelernt, vom Wasser haben wir’s gelernt, vom Wa-has-ser!“
Mauser stößt einen ellenlangen spanischen Fluch aus, in dem „Puta Madre de Dios!“ mehrmals vorkommt, läßt Max aber singen.
Als sie Bodo erreichen, stochert der kraftlos im Gestein.
Mauser beginnt sofort wieder zu schimpfen: „Viel Stein, wenig Waggon! Was ihr machen?“
Bodo mault: „Hier kann man sich nicht bewegen.“
„Wenig bewegen für wenig Platz, dann mehr Platz, dann mehr bewegen!“ erklärt Mauser. Er ergreift Schmudes Schaufel und führt geschickt vor, wie man in dem engen Raum schippen kann. Schmude lehnt sich grinsend an die Wand und schaut zu.
Mauser sieht das und schmeißt wütend die Schippe hin: „Na los, du! Bewegen! Und nicht in Stollen scheißen.“
Schmude spielt den Entrüsteten: „Wir? Wo denn? Das war wer anders! Das muß schon gewesen sein.“
„War nicht gewesen. Ist ganz neu. Sie dämpft ja noch!“ Zu Max: „Los, geh zuschippen.“
„Ich??“
„Ja du! Wer scheißt, schippt. Und jetzt arbeiten. Nicht arbeiten, dann nicht essen.“
Schmude verteidigt seinen Gefangenenstatus: „Für das bißchen Fressen arbeiten wir jenuch.“
„Franzosen haben auch nicht mehr essen! Ihr fleißig in Krieg, jetzt faul in Frieden.“
„Wo warste denn im Krieg? Warste da nicht auch fleißig?“
Mauser richtet sich auf und sagt fast würdevoll: „Ich war Spanien bis Krieg! Dann Résistance, dann Frankreich KZ!“
Max will Schmude gegenüber mit Kenntnissen glänzen und fordert Mauser heraus. Er artikuliert deutlich: „Dann zeigen Sie mal Ihre KZ-Nummer!“
Mauser preßt die Lippen zusammen und zögert ein paar Sekunden, dann streift er den Hemdsärmel hoch und weist seinen Unterarm vor. Dort ist eine blaue Nummer eintätowiert.
In Max kommt eine heiße Welle von Scham hoch. „Entschuldigen Sie ...“, sagt er betreten.
Mauser wendet sich ohne weitere Worte und stapft davon.
Schmude ist unbeeindruckt: „Blöde Sau! Will ick hier arbeiten? Nee!“
Max will mehr über Mauser wissen: „Was isser eigentlich für ein Mensch?“
„Sein Vater is woll Pole, aber ’n halber Deutscher, und die Mutter tschechisch oder balkanesisch oder so wat. Gloob ick jedenfalls. Und seine Frau ist aus Spanien.“
Aber auch Bodo Schmude ist nicht so wurstig, wie er tut: „Is immer hin- und herjeschubst worden. Eijentlich ’n armet Schwein. Hier arbeiten übrijens noch mehr Spanier, als Zimmerleute in der Nachtschicht.“
Max kehrt zur niederen Gegenwart zurück: „Aber deine Kacke kannste wirklich zuschippen! Stinkt ja bestialisch.“
Nach acht Stunden in der Mine (oder nach neun Stunden wieder im Quartier) greifen sie verstaubt, verschwitzt und ungewaschen nach ihren Kochgeschirren und Eßnäpfen und reihen sich in der Küche auf, wo Tünnes das Mittagessen austeilt. Es gibt Suppe aus braunen Bohnen.
Bevor Tünnes die Suppe austeilt, schöpft er von der Oberfläche die Käfer ab, die beim Kochen aus ihren nahrhaften Quartieren ausgetrieben worden sind und nun als Proteinbeigabe die Suppe zieren. Da niemand weiß, wie die Suppe ohne Käfer schmecken würde, beeinträchtigen sie nicht den Geschmack. Einige Kameraden schimpfen, andere verziehen angeekelt das Gesicht, aber alle essen letzten Endes. Max löffelt ohne Protest, er hat Hunger.
Weil der Hunger auch nach dem Essen anhält, zieht er mit Bodo los, Kastanien organisieren, sprich: klauen.
Der Posten, es ist wieder Marcel, hockt bei Tünnes in der Küche und trinkt einen Becher Roten. Den dreien oder vieren, die in der Küche herumlungern, bietet er eine Selbstgedrehte an.
Max und Bodo schleichen sich hinten ums Haus und steigen durch das Buschwerk zum Bahndamm der Schmalspurbahn hoch, die hinter dem Haus am Hang entlangfährt. Dahinter führt der Weg in den Kastanienwald. Der näher gelegene Teil ist schon abgegrast, sie müssen weiter nach oben steigen und bemühen sich, ungesehen zu bleiben. Bald liegen die glänzenden reifen Kastanien dichter beieinander am Boden.
Max sammelt sie in seinen Brotbeutel, Schmude hat einen selbstgenähten länglichen Sack mitgenommen. Max beschließt, sich möglichst bald etwas ähnliches anzufertigen, damit sich ein Beutezug besser lohnt. Als Max keine Kastanien mehr findet, wirft er einen abgebrochenen trockenen Ast in den Baum, um mehr Kastanien herunterzuholen.
Bodo ist erschrocken: „Biste verrückt? Willste erwischt werden?“
„Wieso? Ist keiner zu sehen.“
„Die Waldhüter schleichen sich manchmal an!“
Max spielt den Pomadigen: „Na und? Was können sie uns.“
„Erst mal können se uns verdreschen!“
„Wenn sie uns kriegen ...“
„Und wenn se uns hier ohne Posten erwischen, schicken se uns int Lager zurück, da kannste wieder Gras fressen! Et reicht überhaupt, laß uns jehn!“
Bevor sie dazu kommen, kracht ein Schuß.
Max wirft sich hin: „Au verflucht!“
Schmude ergreift seinen Sack: „Nischt wie weg!“, und hastet davon. Max folgt ihm. An der Schmalspurbahn lassen sie sich atemlos in das Gebüsch an der Böschung fallen.
Schmude keucht: „Die Mistkerle! Schießen uff allet und jeden. Schießen sojar die Singvögel und fressen se uff.“
„Vielleicht war bloß einer jagen.“
„Daruff will ick mir nich verlassen ...“
Auf dem Weg neben den Geleisen nähern sich Mädchenstimmen. „Los, in Deckung!“ Sie kriechen vorsichtig tiefer in das dichte Brombeergesträuch, an dem noch dicke Beeren hängen. Max kostet sie und sagt leise: „Mann! Ganz süß. Will anscheinend keiner haben. Da gehn wir doch morgen Brombeeren pflücken.“
„Jetzt halt die Schnauze!“
Drei Mädchen, um die Fünfzehn, kommen schwatzend und kichernd vorbei.
Schmude flüstert: „Ick nehm die Schwarze mit den dicken Titten. Der möcht’ ick et mal besorjen!“
Max verfolgt die Mädchen interessiert, sagt aber nichts. Er stellt sich Christina vor und vergleicht mit der Oberweite der Schwarzen. Das gegenwärtige Beispiel ist eindrucksvoller, geht aber leider zu schnell vorbei.
Als die Mädchen fort sind, tauchen die Jungen aus dem Gebüsch auf und machen sich auf den Heimweg.
Bodo ist neugierig: „Haste eijentlich schon mal wat mit Mädchen jemacht?“
„Als wir Luftwaffenhelfer waren, da haben wir sie abgeknutscht“, berichtet Max. Er verschweigt lieber, daß er nach diesem Ereignis seine Mutter befragt hatte, ob ihm das schaden könne, wenn er ein Mädchen küßt!
Bodo will es genauer wissen: „Knutschen? Und weiter? Haste schon mal eene jepimpert?“
Max ist peinlich berührt und antwortet schroff: „Nee! Bin ick nicht zu gekommen.“
Bodo schwelgt: „Is ’ne dolle Sache!“ Dann spielt er den Lasterhaften und singt: „Fotze lecken, das muß schmecken, besser als die Zigaretten, ejehjeh ...!“
Max fühlt sich abgestoßen: „Hör auf, du Sau!“
„Wat haste denn? Na ja, kommste schon noch dahinter.“
*
Das einzige Mädchen, das Max länger gekannt hatte – abgesehen von der älteren und längeren Jutta aus der entfernten Verwandtschaft –, war Püppi, die Nachbarstochter von gegenüber. Sie war zwei Jahre jünger als er, dünn und sommersprossig, und hatte zwei vom Kopf abstehende blonde Rattenschwänze. Beim Buddeln hatte sie ihm einmal mit dem Spaten über die Nase gehauen, und er hatte geblutet wie ein abgestochenes Schwein. Später, als er vielleicht vierzehn war, kam es vor, daß sie an einem Familiengeburtstag in Anwesenheit ihrer Mütter um den Tisch tanzten, und daß er sie an sich quetschte, so daß seine Mutter bremste: „Na na, man nicht zu dichte!“ Doch Püppis Mama hielt dagegen: „Laß sie doch! Sonst haben sie ja gar nichts davon.“ Was Max davon gehabt hatte, war ein leicht erregendes, schwer erklärbares, aber nicht unangenehmes Gefühl.
Max’ Vater bemerkte das Bildungsdefizit seines Sprößlings und bot ihm an: „Willst du nicht mal eine Fete machen?“
„Was für ’ne Fete?“ Max ist wenig begeistert, sein Vater ist enttäuscht, er versucht es weiter: „Hast du nicht Lust zu tanzen?“ Er macht ein paar Walzerschritte und schießt Püppi einen ermunternden Blick zu. Angesichts dieser Verschwörung klappt Max die Läden zu: „Ich hab’ auch meinen Dominik noch nicht ausgelesen. Der Vater ist ein wenig enttäuscht und gibt auf: „Na, wie du willst.“
Püppi hatte einen drei Jahre älterer Bruder, Karl-Heinz, ein Jahr älter als Max, und drei Jahre weiter – vielleicht weil er eine Schwester hatte. Gelegentlich erzählte er Max, er dürfe mit Püppi alles tun, was er wolle, und Max verstand nicht so recht, was er denn wollen könne.
Sie saßen an einem der träge machenden Sommernachmittage am Sandberg unter den Kiefern, und Karl-Heinz kratzte den Zuckersand beiseite, um auf dem feuchteren, festeren Boden etwas zu zeichnen und zu kommentieren: Über einem waagerechten Strich – einem See – ein Dreieck mit einem senkrechten Strich in der Mitte – ein Zelt. Darunter ein Dreieck kopfstehend, ein Rhombus – das Spiegelbild des Zeltes. Um das Zelt büschelige Kringel – der Rauch des Lagerfeuers. Und dann stieß der steife Zeigefinger heftig in das Zelt – die Feuerwehr kommt, um zu löschen.
Max verstand gar nichts, und Karl-Heinz wurde konkret: „Haste noch nichts vom Ficken gehört?“ – „Was is ’n das?“ Karl-Heinz gab die Aufklärungsversuche auf.
Max wollte dennoch mehr wissen, packte den Löwen bei der Mähne und befragte seine Mutter, die gerade Kohlrouladen wickelte: „Mutti, was heißt ‚ficken‘“? Überrascht und geniert errötete sie und reagierte nicht sehr pädagogisch: „Woher haste denn das?! Dazu biste noch viel zu jung! Das lernste erst später.“ Ihr gestraffter Hals, die leicht hochgezogenen Augenbrauen, überrascht geweitete Augen und ein verschwörerischer Zug um den Mund verrieten ihm aber ihr Beteiligtsein bei dieser geheimnisvollen Sache. Aber Max verzichtete auf weitere Fragen, weil ihm das Ganze nicht geheuer vorkam. (PK)
Lesen Sie die Fortsetzung des biografischen Romans in der kommenden Ausgabe, oder - bequemer - bestellen Sie das Buch bei edition winterwork
Online-Flyer Nr. 299 vom 27.04.2011
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE
















 Mai 1945 - Der zweite Weltkrieg ist zu Ende. Zu den ziel- und richtungslosen deutschen Soldaten gehört auch Max, siebzehnjähriger Kadett der Deutschen Kriegsmarine, den es nach Norwegen verschlagen hat. Er wird von den Engländern interniert, von den Amerikanern abtransportiert und den Franzosen übergeben. Die stecken ihn in eine Antimonmine in den Cevennen. Dort arbeitet er bis Ende 1947, meist unter Tage. Die Arbeit ist schwer und nicht ungefährlich. Eine gewisse Entschädigung dafür ist das sanfte Mittelmeerklima, seine schöne Vegetation und reiche Fruchtbarkeit. Noch Jahrzehnte später wird er von den sonnigen Felsterrassen über dem Gardon träumen, vom „Garten Frankreichs“, wo er das „Dornröschenschloß“ findet und seine erste Liebe, Marie-Paule.
Mai 1945 - Der zweite Weltkrieg ist zu Ende. Zu den ziel- und richtungslosen deutschen Soldaten gehört auch Max, siebzehnjähriger Kadett der Deutschen Kriegsmarine, den es nach Norwegen verschlagen hat. Er wird von den Engländern interniert, von den Amerikanern abtransportiert und den Franzosen übergeben. Die stecken ihn in eine Antimonmine in den Cevennen. Dort arbeitet er bis Ende 1947, meist unter Tage. Die Arbeit ist schwer und nicht ungefährlich. Eine gewisse Entschädigung dafür ist das sanfte Mittelmeerklima, seine schöne Vegetation und reiche Fruchtbarkeit. Noch Jahrzehnte später wird er von den sonnigen Felsterrassen über dem Gardon träumen, vom „Garten Frankreichs“, wo er das „Dornröschenschloß“ findet und seine erste Liebe, Marie-Paule. Max, Jahrgang 1927, 16jähriger Luftwaffenhelfer, später Kadett der Kriegsmarine auf dem Zerstörer „Hans Lody“, schildert seine Erlebnisse während des Krieges und in französischer Kriegsgefangenschaft. Seine Erinnerungen kreisen um die Arbeit im Bergwerk, um die erste Liebe zu der Französin Marie-Paule, die vergeblichen Fluchten und die endliche Heimkehr in das besetzte Deutschland. Reflexionen über die Sinnlosigkeit und Grausamkeit des Krieges haben angesichts weltweiter kriegerischer Aktivitäten nichts von ihrer Aktualität verloren.
Max, Jahrgang 1927, 16jähriger Luftwaffenhelfer, später Kadett der Kriegsmarine auf dem Zerstörer „Hans Lody“, schildert seine Erlebnisse während des Krieges und in französischer Kriegsgefangenschaft. Seine Erinnerungen kreisen um die Arbeit im Bergwerk, um die erste Liebe zu der Französin Marie-Paule, die vergeblichen Fluchten und die endliche Heimkehr in das besetzte Deutschland. Reflexionen über die Sinnlosigkeit und Grausamkeit des Krieges haben angesichts weltweiter kriegerischer Aktivitäten nichts von ihrer Aktualität verloren.