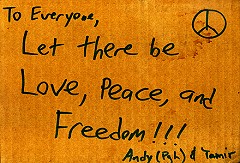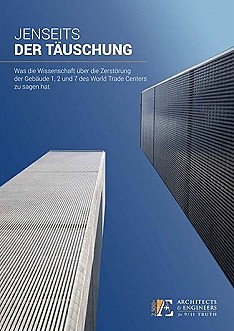SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Kultur und Wissen
Das verblüffende Resultat einer Langzeitstudie
Gleichheit macht glücklich
Von Harald Schauff
Verleger Alfred Neven DuMont, einer der reichsten Männer Kölns, unterhält seine Frau, geboren als österreichische Prinzessin Hedwig zu Auersperg, und Angela Merkel, evangelische Pfarrerstochter und während des Studiums FDJ-Agitatorin
 Quelle: NRhZ-Archiv
Quelle: NRhZ-Archiv

Einer der Ärmsten - Bettler auf der Kölner Hohe Straße
Online-Flyer Nr. 283 vom 05.01.2011
Druckversion
Kultur und Wissen
Das verblüffende Resultat einer Langzeitstudie
Gleichheit macht glücklich
Von Harald Schauff
Verleger Alfred Neven DuMont, einer der reichsten Männer Kölns, unterhält seine Frau, geboren als österreichische Prinzessin Hedwig zu Auersperg, und Angela Merkel, evangelische Pfarrerstochter und während des Studiums FDJ-Agitatorin

Er fand heraus, was Wachstumsapostel vom Glauben abfallen lässt: Nicht der vom Wirtschaftswachstum abhängige absolute materielle Wohlstand eines Landes ist für die Gesundheit und das Wohlbefinden von dessen Bevölkerung entscheidend, sondern: Der Grad der Ungleichheit in einer Gesellschaft.
Reiche lebten zwar generell gesünder als Arme. Der Vergleich reicher Länder untereinander ergab jedoch: Es spielt keine Rolle, ob die Menschen des einen Landes doppelt so reich sind wie die des anderen. So liegen die USA und Portugal hinsichtlich der Lebenserwartung fast gleichauf bei rund 75 Jahren, obwohl Portugals Pro-Kopf-Einkommen nur halb so hoch ist wie das Amerikas. Schlussfolgerung: Je gleichmäßiger die Verteilung, desto weniger Reichtum braucht es, um das gleiche Maß an Lebenszeit und Lebensqualität zu erreichen.

Einer der Ärmsten - Bettler auf der Kölner Hohe Straße
Foto: Hans-Dieter Hey
Richtig ist: Ärmere Bevölkerungsschichten leiden weltweit an einem schlechteren Gesundheitszustand, geringerer Lebenserwartung, Gewalt, Alkohol- und Drogenkonsum, psychischen Erkrankungen etc. Allerdings: In ungleichen Gesellschaften treten diese Probleme in mehrfachem Ausmaß auf. Wilkinson spricht von drei- bis zehnmal so großen Unterschieden. Dabei sind offensichtlich nicht nur die Ärmsten, sondern alle Mitglieder der Gesellschaft von den Auswirkungen der Ungleichheit betroffen. Einschließlich der gut ausgebildeten und gut bezahlten Mittel- und Oberschichten. Zu diesen Auswirkungen zählen u.a. größeres Misstrauen, vermehrtes gegenseitiges Abchecken, schärfere Status-Konkurrenz und stärkeres Verlangen nach Kontrolle.
Gleichere Gesellschaften zeichnen sich dagegen durch Vertrauen gegenüber anderen, weniger sozialen Stress, weniger Konkurrenz und mehr Beteiligung am Gemeinschaftsleben aus. Wer keine Freunde hat, die ihn unterstützen und bewundern, steht unter starkem Stress, der seine Gesundheit und sein Sozialverhalten negativ beeinträchtigt.
Ungleichheit fördert Gewaltbereitschaft
Ungleichheit fördert Gewaltbereitschaft
Ungleichheit heizt den Konsumismus an und fördert Gewaltbereitschaft. Jedoch bedeutet dies nicht automatisch, dass die Armen die Reichen attackieren. Als häufigste Ursachen von Gewalt benennt Wilkinson vielmehr mangelnden Respekt, Demütigung und Gesichtsverlust. Ungleichheit führt dazu, dass wir uns selbst und andere strenger beurteilen. Die Schlüsselrolle spielen hier Statusdifferenzen. Sie sind umso wichtiger, je ungleicher eine Gesellschaft ist. Vermögende führen Schwächeren ihre Überlegenheit vor, um ihren Status zu sichern. Jene Schwächeren verhalten sich ähnlich gegenüber denen, die noch tiefer unter ihnen rangieren. Die Gewaltbereitschaft wächst, weil die Menschen sensibler auf Demütigung und Erniedrigung reagieren. Die Gewalt richtet sich zumeist gegen Schwächere. Der soziale Druck wird von oben nach unten weitergegeben. Die reichen Schichten bunkern sich ein, schotten sich ab. Sie bezahlen ihr vermeintliches Sicherheitsgefühl mit extremem Misstrauen und Verlustängsten.
Für ihre Untersuchung klopften Wilkinson und Pickett die 50 reichsten Länder der Welt auf ihre Einkommensdifferenzen ab. Sie verglichen jeweils das obere und das untere Fünftel miteinander. Als relativ gleiche Gesellschaften erwiesen sich u.a. die skandinavischen Länder, die Niederlande und Japan. Am anderen Ende der Skala tauchten die USA, Großbritannien und Australien auf, welche gegenüber den erstgenannten Ländern eine mindestens doppelt so große Einkommensungleichheit aufwiesen. Diese wirkt sich der Studie zufolge nachweislich auf die Lebensqualität aus. Erst im späteren Verlauf seiner Forschungen kam Wilkinson auf die Idee, sich nicht nur mit den unmittelbaren Folgen von Armut zu befassen, sondern auch andere Faktoren zu berücksichtigen wie Mordraten, Anzahl der Inhaftierten, Fettleibigkeit, Alkohol- und Drogensucht, psychische Erkrankungen etc. Sein Eindruck: Ungleichheit verschlechtert nicht nur ein oder zwei Dinge, sondern: Fast alle Dinge laufen schlechter in ungleichen Gesellschaften.
Daten von anerkannten Institutionen
Daten von anerkannten Institutionen
Um den Vorwurf der Manipulation der Ergebnisse zu entkräften, griffen die beiden Briten auf Daten von anerkannten Institutionen wie den UN, der Weltbank und der OECD zurück. Dass die Unterschiede zwischen den Ländern historisch oder kulturell bedingt sind, konnten sie gleichfalls ausschließen. Bei ihrer Analyse der 50 US-Bundesstaaten stellten sie exakt dieselben Fragen und erhielten ein fast identisches Bild.
Das international große Echo auf ihr Buch deuten die beiden Briten als Zeichen für den Beginn eines Umdenkens. Durch die Finanzkrise hätte sich das positiv eingeschätzte System als schlecht erwiesen. Nun werde vermehrt über alternatives Wirtschaften und neue Formen der Mitbestimmung nachgedacht.
Den Ausführungen Wilkinsons lässt sich entnehmen, woran auch die deutsche Gesellschaft krankt: An einem extremen sozialen Ungleichgewicht, das Angst vor sozialem Absturz, abgrundtiefes Misstrauen und Kontrollzwänge nach sich zieht. Durch alle Schichten hindurch.
Gleich ob Oben, Mitte, Unten: Die Ungleichheit macht die Gesellschaft krank im Kopf. Eine Zunahme psychischer Erkrankungen, insbesondere Depressionen, ist die zwangsläufige Folge. Das soziale Gefälle selbst, in dem der Mangel an Gleichheit zum Ausdruck kommt, wird nur selten thematisiert. Stattdessen debattieren hierzulande etablierte Funktionseliten und Gelehrtenzünfte einschließlich vermeintlich alternativer Denkfabriken wie der "Heinrich-Böll-Stiftung" von oben herab über die Verbesserung von "Aufstiegsmöglichkeiten" für Menschen aus den unteren Schichten. Der Zugang zur "Bildung" soll "Chancengleichheit"
bzw. "Chancengerechtigkeit" garantieren. Wilkinson betont, dass es in seinen Studien nicht um eine solche Chancengleichheit ging, d.h. um faire Startbedingungen beim Wettlauf um Einkommen und Status, sondern um Gleichheit im Ergebnis.
Ein gewichtiger Unterschied: Das Gerede von "Aufstiegschancen" stellt die bestehende Ungleichheit nicht in Frage. Es täuscht lediglich über sie hinweg. Eins sollte dabei klar sein: Die hierarchische Gesellschaft mit ihrem "Oben" und "Unten" ähnelt der Form eines Berges oder einer Pyramide. Dies bedeutet ganz anschaulich: Nicht alle können aufsteigen, weil der Platz abnimmt, je höher es hinaufgeht. Notgedrungen kommt es zu Konkurrenz, Verdrängung und Selektion. Der Aufstieg erfolgt auf Kosten Anderer. Man stößt hier auf das ultraliberale Paradoxon der Wettbewerbs- = Ellenbogengesellschaft: Auf dem Papier werden allen die gleichen Chancen eingeräumt, doch im Endeffekt bleiben die meisten auf der Strecke und dürfen sich noch anhören, selbst schuld daran zu sein. Sie hätten halt ihre "Chance" nicht genutzt. Die Leistungs- und Karriere-Ideologie (=Idiotie) der Eliten ist an Verlogenheit nicht zu überbieten. Gerade sie schotten sich konsequent nach unten ab, während sie in großer Güte von "Öffnung", "fairem Wettbewerb" und "gesellschaftlichem Zusammenhalt" schwadronieren. Und dies auch nur, um von der Tatsache abzulenken, dass sie zumeist nicht wegen ihrer "Leistung", sondern letztlich aufgrund ihrer sozialen Herkunft zu Stellung, Ansehen und Einkünften gelangt sind.
Abbau des sozialen Gefälles notwendig
Abbau des sozialen Gefälles notwendig
Die Ergebnisse der britischen Studie legen weitere Schlüsse nahe: Eine bessere, gesündere, glücklichere, zufriedenere Gesellschaft erfordert einen Abbau des sozialen Gefälles mitsamt der daran hängenden Kopfmissgeburten. In einer solchen Gesellschaft würde nicht mehr der soziale Aufstieg, sondern die freie Entfaltung jedes Einzelnen im Vordergrund stehen. Sie folgt der Maxime: Dabeisein ist alles, Bessersein unwichtig. Indem sie für bessere Rahmenbedingungen sorgt, macht sie die Menschen in den Köpfen freier. Philosophisch könnte man dies als Verbindung von Marx und Nietzsche auffassen: Die äußere Befreiung durch Verbesserung der ökonomischen Bedingungen geht einher mit der inneren Befreiung von den Zwangsneurosen einer Sklavenmoral, wie sie vor allem im Arbeitsethos steckt.
Man könnte auch lapidarer schlussfolgern: Die Einkommens- und Vermögensschere ist so weit wie möglich zu schließen, damit es allen - gleich ob und wie arm oder reich - besser geht. Ein großer, ein wichtiger Schritt in diese Richtung wäre: Das Bedingungslose Grundeinkommen. (PK)
Online-Flyer Nr. 283 vom 05.01.2011
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE