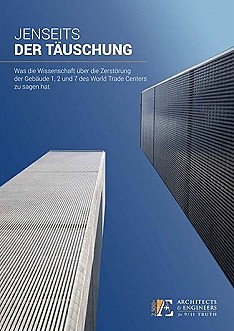SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Krieg und Frieden
Wenn aus einem "Stabilisierungseinsatz" ein "Krieg" wird
Nur ein Kampf um Wörter?
Von Friedemann Vogel

Cartoon: Kostas Koufogiorgos
Einsatz in Afghanistan. "Krieg" für Guttenberg kein Tabu mehr (ARD, Tagesschau)
Einsatz in Afghanistan.. Guttenberg spricht das K-Wort aus (Spiegel, 03.11.09)
Deutscher Afghanistan-Einsatz. Also doch im Krieg (taz, 03.11.09)
Handelt es sich hier tatsächlich nur um eine "Sprachregelung" (taz, ebd.)? - Sicherlich nicht. Hinter dem Streit um politischen Sprachgebrauch - hier um zwei Wörter - verbirgt sich vielmehr ein für Laien kaum erkennbarer Kampf um Benennung und (Wissens-)Konzeptualisierung des militärischen Handelns Deutschlands. Und dieser Kampf ist nicht Neu - erinnern wir uns an die Benennung vergangener Einsätze durch den Ex-Verteidigungsminister Struck Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt (telepolis, 13.12.2002).
Deutschland darf keinen "Angriffskrieg" führen
Die unterschiedlichen Benennungen konstituieren den Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven und ziehen zwei völlig unterschiedliche Konzept-Bündel nach sich: Erstens akzentuieren sie unterschiedlich juristische Konflikte: Die Benennung des militärischen Handelns als Krieg aktiviert juristische Fachsemantika, die die verfassungsrechtliche Legitimität (Deutschland darf keinen "Angriffskrieg" führen; Art. 26 GG) problematisieren.
Vor allem Gegner des militärischen Handelns Deutschlands verwenden das Lexem (von griech. lexis „Wort“, d.Red.) Krieg als Fahnenwort (vgl. Hermanns: 1994), um genau diese Illegitimität in der medialen Diskussion dominant zu setzen. Aber auch die militärischen Akteure selbst (die Bundeswehr) setzen auf dieses Lexem - jedoch in einer anderen diskursiven Strategie: Im semantischen Feld des “Krieges“ werden Verwundete und Tote "im Einsatz" zu Kriegsgefallenen, deren Angehörige Anspruch auf (nicht nur finanzielle) Unterstützung haben. Wer hingegen im Polizeieinsatz unter Fremdeinwirkung zu Tode kommt oder verletzt wird, stirbt oder wird verletzt im Rahmen seines Berufsrisikos und hat geringeren oder keinen Anspruch auf Hinterbliebenen-Entschädigung'. Zudem wird im Krieg auch Fehlverhalten von militärischen Akteuren (z.B. Beschuss von Zivilisten) nach Kriegsrecht moderater als nach zivilem Recht (dem eher Polizeikräfte unterstehen) bewertet.
Im Krieg wird getötet und gestorben. Fällt also das Sterben eines Soldaten im Dienst unter die Kategorie “Berufsrisiko“, vergleichbar mit Polizei und Feuerwehr? Man kann es so nüchtern sehen. Deshalb starben deutsche Soldaten bislang auch nie für Frieden, Freiheit und Demokratie, oder gar für Volk und Vaterland; sie kamen „einsatzbedingt ums Leben“, manchmal auch „durch Fremdeinwirkung“. (Tagesspiegel, 04.09.2008)
Pathos, “Mitgefühl“, Trauer
Zweitens eröffnet der Benennungs- und Konzeptualisierungskonflikt (vgl. E. Felder: 2006) gänzlich unterschiedliche moralische und emotionale Perspektiven auf das militärische Handeln. Im Krieg tendiert die nationale Berichterstattung in der Regel zu Pathos, “Mitgefühl“, Trauer um Verletzte und Gefallene. Wer hier stirbt, stirbt mit mehr “Rückhalt der Bevölkerung“. Zudem werden Kriegsakteure eher Teil von Riten und öffentlichen Zeremonien: Gefallene werden nach Hause geleitet oder empfangen; es gibt öffentliche Reden, Anteilnahme und Auszeichnungen. Hingegen erhalten Akteure während der Ausübung ihres Berufes sehr viel seltener oder zumindest nicht so medienintensive Beachtung, die Emotionen sind neutraler.
Drittens schließlich korrespondiert der Kampf um Krieg versus Einsatz bzw. Gefallene versus Opfer (im “Unfall“) mit einer eher verdeckten Bearbeitung unserer historischen Wissensrahmen. Mit der positiv, also mit Legitimation (!) perspektivierten Dominantsetzung einer Kriegs- und Gefallenensemantik versuchen Kriegsbefürworter Deutschland zugleich implizit aus seiner historisch negativ geprägten “Täter“-Rolle (NS-Verbrechen und -Angriffskriege) herauszuholen:
„Für die Bundesrepublik Deutschland gefallen"
Der Chef des Bundeswehrverbands, Bernhard Gertz, empört sich über solch „gestelzte Wendungen" [= durch Fremdeinwirkung, Berufsrisiko u.a.; Anm. FV]. Er fordert eine klarere Sprache. Mit Blick auf einen jüngst in Afghanistan getöteten 29-jährigen Soldaten sagt er, dieser sei „für die Bundesrepublik Deutschland gefallen". Das klingt zunächst, zumal vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, nach reichlich viel Pathos, Heroisierung und Überhöhung. Soldatische Totenkulte wurden den Deutschen ja gründlich ausgetrieben. Wir sind „postheroisch "geworden, (ebd.)
Gelingt eine positive Neubesetzung des Lexems Krieg samt seiner semantischen Felder in Zukunft, so ist m.E. nicht auszuschließen, dass es auch zu entsprechenden Veränderungen zunächst in der politischen Alltagspraxis (weitere militärische Einsätze), dann in der Medienberichterstattung und damit in den Wissensrahmen der Bevölkerung (positivere Bewertung von Auslandseinsätzen), in der Geschichtsschreibung militärischer Einsätze in der Vergangenheit sowie letztlich auch in der Rechtsprechung (Ab wann ist ein Kriegseinsatz ein Angriffskrieg!) kommen könnte. (PK)
Der Beitrag erschien zuerst auf den Nachdenkseiten:
http://www.nachdenkseiten.de/?p=4315#more-4315
Hierzu auch "Sie dürfen wieder morden" von Ulrich Sander in dieser Ausgabe
Online-Flyer Nr. 223 vom 11.11.2009
Druckversion
Krieg und Frieden
Wenn aus einem "Stabilisierungseinsatz" ein "Krieg" wird
Nur ein Kampf um Wörter?
Von Friedemann Vogel

Cartoon: Kostas Koufogiorgos
Einsatz in Afghanistan. "Krieg" für Guttenberg kein Tabu mehr (ARD, Tagesschau)
Einsatz in Afghanistan.. Guttenberg spricht das K-Wort aus (Spiegel, 03.11.09)
Deutscher Afghanistan-Einsatz. Also doch im Krieg (taz, 03.11.09)
Handelt es sich hier tatsächlich nur um eine "Sprachregelung" (taz, ebd.)? - Sicherlich nicht. Hinter dem Streit um politischen Sprachgebrauch - hier um zwei Wörter - verbirgt sich vielmehr ein für Laien kaum erkennbarer Kampf um Benennung und (Wissens-)Konzeptualisierung des militärischen Handelns Deutschlands. Und dieser Kampf ist nicht Neu - erinnern wir uns an die Benennung vergangener Einsätze durch den Ex-Verteidigungsminister Struck Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt (telepolis, 13.12.2002).
Deutschland darf keinen "Angriffskrieg" führen
Die unterschiedlichen Benennungen konstituieren den Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven und ziehen zwei völlig unterschiedliche Konzept-Bündel nach sich: Erstens akzentuieren sie unterschiedlich juristische Konflikte: Die Benennung des militärischen Handelns als Krieg aktiviert juristische Fachsemantika, die die verfassungsrechtliche Legitimität (Deutschland darf keinen "Angriffskrieg" führen; Art. 26 GG) problematisieren.
Vor allem Gegner des militärischen Handelns Deutschlands verwenden das Lexem (von griech. lexis „Wort“, d.Red.) Krieg als Fahnenwort (vgl. Hermanns: 1994), um genau diese Illegitimität in der medialen Diskussion dominant zu setzen. Aber auch die militärischen Akteure selbst (die Bundeswehr) setzen auf dieses Lexem - jedoch in einer anderen diskursiven Strategie: Im semantischen Feld des “Krieges“ werden Verwundete und Tote "im Einsatz" zu Kriegsgefallenen, deren Angehörige Anspruch auf (nicht nur finanzielle) Unterstützung haben. Wer hingegen im Polizeieinsatz unter Fremdeinwirkung zu Tode kommt oder verletzt wird, stirbt oder wird verletzt im Rahmen seines Berufsrisikos und hat geringeren oder keinen Anspruch auf Hinterbliebenen-Entschädigung'. Zudem wird im Krieg auch Fehlverhalten von militärischen Akteuren (z.B. Beschuss von Zivilisten) nach Kriegsrecht moderater als nach zivilem Recht (dem eher Polizeikräfte unterstehen) bewertet.
Im Krieg wird getötet und gestorben. Fällt also das Sterben eines Soldaten im Dienst unter die Kategorie “Berufsrisiko“, vergleichbar mit Polizei und Feuerwehr? Man kann es so nüchtern sehen. Deshalb starben deutsche Soldaten bislang auch nie für Frieden, Freiheit und Demokratie, oder gar für Volk und Vaterland; sie kamen „einsatzbedingt ums Leben“, manchmal auch „durch Fremdeinwirkung“. (Tagesspiegel, 04.09.2008)
Pathos, “Mitgefühl“, Trauer
Zweitens eröffnet der Benennungs- und Konzeptualisierungskonflikt (vgl. E. Felder: 2006) gänzlich unterschiedliche moralische und emotionale Perspektiven auf das militärische Handeln. Im Krieg tendiert die nationale Berichterstattung in der Regel zu Pathos, “Mitgefühl“, Trauer um Verletzte und Gefallene. Wer hier stirbt, stirbt mit mehr “Rückhalt der Bevölkerung“. Zudem werden Kriegsakteure eher Teil von Riten und öffentlichen Zeremonien: Gefallene werden nach Hause geleitet oder empfangen; es gibt öffentliche Reden, Anteilnahme und Auszeichnungen. Hingegen erhalten Akteure während der Ausübung ihres Berufes sehr viel seltener oder zumindest nicht so medienintensive Beachtung, die Emotionen sind neutraler.
Drittens schließlich korrespondiert der Kampf um Krieg versus Einsatz bzw. Gefallene versus Opfer (im “Unfall“) mit einer eher verdeckten Bearbeitung unserer historischen Wissensrahmen. Mit der positiv, also mit Legitimation (!) perspektivierten Dominantsetzung einer Kriegs- und Gefallenensemantik versuchen Kriegsbefürworter Deutschland zugleich implizit aus seiner historisch negativ geprägten “Täter“-Rolle (NS-Verbrechen und -Angriffskriege) herauszuholen:
„Für die Bundesrepublik Deutschland gefallen"
Der Chef des Bundeswehrverbands, Bernhard Gertz, empört sich über solch „gestelzte Wendungen" [= durch Fremdeinwirkung, Berufsrisiko u.a.; Anm. FV]. Er fordert eine klarere Sprache. Mit Blick auf einen jüngst in Afghanistan getöteten 29-jährigen Soldaten sagt er, dieser sei „für die Bundesrepublik Deutschland gefallen". Das klingt zunächst, zumal vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, nach reichlich viel Pathos, Heroisierung und Überhöhung. Soldatische Totenkulte wurden den Deutschen ja gründlich ausgetrieben. Wir sind „postheroisch "geworden, (ebd.)
Gelingt eine positive Neubesetzung des Lexems Krieg samt seiner semantischen Felder in Zukunft, so ist m.E. nicht auszuschließen, dass es auch zu entsprechenden Veränderungen zunächst in der politischen Alltagspraxis (weitere militärische Einsätze), dann in der Medienberichterstattung und damit in den Wissensrahmen der Bevölkerung (positivere Bewertung von Auslandseinsätzen), in der Geschichtsschreibung militärischer Einsätze in der Vergangenheit sowie letztlich auch in der Rechtsprechung (Ab wann ist ein Kriegseinsatz ein Angriffskrieg!) kommen könnte. (PK)
Der Beitrag erschien zuerst auf den Nachdenkseiten:
http://www.nachdenkseiten.de/?p=4315#more-4315
Hierzu auch "Sie dürfen wieder morden" von Ulrich Sander in dieser Ausgabe
Online-Flyer Nr. 223 vom 11.11.2009
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE