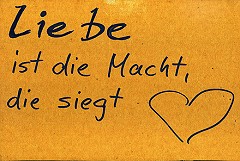SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Globales
Warum der Rüstungskonzern EADS Interesse an McCain hat
Transatlantische Muskelspiele
Von Bärbel Helweg
Hintergrund ist nicht nur das Bemühen, die Industriegewinne im eigenen Land zu halten, sondern auch Sorge um die Verwundbarkeit des Militärs. Weil die Betankung der Luftstreitkräfte strategische Bedeutung für zukünftige Kriege besitzt, dürfe sie nicht Einflussversuchen aus Europa ausgesetzt werden, verlangen neokonservative Insider des Washingtoner Establishments. Bei den Demokraten und deren Kandidaten Barack Obama erhebt sich kein Widerspruch. Im anhaltenden Kampf um den Milliardenauftrag der Air Force spitzen sich die transatlantischen Rivalitäten exemplarisch zu.

„Stratotanker" von EADS-Konkurrent Boeing bei Luftbetankung
Die Vergabe eines Großauftrags über die Lieferung von Tankflugzeugen an die US Air Force im Wert von etwa 35 Milliarden US-Dollar hatte in den Vereinigten Staaten einen erbitterten Kampf der Lobbyisten ausgelöst. Rüstungsexperten sprachen gar vom „Äquivalent eines totalen Krieges“ zwischen dem US-Konzern Boeing, der zunächst unterlegen war, und der Ende Februar vom Pentagon beauftragten Arbeitsgemeinschaft aus Northrop Grumman (ebenfalls USA) und dem deutsch-französischen Rüstungskonzern EADS. Boeing hatte Einspruch gegen die Auftragsvergabe erhoben.
EADS musste nun vor wenigen Tagen einen schweren Rückschlag hinnehmen: Der gemeinsam mit Northrop Grumman erkämpfte „Jahrhundertauftrag“ könnte wieder platzen. Der US-amerikanische Rechnungshof Government Accountability Office (GAO) gab einem Protest von Boeing statt und empfiehlt wegen Verfahrensfehlern einen Neustart des Ausschreibungsverfahrens.
Streit geht in neue Runde
Die US-Luftwaffe muss jetzt binnen 60 Tagen entscheiden, wie sie reagiert. Analysten erwarten, dass die Militärs die Entscheidung der Behörde nicht ignorieren, da schon die Auftragsvergabe an den europäischen Konkurrenten in den USA für einen öffentlichen Aufschrei gesorgt hatte. Der deutsch-französische Konzern kündigte bereits an, er werde den Verlust des milliardenschweren Deals nicht kampflos hinnehmen und an einer möglichen Neuausschreibung erneut teilnehmen.
Der Streit um den Rüstungsauftrag, der stets auch politische Dimensionen hat, geht wohl in eine neue Runde und wird Thema im US-Präsidentschaftswahlkampf. Der republikanische Bewerber John McCain verlangt bereits vom Verteidigungsministerium, den Auftrag neu auszuschreiben; der demokratische Kandidat Barack Obama schließt sich diesem Plädoyer an. Beobachter sagen weitere „transatlantische Muskelspiele“ voraus.

Obama: Where does the new ship lead to?
Quelle: Center for American Progress Fund
Obama wird in den meisten EU-Staaten, auch in Deutschland, als künftiger US-Präsident bevorzugt. Zwar rechnen Regierungsberater mehrheitlich ganz unabhängig vom Wahlausgang mit anhaltenden transatlantischen Spannungen, doch hoffen Einzelne, etwa Alexander Skiba von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), im Falle eines Obama-Wahlsieges auf einen „spürbaren Wandel“ in der US-Außenpolitik.
Ein demokratischer Präsident könne eventuell „auch für Deutschland stärkeren Einfluss auf die amerikanische Haltung in weltpolitischen Fragen ermöglichen“, meint Skiba.[1] Für den Rüstungskonzern EADS jedenfalls wäre ein Sieg Obamas klar nachteilig. Vor allem demokratische Senatoren und Abgeordnete hätten gegen die Auftragsvergabe an EADS agitiert, beobachtet die deutsche Presse, Obama selbst profiliere sich als „Hüter amerikanischer Jobs“. „Falls die USA eine demokratische Administration bekommen, dann stiegen die Chancen für Boeing“, urteilt Regierungsberater Sascha Lange von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik in der Financial Times Deutschland.
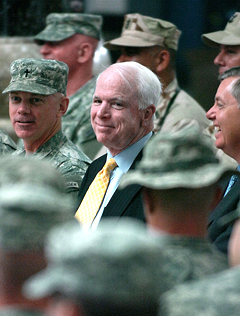
Kandidat der Republikaner John McCain auf
Besuch bei US-Truppen im Irak
Für den transatlantischen Handel insgesamt und für den EADS-Rüstungsauftrag im Besonderen wird ein Sieg des republikanischen Kandidaten als vorteilhafter eingeschätzt. McCain gilt zwar als militärpolitischer Hardliner, tritt aber stärker gegen protektionistische Maßnahmen und für freien Handel ein. Auch vor der Auftragsvergabe an EADS hatte er sich dafür eingesetzt, den deutsch-französischen Rüstungskonzern nicht zu benachteiligen.
Regierungsberater erhoffen daher von ihm bessere Konditionen für die europäische und speziell für die deutsche Wirtschaft, die erst vor kurzem erhebliche Positionsgewinne gegenüber der US-Konkurrenz vermelden konnte: „Ich meine, die transatlantische Wirtschaftspartnerschaft würde mit McCain bessere Aussichten haben als unter Obama“, urteilt die SWP-Expertin Stormy-Annika Mildner.[1] Da bekannt wurde, dass drei McCain-Berater in Washington Lobbyarbeit für EADS geleistet haben, steht dieser allerdings unter erheblichem politischen Druck; die Demokraten werfen ihm mangelnden Patriotismus sowie unangemessene Nähe zu EADS vor.
„Washington tritt wie schwacher Staat auf“
Auch unter den Republikanern gibt es jedoch starken Widerstand gegen die Vergabe eines derart wichtigen Rüstungsauftrags an die europäischen Rivalen. Das einflussreiche Center for Security Policy (CSP), das über beste Verbindungen in die US-Regierung, zum Militär und in die US-Rüstungsindustrie verfügt, hatte bereits vor der Auftragsvergabe erklärt, der deutsch-französische Rüstungskonzern sei als Lieferant der US-Streitkräfte nicht akzeptabel. Diese Haltung bekräftigt nun der ehemalige US-Botschafter bei den Vereinten Nationen John Bolton, ein „Senior Fellow“ des American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI), dessen neokonservativen Strategen ein prägender Einfluss vor allem in außenpolitischen Fragen auf die Regierung Bush nachgesagt wird.

Bush verkündet Amtsantritt von UN-
Botschafter John Bolton
Bolton erklärt, bei einer Aufgabe wie der Betankung der Luftwaffe, die für eine Weltmacht wie die USA außergewöhnlich große Bedeutung habe, dürfe potenziellen Konkurrenten kein Einfluss gewährt werden. EADS sei zwar größtenteils im Besitz von Alliierten der USA, dies schließe aber erhebliche Differenzen in militärischen Schlüsselfragen nicht aus.[2] Washington sei im Konkurrenzkampf zwischen Boeing und EADS gegenüber den europäischen Rivalen wie ein „schwacher Staat“ aufgetreten, ergänzt der Thinktank Family Security Matters, der ebenfalls enge Verbindungen zu einflussreichen Regierungskreisen unterhält. Eine Neuausschreibung des Rüstungsauftrags, heißt es, böte die Gelegenheit, diesen Fehler wettzumachen und den eigenen Interessen wieder den Vorrang zu geben.[3]
Boing bläst zum Gegenangriff
Tatsächlich stellt sich Berlin darauf ein, dass bei einer Neuausschreibung des Tankerprojekts doch Boeing den Zuschlag bekommt. Der groß angekündigte Vorstoß des Rüstungskonzerns EADS auf den mit Abstand größten Waffenmarkt weltweit wäre damit vorläufig gestoppt. Zudem steht ein Gegenangriff von Boeing bevor: Der US-Konzern hat angekündigt, er werde sich wie die deutsche EADS-Tochter Astrium und der Bremer Technologiekonzern OHB an der Neuausschreibung des europäischen Navigationssystems Galileo beteiligen. Galileo soll den ursprünglichen Plänen zufolge nicht nur mit dem amerikanischen System GPS konkurrieren, sondern auch EU-Militäreinsätze gegen das Interesse der Vereinigten Staaten ermöglichen. (CH)
Der Artikel erschien im Original auf German-Foreign-Policy.com
Online-Flyer Nr. 152 vom 25.06.2008
Druckversion
Globales
Warum der Rüstungskonzern EADS Interesse an McCain hat
Transatlantische Muskelspiele
Von Bärbel Helweg
Hintergrund ist nicht nur das Bemühen, die Industriegewinne im eigenen Land zu halten, sondern auch Sorge um die Verwundbarkeit des Militärs. Weil die Betankung der Luftstreitkräfte strategische Bedeutung für zukünftige Kriege besitzt, dürfe sie nicht Einflussversuchen aus Europa ausgesetzt werden, verlangen neokonservative Insider des Washingtoner Establishments. Bei den Demokraten und deren Kandidaten Barack Obama erhebt sich kein Widerspruch. Im anhaltenden Kampf um den Milliardenauftrag der Air Force spitzen sich die transatlantischen Rivalitäten exemplarisch zu.

„Stratotanker" von EADS-Konkurrent Boeing bei Luftbetankung
Die Vergabe eines Großauftrags über die Lieferung von Tankflugzeugen an die US Air Force im Wert von etwa 35 Milliarden US-Dollar hatte in den Vereinigten Staaten einen erbitterten Kampf der Lobbyisten ausgelöst. Rüstungsexperten sprachen gar vom „Äquivalent eines totalen Krieges“ zwischen dem US-Konzern Boeing, der zunächst unterlegen war, und der Ende Februar vom Pentagon beauftragten Arbeitsgemeinschaft aus Northrop Grumman (ebenfalls USA) und dem deutsch-französischen Rüstungskonzern EADS. Boeing hatte Einspruch gegen die Auftragsvergabe erhoben.
EADS musste nun vor wenigen Tagen einen schweren Rückschlag hinnehmen: Der gemeinsam mit Northrop Grumman erkämpfte „Jahrhundertauftrag“ könnte wieder platzen. Der US-amerikanische Rechnungshof Government Accountability Office (GAO) gab einem Protest von Boeing statt und empfiehlt wegen Verfahrensfehlern einen Neustart des Ausschreibungsverfahrens.
Streit geht in neue Runde
Die US-Luftwaffe muss jetzt binnen 60 Tagen entscheiden, wie sie reagiert. Analysten erwarten, dass die Militärs die Entscheidung der Behörde nicht ignorieren, da schon die Auftragsvergabe an den europäischen Konkurrenten in den USA für einen öffentlichen Aufschrei gesorgt hatte. Der deutsch-französische Konzern kündigte bereits an, er werde den Verlust des milliardenschweren Deals nicht kampflos hinnehmen und an einer möglichen Neuausschreibung erneut teilnehmen.
Der Streit um den Rüstungsauftrag, der stets auch politische Dimensionen hat, geht wohl in eine neue Runde und wird Thema im US-Präsidentschaftswahlkampf. Der republikanische Bewerber John McCain verlangt bereits vom Verteidigungsministerium, den Auftrag neu auszuschreiben; der demokratische Kandidat Barack Obama schließt sich diesem Plädoyer an. Beobachter sagen weitere „transatlantische Muskelspiele“ voraus.

Obama: Where does the new ship lead to?
Quelle: Center for American Progress Fund
Obama wird in den meisten EU-Staaten, auch in Deutschland, als künftiger US-Präsident bevorzugt. Zwar rechnen Regierungsberater mehrheitlich ganz unabhängig vom Wahlausgang mit anhaltenden transatlantischen Spannungen, doch hoffen Einzelne, etwa Alexander Skiba von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), im Falle eines Obama-Wahlsieges auf einen „spürbaren Wandel“ in der US-Außenpolitik.
Ein demokratischer Präsident könne eventuell „auch für Deutschland stärkeren Einfluss auf die amerikanische Haltung in weltpolitischen Fragen ermöglichen“, meint Skiba.[1] Für den Rüstungskonzern EADS jedenfalls wäre ein Sieg Obamas klar nachteilig. Vor allem demokratische Senatoren und Abgeordnete hätten gegen die Auftragsvergabe an EADS agitiert, beobachtet die deutsche Presse, Obama selbst profiliere sich als „Hüter amerikanischer Jobs“. „Falls die USA eine demokratische Administration bekommen, dann stiegen die Chancen für Boeing“, urteilt Regierungsberater Sascha Lange von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik in der Financial Times Deutschland.
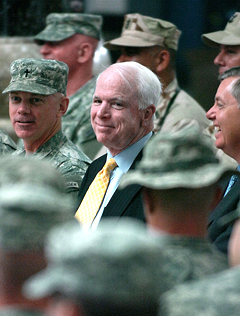
Kandidat der Republikaner John McCain auf
Besuch bei US-Truppen im Irak
Regierungsberater erhoffen daher von ihm bessere Konditionen für die europäische und speziell für die deutsche Wirtschaft, die erst vor kurzem erhebliche Positionsgewinne gegenüber der US-Konkurrenz vermelden konnte: „Ich meine, die transatlantische Wirtschaftspartnerschaft würde mit McCain bessere Aussichten haben als unter Obama“, urteilt die SWP-Expertin Stormy-Annika Mildner.[1] Da bekannt wurde, dass drei McCain-Berater in Washington Lobbyarbeit für EADS geleistet haben, steht dieser allerdings unter erheblichem politischen Druck; die Demokraten werfen ihm mangelnden Patriotismus sowie unangemessene Nähe zu EADS vor.
„Washington tritt wie schwacher Staat auf“
Auch unter den Republikanern gibt es jedoch starken Widerstand gegen die Vergabe eines derart wichtigen Rüstungsauftrags an die europäischen Rivalen. Das einflussreiche Center for Security Policy (CSP), das über beste Verbindungen in die US-Regierung, zum Militär und in die US-Rüstungsindustrie verfügt, hatte bereits vor der Auftragsvergabe erklärt, der deutsch-französische Rüstungskonzern sei als Lieferant der US-Streitkräfte nicht akzeptabel. Diese Haltung bekräftigt nun der ehemalige US-Botschafter bei den Vereinten Nationen John Bolton, ein „Senior Fellow“ des American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI), dessen neokonservativen Strategen ein prägender Einfluss vor allem in außenpolitischen Fragen auf die Regierung Bush nachgesagt wird.

Bush verkündet Amtsantritt von UN-
Botschafter John Bolton
Boing bläst zum Gegenangriff
Tatsächlich stellt sich Berlin darauf ein, dass bei einer Neuausschreibung des Tankerprojekts doch Boeing den Zuschlag bekommt. Der groß angekündigte Vorstoß des Rüstungskonzerns EADS auf den mit Abstand größten Waffenmarkt weltweit wäre damit vorläufig gestoppt. Zudem steht ein Gegenangriff von Boeing bevor: Der US-Konzern hat angekündigt, er werde sich wie die deutsche EADS-Tochter Astrium und der Bremer Technologiekonzern OHB an der Neuausschreibung des europäischen Navigationssystems Galileo beteiligen. Galileo soll den ursprünglichen Plänen zufolge nicht nur mit dem amerikanischen System GPS konkurrieren, sondern auch EU-Militäreinsätze gegen das Interesse der Vereinigten Staaten ermöglichen. (CH)
Der Artikel erschien im Original auf German-Foreign-Policy.com
Online-Flyer Nr. 152 vom 25.06.2008
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE