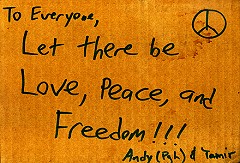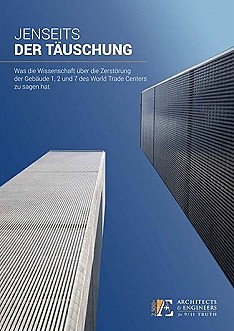Globales
Mehr als 20.000 Juden flüchteten vor den Nazis nach Shanghai
Das vergessene Ghetto von Hongkou
Von Manfred Giebenhain
Eine Gedenktafel zur Erinnerung
Die Zimmer in den oberen Stockwerken mit Blick nach Süden sind am beliebtesten. Wer in Shanghai im legendären Ocean Hotel absteigt, weiß, dass er von dort oben mehr als eine Ansichtskartenidylle zu sehen bekommt. Mit eigenen Augen betrachtet wirkt die Skyline von Pudong mit seinen skurril geformten Wolkenkratzern und dem 468 Meter hohen Sendeturm noch futuristischer. Wer im Hotel in die entgegengesetzte Richtung schaut, braucht den Blick nicht so weit schweifen zu lassen, um ein anderes Shanghai zu Gesicht zu bekommen. Unmittelbar dahinter erstreckt sich das ehemalige jüdische Ghetto im alten Stadtteil Hongkou (damalige Schreibweise Hongkew), in dem auf der Flucht vor Nazideutschland rund 15.000 deutsche und österreichische Juden unter japanischer Besatzung über zwei Jahre kaserniert waren. Die Gesamtzahl der Flüchtlinge aus ganz Europa, die von 1937 an die Stadt drängten, soll zwischen 20.000 und 25.000 betragen haben. Im Mai 1943 wurde das Ghetto eingerichtet.
Auf den ersten Blick ist in Hongkou nicht mehr viel von dem zu sehen, was vor 70 Jahren das Straßenbild prägte. Viele der eng aneinander gebauten Häuser mit ihren tristen Fassaden wirken ärmlich, nur grellbunte Reklameschilder deuten hin und wieder darauf hin, dass das Leben hier nicht stehen geblieben ist. Ein Gewirr aus Strom- und Telefonleitungen durchzieht hoch oben die Straßen und scheint mit den geschickt angebrachten Stangen zum Wäschetrocknen auszuweichen. In den Seitenstraßen der prosperierenden Metropole ist für die Erinnerung an die Vergangenheit kein Platz mehr. Selbst die Pensionäre, die sich schon morgens zum Tai-Chi im Huoshan-Park treffen, kennen die Tage im Ghetto besser aus Erzählungen als aus ihren eigenen Kindheitserinnerungen. Zu lange ist es schon her und zu viel hat sich seitdem in Shanghai verändert. An die Jahre im Ghetto erinnert eine Gedenktafel, die die Stadt- und Bezirksverwaltung 1994 im Park aufstellen ließ. In chinesischer, englischer und hebräischer Schrift wird in drei Sätzen der jüdischen Flüchtlinge gedacht, die auf der Flucht vor den Nazis von 1937 bis 1941 hier Zuflucht fanden.
Heute keine jüdische Gemeinde mehr
Nur wenige andere Spuren erinnern an die Tage, als in den Straßen Kun Ming oder Chang Yang auf Reklametafeln in deutscher Schrift Zahnärzte, Uhrmacher, Restaurantbesitzer, Bäckereien, Gemüsehändler und Wäscherein ihre Dienste angeboten hatten. „Nach dem Krieg sind sie nach Amerika, Israel und Australien ausgewandert. Bekannt ist, dass nur ein Jude eine Chinesin geheiratet hat. Sonst ist keiner hier geblieben. Heute gibt es keine jüdische Gemeinde mehr, aber jüdische Chinesen“, fasst Yang Xiao Jun in deutscher Sprache zusammen. Aufmerksam verweist der Fremdenführer auf vereinzelte Überbleibsel deutscher Spuren aus jenen Tagen. Der Staub der Stadt hat den alten Gebäuden in der Hai Men Road eine einheitliche graue Farbe verliehen. Auf einer alten Fassade lassen sich über dem Eingang die verblassten Buchstaben „Winkelhuber“ entziffern. Sie erinnern an die Bäckerei einer jüdischen Familie aus Wien.
Auch das „Café Atlantic“ hat schon seit Jahrzehnten geschlossen. Übrig geblieben ist der schwungvolle Schriftzug auf dem Holzverschlag über den eingestaubten Fensterreihen. Daneben steht „Imbissstube“ geschrieben. „Weiter vorne ist ein Kino“, erklärt Yang Xiao Jun. Auch heute werden dort noch Filme gezeigt und Karaoke-Shows. In der nächsten Straße fällt eine ganze Häuserreihe durch ihre hohen mehrsprossigen Fenster auf, die von roten Backsteinen eingefasst sind. Die halbkreisförmigen Oberlichter verraten ihre europäische Herkunft. Die drei- bis viergeschossigen Bauten gehören zu den wenigen europäisch wirkenden Überbleibseln im ehemaligen Ghetto, die auch in anderen älteren Vierteln Shanghais noch anzutreffen sind. Am Komfort hat sich nicht viel geändert: Im ehemaligen „Klein-Berlin“ oder „Klein-Wien“, wie das Ghetto damals auch genannt wurde, teilen sich immer noch mehrere Familien ein Bad. Oft wird noch auf dem Bürgersteig gekocht. Von den Fenstern der oberen Stockwerke ragen lange Stangen zur Straßemitte hin, auf denen von allen Seiten Wäschestücke zum Trocknen aufgereiht sind. Dazwischen baumeln Vogel- und Grillenkäfige.
Viele Besucher aus Israel und den USA
Das schwüle Klima der Küstenstadt verlangt viel Geduld von den Bewohnern und ihrem Bedürfnis nach Sauberkeit und Hygiene. Der Smog über der „Stadt hin zum Meer“, wie sie wörtlich übersetzt heißt, lässt die Sonne nur selten durch. Der Weg führt weiter in die Chang Yang Road, eine breitere Geschäftsstraße, wie es unzählige gibt in der Stadt. Vor 64 Jahren bildete sie die zentral verlaufende Längsachse durch das Ghetto. Hier befand sich früher das Wiener Café „Delikat“, gegenüber eine Apotheke, etwas weiter entfernt ein Krankenhaus. Auf der anderen Straßenseite befindet sich immer noch unauffällig zwischen den Wohnhäusern eingereiht ein Gefängnis.
Doch der Höhepunkt steht noch aus: Wäre da nicht die kleine Messingtafel an der Hausmauer angebracht, die auf die ehemalige Ohel Moishe-Synagoge im Hinterhof aufmerksam macht, würde der Besucher womöglich achtlos vorübergehen. Das denkmalgeschütztes Gebäude mit der Hausnummer 62 dient seit seiner Restaurierung Anfang der 90er Jahre als bescheidenes jüdisches Museum. „Jüdische Gemeinden aus aller Welt haben sich an der Finanzierung beteiligt. Die alte Synagoge wird von vielen Juden aus den USA und Israel besucht“, erklärt Yang Xiao Jun. Im zweiten Stock erinnert eine Fotosammlung an die Flüchtlinge. Zu den Bekanntesten zählen Michael Blumenthal, der von 1977 bis 1979 amerikanischer Finanzminister war und seit 1999 das jüdische Museum in Berlin leitet, und David Ludwig Bloch, ein gehörloser Künstler, der während der neun Jahre in Shanghai (1940 bis 1949) über 300 Holzschnitte mit chinesischen Alltagsmotiven anfertigte. Aber nicht nur deren Geschichte ist dokumentiert.
Abgeschottet von der chinesischen Bevölkerung bauten sich die „Bagdad-Juden“ eine eigene Infrastruktur auf und errichteten zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts mehrere Synagogen in der Stadt. Die Ohel Moishe-Synagoge geht auf eine Gruppe aschkenasischer Juden zurück, die in den Wirren der Oktoberrevolution Russland aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen verließen.
Mit 6,5 Millionen Einwohnern zählte das Shanghai der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts bereits zu den Metropolen der Welt. Im Handelszentrum des fernen Ostens hatten sich längst alle international tätigen Firmen niedergelassen. Gleichzeitig wuchs die Armut in der überbevölkerten Stadt rasant an. Während viele Staaten nach und nach die Einreisebestimmungen für Flüchtlinge verschärften, blieben lange Zeit die Grenzen für das „Exil der kleinen Leute“ offen. Die ersten jüdischen Flüchtlinge kamen bereits vor der Pogromnacht von 1938 und konnten sich in Shanghai frei niederlassen. Besonders für jene Namenlosen, die sich keine Einreisegenehmigungen in einem anderen Land der Welt beschaffen konnten, stellte die Stadt im fernen Osten die einzige Zufluchtsmöglichkeit dar.
Die Besetzung der Küstenstadt durch Japan nach der gewonnen Häuserschlacht am 9. November 1937 spielte dabei anfangs keine Rolle. Ein Einreisevisum war nicht erforderlich; vielmehr machten die deutschen Behörden die Ausreise aus dem Reichsgebiet davon abhängig, dass sie sich dafür alles Hab und Gut aneignen konnten. Nicht wenige verließen ihre Heimat nur mit den offiziell erlaubten fünf Reichsmark und zwei Koffern. Jüdische und amerikanische Hilfsorganisationen vermittelten die vierwöchige Überfahrt von Italien und versorgten jene Flüchtlinge in Lagern, die sich nach ihrer Ankunft nicht selbst helfen konnten. Die Freiheit hatte ihren Preis: Die Flüchtlinge trafen nicht nur auf eine fremde Welt, sondern sahen sich mit einer von Armut, Kriminalität und Korruption geprägten Stadt konfrontiert, die bald daraufhin die Zufluchtswelle zu stoppen versuchte.
Von den US-Streitkräften bombardiert
Anders erging es Hongkou, als die US-Streitkräfte ab 1944 die Stadt bombardierten. Kurz vor Kriegsende verloren dadurch rund 40 Flüchtlinge ihr Leben, über 500 wurden verwundet und etliche mehr obdachlos, als im Juli die im Stadtteil gelegene Funkanlage der Japaner zur Zielscheibe erklärt wurde. Weitaus mehr Opfer verlangten die Angriffe unter der chinesischen Bevölkerung. Offiziell wurde das Ghetto am 3. September 1945 befreit. Angst vor neuen Repressalien in einem China unter der kommunistischen Führung Mao Zedongs veranlasste auch die letzten unter ihnen, das Land 1949 zu verlassen.
Literatur:
Exil in China, Meine Zeit in Shanghai, in: Ammon Barzel / Jüdisches Museum (Hrsg.): Horst Eisfelder: Leben im Wartesaal
Film:
Exil Shangai, ein Film von Ulrike Ottinger, Deutschland / Israel 1997, 16mm Farbe, 275 Minuten, Verleih: Freunde der Deutschen Kinemathek e.V., Berlin
www.rickshaw.com

Gedenktafel im Huoshan-Park aus dem Jahr 1994
Foto: Manfred Giebenhain

Blick von oben auf Hongkou und die Skyline von Shanghai
Foto: Manfred Giebenhain

„Café Atlantic“ – schon seit Jahrzehnten geschlossen
Foto: Manfred Giebenhain

Die ehemalige Ohel Moishe-Synagoge – heute jüdisches Museum
Foto: Manfred Giebenhain

Mitten im modernen Shanghai – das „Exil der kleinen Leute“
Foto: Manfred Giebenhain

Straßenszene im alten Hongkew, heute Hongkou
Foto: Verlag Hentrich & Hentrich, Teetz

Postkarte von Shanghai nach Dresden aus dem Jahr 1937
Foto: Privatbesitz Giebenhain
Online-Flyer Nr. 96 vom 23.05.2007
Druckversion