SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Literatur
Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Kapitel V
"Niemandsland"
von Wolfgang Bittner
Was uns heute wichtig erscheint, ist morgen oft schon belanglos. Dennoch fordert es heute unsere Aufmerksamkeit und verbraucht unsere Lebenskraft, und es ist schwer, sich dem Druck dieser Alltäglichkeiten zu entziehen, die uns den Blick zum Horizont verstellen. Die Belanglosigkeiten blähen sich auf, beschäftigen uns, und abends sind wir müde und wissen nicht wovon.
Gestern ging das Auto kaputt, die Nockenwelle. Der Kraftfahrzeugmeister in der Werkstatt sagte, das komme bei unserem Modell öfter vor, zumeist schon nach dreißigtausend Kilometern. Auch die Ventilschäfte müssen erneuert werden, außerdem ein Stoßdämpfer und der Auspufftopf. Eine Reparatur von über zweitausend Mark. Und heute blieb die Waschmaschine stehen. Sie ist zehn Jahre alt, eine Reparatur lohnt nicht mehr. Das kostet noch einmal tausend Mark. Bald kommt der Dachdecker, denn es regnet durch. Ein neues Kinderbett muß gekauft werden, ein Kleiderschrank. Ein Paar Sommerschuhe, ein Paar Sandalen, eine Schultasche. Julia wird im Herbst eingeschult, Felix soll ein Kettcar bekommen. Auch die Zinsabtragungen für das Haus haben sich wieder erhöht, zum zweitenmal innerhalb von drei Jahren. Manchmal frage ich mich, wie Familien, denen nur halb so viel Geld zur Verfügung steht wie uns, überhaupt durchkommen. Das ganze Leben ist ein Geldproblem.
Ruth sagt: »Uns geht´s doch verhältnismäßig gut. Warum machst du dir andauernd Sorgen?« Aber ich weiß noch immer nicht, ob der Lehrauftrag an der Universität verlängert wird. Einige Stellen sollen im nächsten Jahr eingespart werden, und ein Kollege ist bereits entlassen worden; er ist jetzt arbeitslos.
Ich fühle mich ausgelaugt, kann meine Gedanken nicht zusammenhalten, erst recht nicht voranbringen. Vormittags erledige ich die liegengebliebene Korrespondenz. Kein Brief darunter, über den man sich freuen könnte, jeder zweite zum Ärgern. Die Bank, das Grundsteueramt, die Fakultät, eine Zeitschriftenredaktion, der ich einen Aufsatz angeboten hatte, dessen Veröffentlichung verschoben wird.
In der Zeitung lese ich in der Leserbriefspalte Reaktionen auf einen Kommentar der vergangenen Woche. Ich kann mich erinnern, daß mir der Verfasser aus der Seele sprach, indem er die Nachrüstungsbeschlüsse als Aufrüstungsbeschlüsse bezeichnete. Der Leserbriefschreiber wünscht, daß eines Tages die Russen kommen, den Kommentator an die Wand stellen, seine Frau vergewaltigen und seine Kinder mit den Köpfen gegen die Wand schlagen. Die Russen, die Deutschen, die Gefahr aus dem Osten. Die Phantasie solcher Leute kennt keine Grenzen.
Nachmittags versuche ich an der Abhandlung weiterzuschreiben, die ich vor Wochen begonnen und dann beiseite gelegt hatte. Ich sitze drei Stunden hinter dem Schreibtisch, überlege, blättere in Sartres Philosophievorlesungen, lese, grübele und notiere Sätze, die ich wenig später wieder streiche. Was ist noch zu schreiben, was nicht schon geschrieben wurde? Und warum etwas schreiben? Kommt es darauf überhaupt an?
Ein Nachbar ruft an und beschwert sich darüber, daß unsere Kinder an seinem Zaun Blumen abgepflückt haben. Alles spult ab, wie in einem Film, den man schon mehrfach gesehen hat. Zum Beispiel »High noon«. Gleich öffnet sich die Tür des Saloons, der Gegner tritt auf die Straße, erkennt mich und zieht seinen Colt. Ich springe hinter die Hausecke, ein Querschläger zischt jaulend an meinem Ohr vorbei. Nochmal Glück gehabt.
Gegen Abend kommt Gerold. Er bringt den Bildband über Mexiko zurück, den er sich ausgeliehen hatte, und berichtet von einer spontanen Protestkundgebung auf dem Rathausplatz. Ein Student sei am Vormittag zu zweieinhalb Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden, angeblich habe er bei einer Demonstration mit einem Stein auf Polizisten geworfen. Die Beweislage sei absolut undurchsichtig gewesen, deshalb habe der Staatsanwalt auf Freispruch plädiert. »Stell dir vor«, sagt Gerold, »zweieinhalb Jahre: das ist ohne Bewährung. Wie kann ein Gericht unter solchen Voraussetzungen zu einem derartigen Urteil kommen?« Er war früher Anwalt. Er schüttelt den Kopf.
Am nächsten Tag steht es in der Zeitung. Vor dem alten Rathaus war es in der Silvesternacht zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Kaputte Schaufensterscheiben, zahlreiche Verletzte, ein Polizist hatte durch einen Steinwurf mehrere Zähne verloren. Die Polizei setzte einzelnen Gruppen von Demonstranten hinterher und nahm am Rande der Innenstadt etwa vierzig junge Leute fest. Unter ihnen befand sich ein siebenundzwanzigjähriger Psychologiestudent, der angeklagt wurde. Ihn nahm man sich vor. Aber die Zeugen der Anklage, mehrere Polizeibeamte, widersprachen sich in wesentlichen Punkten; in anderen gab es verblüffende Übereinstimmungen, die auf Absprachen schließen lassen. Außerdem hatte der angeklagte Student vier Entlastungszeugen, aber denen wurde vom Gericht kein Glauben geschenkt. Aussagen von Polizeibeamten seien allemal glaubwürdiger als Aussagen von Studenten, noch dazu von Demonstranten. Der Angeklagte habe sich nicht in ausreichendem Maße von der Hausbesetzerszene distanziert, so daß ihm die Tat durchaus zuzutrauen sei. Gespenstisch, so etwas.
Ein anderer Student - so lese ich - sei zu einem halben Jahr Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er an eine Hauswand die Worte geschrieben hatte: »Friede den Hütten, Krieg den Palästen!« Angeblich gibt es bei uns keine politische Justiz, erst recht keine Gesinnungsjustiz.
Abends gehe ich zu einem Vortrag über neue Medien und Verkabelung ins Gewerkschaftshaus. Der Referent spricht davon, daß überall die Fernsehapparate an ein neu zu verlegendes Netz von Kabeln angeschlossen werden sollen: zuerst Breitbandkabel aus Kupfer, später dann Glasfaserbreitbandkabel. Dadurch soll in Zukunft eine Rückkoppelung möglich sein, so daß man beispielsweise seinen Kontostand per Bildschirmtext abrufen kann. Freilich benötigt man dazu einen Hausanschluß, ein Zusatzgerät für den Fernseher und ein zweites Telefon. Die Behörden, Banken, Firmen und so weiter benötigen neue Computer und Geräte. Statt im Telefonbuch oder Lexikon oder Katalog nachzuschlagen, werden wir bald unsere Informationsbedürfnisse per Telefon, Fernseher und Computer befriedigen können. Und müssen. Wir geben einen Code ein, und schon haben wir auf dem Bildschirm, was wir wissen wollen.
Der Referent schließt nicht aus, daß es zu Mißbräuchen kommen könnte. »Wenn sämtliche Computer zusammengeschaltet würden, wüßte der Abrufende alles über uns: Verdienst, Familienstand, Krankheiten, Höhe der monatlichen Belastungen, Ausfallzeiten im Betrieb, Vorstrafen; alles, was speicherbar ist.« Er meint, wir alle würden von dieser Art Technik überrollt, dagegen könne man sich kaum noch wehren, plötzlich sei alles schon gelaufen. Die Gewerkschaft müsse dafür Sorge tragen, daß nicht zuviele Arbeitsplätze vernichtet werden.
»Und wenn ich mich nicht anschließen lassen will?« fragt einer. »Wir wissen doch, wie das mit den Bankgebühren und Parkgebühren und Anliegerbeiträgen und Benzinpreisen und Gas und Stromtarifen gewesen ist. Auf einmal kostet Gas doppelt soviel, und für das Parken zahlen wir jetzt statt zehn Pfennig fünf Mark. Und nachdem alle ihr Konto hatten und bargeldlos zahlten, wurden von den Banken Grundgebühren und Scheckgebühren und Postengebühren und Bearbeitungsgebühren eingeführt.«
Ein Achselzucken. Vielleicht gibt es in einigen Jahren einen Computer Anschluß und Benutzungszwang wie bei Wasser oder Kanalisation. Alles ist möglich, nichts ist mehr unmöglich. Wir werden verkabelt und vernetzt; bald brauchen wir nur noch den Fernseher oder Computer anzuschalten und auf den Bildschirm zu schauen, um zu kommunizieren. Wer von uns weiß denn über diese Vorgänge überhaupt noch Bescheid, wer blickt da noch durch? Und wen kümmert das? Aber wir werden alles bezahlen und wir werden es ausbaden müssen.
Am nächsten Tag steckt ein Schreiben des Zivilschutzamtes der Stadt im Briefkasten. »Ich wußte gar nicht, daß es so etwas gibt«, sagt Ruth. Ich auch nicht. Den »lieben Mitbürgern« wird mitgeteilt, daß sich die Verwaltung auf Grund der geographischen Lage der Stadt entschlossen habe, mehrere unterirdische Atomschutzbunker zu bauen. Denn bei einem Überraschungsangriff sei davon auszugehen, daß gegnerische Panzerverbände durch den Einsatz von Kurzstreckenraketen mit Atomsprengköpfen gestoppt würden. Da für die Bevölkerung jedoch nur insgesamt fünftausend Bunkerplätze bereitgestellt werden könnten, sehe man sich veranlaßt, eine Dringlichkeitsliste für deren Vergabe aufzustellen. Auf dem folgenden Abschnitt möge man Adresse, Beruf, Zahl der Kinder und so weiter ausfüllen. Der vom Haushaltsvorstand zu unterzeichnende Antrag lautet: »Ich bitte um bevorzugte Berücksichtigung bei der Vergabe von ... Bunkerplätzen.«
Wir diskutieren, auch mit einigen Nachbarn. »Die spinnen wohl! Aber was kann man denn machen?« Die Selbstachtung verbietet das Ausfüllen eines solchen Coupons, aber der Egoismus fordert es. Wer möchte schon einem sogenannten Atomschlag zum Opfer fallen? Man sei, so denkt man, im Betrieb, in der Familie, im Verband oder Verein unersetzlich. Schließlich die Kinder! Wer will schon gerne sterben? Wut, Empörung, Schicksalsergebenheit, Niedergeschlagenheit. Sind wir schon wieder so weit? Ist alles, was war, schon wieder vergessen? Und was nützen Bunker bei einem Atomkrieg? Muß man sich denn so etwas bieten lassen? Ja, darf man so etwas einfach hinnehmen? Auch Skepsis, Zweifel. Kann denn das ernst gemeint sein?
Am folgenden Tag stellt sich dann heraus: Alles nur Satire. Aber was für eine. Politrabauken hätten sich des Briefkopfes der Stadtverwaltung bedient, so heißt es in der Zeitung, und trieben mit Entsetzen Scherz. Natürlich sollen die Täter ermittelt werden, die Kriminalpolizei sei bereits eingeschaltet. Sie wird die Sache schon regeln, wie man hierzulande alles regelt.
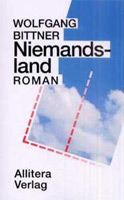
Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München
Der Autor
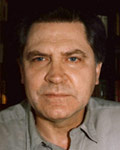 Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Online-Flyer Nr. 53 vom 18.07.2006
Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Kapitel V
"Niemandsland"
von Wolfgang Bittner
Was uns heute wichtig erscheint, ist morgen oft schon belanglos. Dennoch fordert es heute unsere Aufmerksamkeit und verbraucht unsere Lebenskraft, und es ist schwer, sich dem Druck dieser Alltäglichkeiten zu entziehen, die uns den Blick zum Horizont verstellen. Die Belanglosigkeiten blähen sich auf, beschäftigen uns, und abends sind wir müde und wissen nicht wovon.
Gestern ging das Auto kaputt, die Nockenwelle. Der Kraftfahrzeugmeister in der Werkstatt sagte, das komme bei unserem Modell öfter vor, zumeist schon nach dreißigtausend Kilometern. Auch die Ventilschäfte müssen erneuert werden, außerdem ein Stoßdämpfer und der Auspufftopf. Eine Reparatur von über zweitausend Mark. Und heute blieb die Waschmaschine stehen. Sie ist zehn Jahre alt, eine Reparatur lohnt nicht mehr. Das kostet noch einmal tausend Mark. Bald kommt der Dachdecker, denn es regnet durch. Ein neues Kinderbett muß gekauft werden, ein Kleiderschrank. Ein Paar Sommerschuhe, ein Paar Sandalen, eine Schultasche. Julia wird im Herbst eingeschult, Felix soll ein Kettcar bekommen. Auch die Zinsabtragungen für das Haus haben sich wieder erhöht, zum zweitenmal innerhalb von drei Jahren. Manchmal frage ich mich, wie Familien, denen nur halb so viel Geld zur Verfügung steht wie uns, überhaupt durchkommen. Das ganze Leben ist ein Geldproblem.
Ruth sagt: »Uns geht´s doch verhältnismäßig gut. Warum machst du dir andauernd Sorgen?« Aber ich weiß noch immer nicht, ob der Lehrauftrag an der Universität verlängert wird. Einige Stellen sollen im nächsten Jahr eingespart werden, und ein Kollege ist bereits entlassen worden; er ist jetzt arbeitslos.
Ich fühle mich ausgelaugt, kann meine Gedanken nicht zusammenhalten, erst recht nicht voranbringen. Vormittags erledige ich die liegengebliebene Korrespondenz. Kein Brief darunter, über den man sich freuen könnte, jeder zweite zum Ärgern. Die Bank, das Grundsteueramt, die Fakultät, eine Zeitschriftenredaktion, der ich einen Aufsatz angeboten hatte, dessen Veröffentlichung verschoben wird.
In der Zeitung lese ich in der Leserbriefspalte Reaktionen auf einen Kommentar der vergangenen Woche. Ich kann mich erinnern, daß mir der Verfasser aus der Seele sprach, indem er die Nachrüstungsbeschlüsse als Aufrüstungsbeschlüsse bezeichnete. Der Leserbriefschreiber wünscht, daß eines Tages die Russen kommen, den Kommentator an die Wand stellen, seine Frau vergewaltigen und seine Kinder mit den Köpfen gegen die Wand schlagen. Die Russen, die Deutschen, die Gefahr aus dem Osten. Die Phantasie solcher Leute kennt keine Grenzen.
Nachmittags versuche ich an der Abhandlung weiterzuschreiben, die ich vor Wochen begonnen und dann beiseite gelegt hatte. Ich sitze drei Stunden hinter dem Schreibtisch, überlege, blättere in Sartres Philosophievorlesungen, lese, grübele und notiere Sätze, die ich wenig später wieder streiche. Was ist noch zu schreiben, was nicht schon geschrieben wurde? Und warum etwas schreiben? Kommt es darauf überhaupt an?
Ein Nachbar ruft an und beschwert sich darüber, daß unsere Kinder an seinem Zaun Blumen abgepflückt haben. Alles spult ab, wie in einem Film, den man schon mehrfach gesehen hat. Zum Beispiel »High noon«. Gleich öffnet sich die Tür des Saloons, der Gegner tritt auf die Straße, erkennt mich und zieht seinen Colt. Ich springe hinter die Hausecke, ein Querschläger zischt jaulend an meinem Ohr vorbei. Nochmal Glück gehabt.
Gegen Abend kommt Gerold. Er bringt den Bildband über Mexiko zurück, den er sich ausgeliehen hatte, und berichtet von einer spontanen Protestkundgebung auf dem Rathausplatz. Ein Student sei am Vormittag zu zweieinhalb Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden, angeblich habe er bei einer Demonstration mit einem Stein auf Polizisten geworfen. Die Beweislage sei absolut undurchsichtig gewesen, deshalb habe der Staatsanwalt auf Freispruch plädiert. »Stell dir vor«, sagt Gerold, »zweieinhalb Jahre: das ist ohne Bewährung. Wie kann ein Gericht unter solchen Voraussetzungen zu einem derartigen Urteil kommen?« Er war früher Anwalt. Er schüttelt den Kopf.
Am nächsten Tag steht es in der Zeitung. Vor dem alten Rathaus war es in der Silvesternacht zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Kaputte Schaufensterscheiben, zahlreiche Verletzte, ein Polizist hatte durch einen Steinwurf mehrere Zähne verloren. Die Polizei setzte einzelnen Gruppen von Demonstranten hinterher und nahm am Rande der Innenstadt etwa vierzig junge Leute fest. Unter ihnen befand sich ein siebenundzwanzigjähriger Psychologiestudent, der angeklagt wurde. Ihn nahm man sich vor. Aber die Zeugen der Anklage, mehrere Polizeibeamte, widersprachen sich in wesentlichen Punkten; in anderen gab es verblüffende Übereinstimmungen, die auf Absprachen schließen lassen. Außerdem hatte der angeklagte Student vier Entlastungszeugen, aber denen wurde vom Gericht kein Glauben geschenkt. Aussagen von Polizeibeamten seien allemal glaubwürdiger als Aussagen von Studenten, noch dazu von Demonstranten. Der Angeklagte habe sich nicht in ausreichendem Maße von der Hausbesetzerszene distanziert, so daß ihm die Tat durchaus zuzutrauen sei. Gespenstisch, so etwas.
Ein anderer Student - so lese ich - sei zu einem halben Jahr Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er an eine Hauswand die Worte geschrieben hatte: »Friede den Hütten, Krieg den Palästen!« Angeblich gibt es bei uns keine politische Justiz, erst recht keine Gesinnungsjustiz.
Abends gehe ich zu einem Vortrag über neue Medien und Verkabelung ins Gewerkschaftshaus. Der Referent spricht davon, daß überall die Fernsehapparate an ein neu zu verlegendes Netz von Kabeln angeschlossen werden sollen: zuerst Breitbandkabel aus Kupfer, später dann Glasfaserbreitbandkabel. Dadurch soll in Zukunft eine Rückkoppelung möglich sein, so daß man beispielsweise seinen Kontostand per Bildschirmtext abrufen kann. Freilich benötigt man dazu einen Hausanschluß, ein Zusatzgerät für den Fernseher und ein zweites Telefon. Die Behörden, Banken, Firmen und so weiter benötigen neue Computer und Geräte. Statt im Telefonbuch oder Lexikon oder Katalog nachzuschlagen, werden wir bald unsere Informationsbedürfnisse per Telefon, Fernseher und Computer befriedigen können. Und müssen. Wir geben einen Code ein, und schon haben wir auf dem Bildschirm, was wir wissen wollen.
Der Referent schließt nicht aus, daß es zu Mißbräuchen kommen könnte. »Wenn sämtliche Computer zusammengeschaltet würden, wüßte der Abrufende alles über uns: Verdienst, Familienstand, Krankheiten, Höhe der monatlichen Belastungen, Ausfallzeiten im Betrieb, Vorstrafen; alles, was speicherbar ist.« Er meint, wir alle würden von dieser Art Technik überrollt, dagegen könne man sich kaum noch wehren, plötzlich sei alles schon gelaufen. Die Gewerkschaft müsse dafür Sorge tragen, daß nicht zuviele Arbeitsplätze vernichtet werden.
»Und wenn ich mich nicht anschließen lassen will?« fragt einer. »Wir wissen doch, wie das mit den Bankgebühren und Parkgebühren und Anliegerbeiträgen und Benzinpreisen und Gas und Stromtarifen gewesen ist. Auf einmal kostet Gas doppelt soviel, und für das Parken zahlen wir jetzt statt zehn Pfennig fünf Mark. Und nachdem alle ihr Konto hatten und bargeldlos zahlten, wurden von den Banken Grundgebühren und Scheckgebühren und Postengebühren und Bearbeitungsgebühren eingeführt.«
Ein Achselzucken. Vielleicht gibt es in einigen Jahren einen Computer Anschluß und Benutzungszwang wie bei Wasser oder Kanalisation. Alles ist möglich, nichts ist mehr unmöglich. Wir werden verkabelt und vernetzt; bald brauchen wir nur noch den Fernseher oder Computer anzuschalten und auf den Bildschirm zu schauen, um zu kommunizieren. Wer von uns weiß denn über diese Vorgänge überhaupt noch Bescheid, wer blickt da noch durch? Und wen kümmert das? Aber wir werden alles bezahlen und wir werden es ausbaden müssen.
Am nächsten Tag steckt ein Schreiben des Zivilschutzamtes der Stadt im Briefkasten. »Ich wußte gar nicht, daß es so etwas gibt«, sagt Ruth. Ich auch nicht. Den »lieben Mitbürgern« wird mitgeteilt, daß sich die Verwaltung auf Grund der geographischen Lage der Stadt entschlossen habe, mehrere unterirdische Atomschutzbunker zu bauen. Denn bei einem Überraschungsangriff sei davon auszugehen, daß gegnerische Panzerverbände durch den Einsatz von Kurzstreckenraketen mit Atomsprengköpfen gestoppt würden. Da für die Bevölkerung jedoch nur insgesamt fünftausend Bunkerplätze bereitgestellt werden könnten, sehe man sich veranlaßt, eine Dringlichkeitsliste für deren Vergabe aufzustellen. Auf dem folgenden Abschnitt möge man Adresse, Beruf, Zahl der Kinder und so weiter ausfüllen. Der vom Haushaltsvorstand zu unterzeichnende Antrag lautet: »Ich bitte um bevorzugte Berücksichtigung bei der Vergabe von ... Bunkerplätzen.«
Wir diskutieren, auch mit einigen Nachbarn. »Die spinnen wohl! Aber was kann man denn machen?« Die Selbstachtung verbietet das Ausfüllen eines solchen Coupons, aber der Egoismus fordert es. Wer möchte schon einem sogenannten Atomschlag zum Opfer fallen? Man sei, so denkt man, im Betrieb, in der Familie, im Verband oder Verein unersetzlich. Schließlich die Kinder! Wer will schon gerne sterben? Wut, Empörung, Schicksalsergebenheit, Niedergeschlagenheit. Sind wir schon wieder so weit? Ist alles, was war, schon wieder vergessen? Und was nützen Bunker bei einem Atomkrieg? Muß man sich denn so etwas bieten lassen? Ja, darf man so etwas einfach hinnehmen? Auch Skepsis, Zweifel. Kann denn das ernst gemeint sein?
Am folgenden Tag stellt sich dann heraus: Alles nur Satire. Aber was für eine. Politrabauken hätten sich des Briefkopfes der Stadtverwaltung bedient, so heißt es in der Zeitung, und trieben mit Entsetzen Scherz. Natürlich sollen die Täter ermittelt werden, die Kriminalpolizei sei bereits eingeschaltet. Sie wird die Sache schon regeln, wie man hierzulande alles regelt.
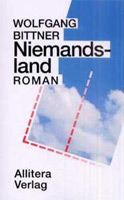
Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München
Der Autor
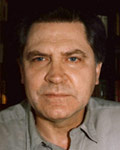 Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.Online-Flyer Nr. 53 vom 18.07.2006















