SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Literatur
Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Kapitel IV, 2. Teil
"Niemandsland"
Von Wolfgang Bittner
Meine Großeltern väterlicherseits hatten bei Osnabrück auf dem Lande eine Unterkunft gefunden, und einmal durfte ich sie in den Sommerferien allein besuchen. Noch auf dem Bahnsteig gab mir mein Vater gute Ermahnungen mit auf den Weg, die sich in Sätzen wie »Laß dich nicht bestehlen« oder »Sei Fremden gegenüber vorsichtig« erschöpften. Meine Mutter weinte beim Abschied. »Paß schön auf dich auf!« rief sie. »Und schreib bald eine Karte!« Sie winkte mit einem Taschentuch, bis ich sie aus den Augen verlor.
Eine Weltreise, so kam es mir vor. Die Zugfahrt dauerte ein paar Stunden, aber ich brauchte nicht umzusteigen. Der Großvater holte mich mit dem Fahrrad vom Bahnhof ab und nahm mich auf den Gepäckträger; meine Reisetasche hängte er an den Lenker. So ging es aus der Stadt hinaus. Die Gegend war hügelig, der Teutoburger Wald. Mir erschien er wie ein gewaltiges Gebirge, vor allem wo es steil bergauf ging und wir das Fahrrad schieben mußten. Großen Eindruck machte es auf mich, wenn wir von einem Berg wie in einen großen Garten hinabsahen auf die leuchtend gelben Rapsfelder, grünen Wiesen, braunen Äcker, hellgelben Kornfelder, zwischen denen sich Straßen, Wege und Bäche hinschlängelten, begleitet vom Laub der Bäume.
Mein Großvater war ein ernster Mann, der viel von früher,
von »Zuhause«, von »drüben« erzählte, sich jedoch häufig wieder-
holte. Mehrmals hörte ich die Geschichte, wie er als junger Lehrer
lange vor dem ersten Weltkrieg im schlesisch-polnischen Grenz-
gebiet eine Stelle auf dem Dorf angetreten und welche Schwierigkeiten
er dort gehabt hatte. »Das können sich diese jungen Lehrer, die
heutzutage eine Hochschule besucht haben, gar nicht vorstellen«,
sagte er. »Die Kinder waren zu mehreren Klassen zusammengefaßt
und konnten zum Teil nur Polnisch sprechen, was ich nicht ver-
stand. Die Eltern ließen sie nur widerwillig zur Schule, weil ihnen die
Arbeitskraft zu Hause und auf dem Feld fehlte. In vier Jahren soll-
ten sie Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt haben, aber ich mußte
ihnen zuerst die deutsche Sprache beibringen.« Dafür erhielt er
ein monatliches Gehalt von sechsundsechzig Reichsmark und
zwei Drittel Reichspfennigen - zum Leben zuwenig, zum Sterben zu-
viel.
Sooft ich zu Besuch kam, fragte er zuallererst: »Nun, wie war die
Reise?« Er lehnte sich zurück und blickte mich erwartungsvoll an.
»Ach, ganz gut«, gab ich zur Antwort. »So meine ich das nicht«, sagte
er, »ich will das genauer wissen. Du bist also losgefahren ...« Er war-
tete, und ich mußte der Reihe nach genauestens berichten; keine
Einzelheit durfte ausgelassen werden.
Meine Großmutter machte einen zerbrechlichen Eindruck, aber sie steckte voller Tatkraft und war den ganzen Tag auf den Beinen. Wo sie sich aufhielt, war Leben, und wenn sie mich mit ihren hellen beweglichen Augen anblickte, spürte ich ihre Nähe zu mir und fühlte mich geborgen. Sie kochte mit wenig Mitteln sehr gut und kannte sämtliche eßbaren Pilze, auch Beeren und Kräuter.
Frühmorgens gingen wir in den Wald und sammelten in drei, vier Stunden einen ganzen Korb voll Pfifferlinge, Steinpilze, Maronen, Rotkappen, Birkenpilze, Sandröhrlinge; manchmal fanden wir Baumstümpfe übersät mit Hallimasch oder Stockschwämmchen, hier und da auch ganz ausgefallene Sorten wie Krause Glucke oder Ochsenzungen. »Du hast
gute Augen«, sagte die Großmutter, »am besten, du wirst Jäger.« Wir schnitten die Pilze sauber ab, damit ihr Myzel nicht beschädigt wurde und sie sich weitervermehren konnten. »Warum Jäger?« fragte ich. »Nun, dann kannst du den ganzen Tag im Wald sein und hast immer zu essen«, gab sie zur Antwort. Das fand ich einleuchtend. Wir suchten auch Beeren und Holz, Reisig und Tannenzapfen zum Feuern. Mittags brieten wir die Pilze und hatten ein köstliches Essen mit Nachtisch. Ich konnte alles von ihr bekommen, soweit das in ihrer Macht stand.
Einmal hatte sie mich vormittags zum Kaufmann ins mehrere Kilometer entfernte Dorf geschickt. Als ich zurückkam, stand das Essen schon auf dem Tisch, es gab Mehlsuppe. Aber sie war nicht süß, wie ich sie gerne mochte, sondern mit Salz und Zwiebeln. Ich war enttäuscht und erklärte, daß ich diese Mehlsuppen eine Zeitlang viel zu oft vorgesetzt bekommen hatte, um sie noch mit Appetit essen zu können. »Ich glaube, ich bekomme sie gar nicht herunter«, sagte ich mit etwas übertriebener Gefühlsbewegung. Meine Großmutter schüttete fast eine Tüte Zucker in den Topf, obwohl der Großvater fürchterlich schimpfte. Trotz der etwas störenden Zwiebeln aß ich zwei volle Teller mit großem Wohlbehagen.
Die Großeltern lebten von der Vertriebenenhilfe. Eine Pension oder Rente erhielten sie damals noch nicht, denn der Großvater war während der Nazizeit aus politischen Gründen entlassen worden. Das Haus, eine frühere Kleinbauernstelle, war uralt, der Bretterfußboden in der Waschküche verrottet, so daß ich Angst hatte, hindurchzufallen. Dort stand unter der Pumpe eine alte, verrostete Schüssel, in der man sich waschen konnte. Geheizt und gekocht wurde mit dem gesammelten Holz, manchmal auch gebacken. Der riesige Bauernherd hatte an der Seite ein Wasserschiff, in dem sich, sobald das Feuer brannte, Wasser für den Hausgebrauch erwärmte. Sogar richtige Federbetten gab es, und in den Träumen besuchte mich der gutmütige Rübezahl aus den Erzählungen des Großvaters.
In der Schule kam ich gut mit. Ich bemühte mich, nicht aufzufallen. Die Deutschlehrerin war ein älteres Fräulein, sie hatte Haare auf den Zäh-
nen, und der Geschichtslehrer war ein ehemaliger Kapitänleutnant. Während die Deutschlehrerin viel von ihrem Vater erzählte, den sie »Vati«
nannte, berichtete der Geschichtslehrer von Feindfahrten auf einem Zerstörer im nördlichen Eismeer und von der Kameradschaft auf See. Manchmal ließ er uns eine Stunde lang aus dem Geschichtsbuch vorlesen und angeblich wichtige Sätze mit unterschiedlichen Farben unterstreichen. Wenn er Jahreszahlen abfragte, zog ich heimlich ein Blatt aus der Tasche, auf dem ich mir die wichtigsten Daten in chronologischer Reihenfolge notiert hatte; diese verblüffenden Kenntnisse wurden gebührend ausgezeichnet.
Im Biologieunterricht zogen wir oft in Dreierreihen mit geschultertem Spaten zum Schulgarten vor der Stadt, um Bäume und Sträucher zu pflanzen. Auf dem Rückweg sangen wir: »Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, SA marschiert mit ruhig festem Schritt ...« oder »Schwer mit den Schätzen des Orients beladen«. Marschierten wir im Gleichschritt auf dem Schulhof ein, versammelte sich das Kollegium am Fenster des Lehrerzimmers und sah zu, wie der Musiklehrer, ein ehemaliger Hauptmann, die Front abschritt - natürlich nur zum Spaß.
Die Einstellung meines Vaters als Angestellter bei einer Behörde feierten wir im Frühjahr 1952 mit Kartoffelsalat und Würstchen. Jetzt begann es uns etwas besser zu gehen. Meine Mutter konnte sich einen Mantel kaufen, mein Vater ein weißes Hemd und eine neue Krawatte, ich bekam ein Paar feste Halbschuhe. Bis zum sechsten Lebensjahr war ich im Sommer sowieso barfuß gelaufen; im Winter hatte ich zumeist Holzpantinen getragen, die mit Stroh ausgestopft wurden. Waren Schuhe zu klein geworden, wurden sie aufgeschnitten und in Sandalen verwandelt.
Am Verhalten meiner Eltern und an den Reaktionen der Nachbarn merkte ich, daß sich etwas verändert hatte: Wir waren aufgerückt, wenn nicht sogar schon Privilegierte. Wer konnte das wissen; vielleicht war man von so einem, der jetzt bei der Behörde arbeitete, einmal abhängig. Wer hinter einem Schreibtisch saß, ein weißes Hemd und einen Schlips trug, war nicht mehr irgendwer. Und wenn er nur Zahlen in eine Liste eintrug oder Akten registrierte.
Damals lernte ich Menschen kennen, die man Originale nennen konnte; den alten Behrens zum Beispiel, der mit seiner Stummelpfeife zwischen den Zähnen neben seinem Haus in der Mühlenstraße auf der Bank saß. Er war Sozialdemokrat gewesen und es geblieben. Mehrere Jahre lief er vergeblich Sturm gegen die Wiedereinstellung eines Altnazis in den öffentlichen Dienst. Der Mann hieß Apken. Vor 1945 hatte er eine höhere Position in der örtlichen SA gehabt; nach Kriegsende, das allgemein als Zusammenbruch, Kapitulation oder Niederlage bezeichnet wurde, war Apken zunächst arbeitslos. Wenn Behrens ihm auf der Straße begegnete, spuckte er aus. »Der hat mich früher angespuckt«, sagte er, »ich spucke nur vor ihm aus.«
Allerdings war das nicht ganz ungefährlich, weil Alte Kameraden bekanntlich zusammenhalten, solange sie sich noch Vorteile voneinander versprechen. Stadt und Landkreis waren eine Hochburg des Faschismus gewesen. Schon bei den letzten Reichstagswahlen im Jahre 1933 stimmten mehr als 70 Prozent der Wähler für die NSDAP, während die Stimmanteile im Landesdurchschnitt bei 44 Prozent lagen. Auch nach dem Krieg noch erreichten die neonazistische Deutsche Reichspartei und die später verbotene Sozialistische Reichspartei bei den Bundestagswahlen hohe Stimmanteile.
Im Grunde war alles beim alten geblieben, die wenigsten hatten ihre Ansichten geändert, geschweige denn dazugelernt. Wer den Krieg begonnen und andere Völker unterdrückt und mit Elend überzogen hatte, war vergessen worden. Kaum einer, der die militärische Niederlage Hitlerdeutschlands als Befreiung empfunden hätte; solche Menschen - sie hießen Volksschädlinge, Wehrkraftzersetzer, Vaterlandsverräter, Nestbeschmutzer - waren beizeiten eliminiert worden. Das hörte sich nicht weiter schlimm an, und wer sprach schon noch davon. Tatsächlich bedeutete das auch hier, wie überall: Sie waren gequält, verjagt, gefoltert, inhaftiert, erschlagen, aufgehängt, erschossen, vergast worden. Es gab sie kaum noch. Für die meisten anderen bedeutete das Kriegsende zuallererst eine Demütigung; bedingungslos war man in die Hand des Feindes gefallen. Ja, wäre die Wunderwaffe, von der Hitler bis zuletzt sprach, noch rechtzeitig fertig geworden, die Amis, Tommys und der Iwan hätten ihr blaues Wunder erlebt. Das wurde hinter vorgehaltener Hand oder auch offen gesagt.
Nach einigen Jahren fand man sich schließlich damit ab, auch in diesen mehr abgelegenen Regionen des ehemaligen Deutschen Reiches, und nicht wenige merkten, daß es ihnen immer besser zu gehen begann. Die Bauern besaßen nach wie vor ihre Höfe, die Handwerker ihre Werkstätten, die Kaufleute ihre Geschäfte, die SA Leute ihre Siedlungshäuser. Nur die Flüchtlinge besaßen anfangs gar nichts. Aber sie mußten essen, trinken, wohnen, sich kleiden. Die Bevölkerung hatte sich fast verdoppelt, es wurde auch viel gebaut. Auf diese Weise gelangte mancher Einheimische innerhalb weniger Nachkriegsjahre zu bescheidenem oder sogar beträchtlichem Wohlstand, den er sich vorher nie hätte träumen lassen.
Der Kaufmann Schoon vergrößerte sein Geschäft und stellte zwei Verkäuferinnen ein; der Maurermeister Janssen, der ein paar alte Maschinen von seinem Vater geerbt hatte, wurde Bauunternehmer; der Textilienhändler Willms errichtete einen Neubau; der Milchmann Cassens, der vorher mit einem Handkarren durch die Straßen gezogen war, wurde Ladenbesitzer; der Gärtner Agena, dessen Frau ein kleines Blumengeschäft besaß, wurde Gemüsehändler und gründete eine Gartenbaufirma; der Fuhrunternehmer Reents kaufte einen Sattelschlepper und besaß wenige Jahre später eine gutgehende Spedition. Es ging wieder voran, billige Arbeitskräfte gab es an jeder Straßenecke. Der Mensch muß ein Ziel haben. Wenn es schon nicht Amsterdam, Paris oder Moskau sein kann, dann wenigstens Wohlstand. Auch so kann man die Welt erobern.
Erst Mitte der fünfziger Jahre fand die Gerichtsverhandlung gegen Apken und zwei weitere Altnazis statt, den Leiter der Landkrankenkasse und einen Textilienhändler. Ihnen wurde vorgeworfen, die Synagoge abgebrannt sowie an der Deportation zahlreicher Juden mitgewirkt zu haben. Brückstraße, Klusforder Straße und Mühlenstraße waren von Juden bewohnt gewesen, die zumeist Geschäfte besaßen. Die Enteignung jüdischen Vermögens nannte man vor 1945 Arisierung; dafür hatte es in jeder Stadt fachkundige und begehrliche Arier gegeben, die Parteimitglieder waren. Nach dem Krieg gab es in der ganzen Stadt keinen einzigen Juden mehr, erst recht keinen Kommunisten.
Als Zeuge trat der Sohn eines früheren Kohlen und Saatguthändlers aus der Brückstraße auf. Seine Eltern und Geschwister waren vergast worden. Die Angeklagten versuchten, alle Schuld auf den NSDAP Ortsgruppenleiter abzuwälzen, der gefallen war. Als sie die Erfolglosigkeit ihres Vorhabens erkannten, einigten sie sich offenbar auf eine neue Taktik. Jetzt nahm Apken einen Teil der Schuld auf sich und entlastete dadurch die anderen beiden. Er bekam vier Jahre Zuchthaus, die er zum größten Teil in Celle verbüßte. Seine Frau konnte es ablehnen, Fürsorge in Anspruch zu nehmen. Für sie und ihre Kinder wurde von anderer Seite gesorgt. Anschließend erhielt Apken zuerst eine Anstellung beim Landkreis, wo er sich aus politischen Gründen jedoch nicht zu halten vermochte. Daraufhin kam er zur Stadtverwaltung als Sachbearbeiter für das Einwohnermeldewesen.
Doch was kümmerten mich damals solche Geschichten. Was ging mich das an. Ich brauchte ein Fahrrad, denn inzwischen verbrachte ich meine Nachmittage im mehrere Kilometer entfernten Wald, und die langen Fußmärsche waren anstrengend und hinderlich. In den großen Ferien ging ich, um Geld zu verdienen, zum Erbsenpflücken. Andere Arbeit fand ich nicht.
Der Bus, der uns zu Bauern aufs Feld brachte, fuhr morgens um sieben Uhr. Für den Zentner Schoten gab es drei Mark. Abends um sechs ging es zurück in die Stadt, und die meisten der Frauen und Kinder schliefen schon im Bus ein. Nach vier Wochen bei Regen und Sonnenschein besaß ich fünfundsechzig Mark. Das reichte bei weitem nicht; und auch das Schrottsammeln, das ich in den folgenden Monaten mit größter Hartnäckigkeit betrieb, erbrachte nur Pfennigbeträge.
Im Jahr darauf arbeitete ich in einer Wäscherei. Ich half beim Abholen und Ausliefern der Wäsche, an den Maschinen und vor allem an der Heißmangel. Der Sommer war brütend heiß und die Arbeit kaum erträglich. Oft wurde mir schlecht, und ich kämpfte mit Brechreiz, Kopfschmerzen und Ohnmachtsanfällen. Aber am Ende der großen Ferien hatte ich die Summe zusammen, die das Fahrrad mit Gangschaltung kostete. Das hieß, ein bißchen unabhängiger zu sein.
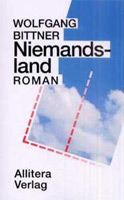
Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München
Der Autor
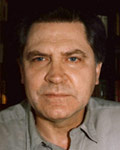 Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Online-Flyer Nr. 52 vom 12.07.2006
Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Kapitel IV, 2. Teil
"Niemandsland"
Von Wolfgang Bittner
Meine Großeltern väterlicherseits hatten bei Osnabrück auf dem Lande eine Unterkunft gefunden, und einmal durfte ich sie in den Sommerferien allein besuchen. Noch auf dem Bahnsteig gab mir mein Vater gute Ermahnungen mit auf den Weg, die sich in Sätzen wie »Laß dich nicht bestehlen« oder »Sei Fremden gegenüber vorsichtig« erschöpften. Meine Mutter weinte beim Abschied. »Paß schön auf dich auf!« rief sie. »Und schreib bald eine Karte!« Sie winkte mit einem Taschentuch, bis ich sie aus den Augen verlor.
Eine Weltreise, so kam es mir vor. Die Zugfahrt dauerte ein paar Stunden, aber ich brauchte nicht umzusteigen. Der Großvater holte mich mit dem Fahrrad vom Bahnhof ab und nahm mich auf den Gepäckträger; meine Reisetasche hängte er an den Lenker. So ging es aus der Stadt hinaus. Die Gegend war hügelig, der Teutoburger Wald. Mir erschien er wie ein gewaltiges Gebirge, vor allem wo es steil bergauf ging und wir das Fahrrad schieben mußten. Großen Eindruck machte es auf mich, wenn wir von einem Berg wie in einen großen Garten hinabsahen auf die leuchtend gelben Rapsfelder, grünen Wiesen, braunen Äcker, hellgelben Kornfelder, zwischen denen sich Straßen, Wege und Bäche hinschlängelten, begleitet vom Laub der Bäume.
Mein Großvater war ein ernster Mann, der viel von früher,
von »Zuhause«, von »drüben« erzählte, sich jedoch häufig wieder-
holte. Mehrmals hörte ich die Geschichte, wie er als junger Lehrer
lange vor dem ersten Weltkrieg im schlesisch-polnischen Grenz-
gebiet eine Stelle auf dem Dorf angetreten und welche Schwierigkeiten
er dort gehabt hatte. »Das können sich diese jungen Lehrer, die
heutzutage eine Hochschule besucht haben, gar nicht vorstellen«,
sagte er. »Die Kinder waren zu mehreren Klassen zusammengefaßt
und konnten zum Teil nur Polnisch sprechen, was ich nicht ver-
stand. Die Eltern ließen sie nur widerwillig zur Schule, weil ihnen die
Arbeitskraft zu Hause und auf dem Feld fehlte. In vier Jahren soll-
ten sie Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt haben, aber ich mußte
ihnen zuerst die deutsche Sprache beibringen.« Dafür erhielt er
ein monatliches Gehalt von sechsundsechzig Reichsmark und
zwei Drittel Reichspfennigen - zum Leben zuwenig, zum Sterben zu-
viel.
Sooft ich zu Besuch kam, fragte er zuallererst: »Nun, wie war die
Reise?« Er lehnte sich zurück und blickte mich erwartungsvoll an.
»Ach, ganz gut«, gab ich zur Antwort. »So meine ich das nicht«, sagte
er, »ich will das genauer wissen. Du bist also losgefahren ...« Er war-
tete, und ich mußte der Reihe nach genauestens berichten; keine
Einzelheit durfte ausgelassen werden.
Meine Großmutter machte einen zerbrechlichen Eindruck, aber sie steckte voller Tatkraft und war den ganzen Tag auf den Beinen. Wo sie sich aufhielt, war Leben, und wenn sie mich mit ihren hellen beweglichen Augen anblickte, spürte ich ihre Nähe zu mir und fühlte mich geborgen. Sie kochte mit wenig Mitteln sehr gut und kannte sämtliche eßbaren Pilze, auch Beeren und Kräuter.
Frühmorgens gingen wir in den Wald und sammelten in drei, vier Stunden einen ganzen Korb voll Pfifferlinge, Steinpilze, Maronen, Rotkappen, Birkenpilze, Sandröhrlinge; manchmal fanden wir Baumstümpfe übersät mit Hallimasch oder Stockschwämmchen, hier und da auch ganz ausgefallene Sorten wie Krause Glucke oder Ochsenzungen. »Du hast
gute Augen«, sagte die Großmutter, »am besten, du wirst Jäger.« Wir schnitten die Pilze sauber ab, damit ihr Myzel nicht beschädigt wurde und sie sich weitervermehren konnten. »Warum Jäger?« fragte ich. »Nun, dann kannst du den ganzen Tag im Wald sein und hast immer zu essen«, gab sie zur Antwort. Das fand ich einleuchtend. Wir suchten auch Beeren und Holz, Reisig und Tannenzapfen zum Feuern. Mittags brieten wir die Pilze und hatten ein köstliches Essen mit Nachtisch. Ich konnte alles von ihr bekommen, soweit das in ihrer Macht stand.
Einmal hatte sie mich vormittags zum Kaufmann ins mehrere Kilometer entfernte Dorf geschickt. Als ich zurückkam, stand das Essen schon auf dem Tisch, es gab Mehlsuppe. Aber sie war nicht süß, wie ich sie gerne mochte, sondern mit Salz und Zwiebeln. Ich war enttäuscht und erklärte, daß ich diese Mehlsuppen eine Zeitlang viel zu oft vorgesetzt bekommen hatte, um sie noch mit Appetit essen zu können. »Ich glaube, ich bekomme sie gar nicht herunter«, sagte ich mit etwas übertriebener Gefühlsbewegung. Meine Großmutter schüttete fast eine Tüte Zucker in den Topf, obwohl der Großvater fürchterlich schimpfte. Trotz der etwas störenden Zwiebeln aß ich zwei volle Teller mit großem Wohlbehagen.
Die Großeltern lebten von der Vertriebenenhilfe. Eine Pension oder Rente erhielten sie damals noch nicht, denn der Großvater war während der Nazizeit aus politischen Gründen entlassen worden. Das Haus, eine frühere Kleinbauernstelle, war uralt, der Bretterfußboden in der Waschküche verrottet, so daß ich Angst hatte, hindurchzufallen. Dort stand unter der Pumpe eine alte, verrostete Schüssel, in der man sich waschen konnte. Geheizt und gekocht wurde mit dem gesammelten Holz, manchmal auch gebacken. Der riesige Bauernherd hatte an der Seite ein Wasserschiff, in dem sich, sobald das Feuer brannte, Wasser für den Hausgebrauch erwärmte. Sogar richtige Federbetten gab es, und in den Träumen besuchte mich der gutmütige Rübezahl aus den Erzählungen des Großvaters.
In der Schule kam ich gut mit. Ich bemühte mich, nicht aufzufallen. Die Deutschlehrerin war ein älteres Fräulein, sie hatte Haare auf den Zäh-
nen, und der Geschichtslehrer war ein ehemaliger Kapitänleutnant. Während die Deutschlehrerin viel von ihrem Vater erzählte, den sie »Vati«
nannte, berichtete der Geschichtslehrer von Feindfahrten auf einem Zerstörer im nördlichen Eismeer und von der Kameradschaft auf See. Manchmal ließ er uns eine Stunde lang aus dem Geschichtsbuch vorlesen und angeblich wichtige Sätze mit unterschiedlichen Farben unterstreichen. Wenn er Jahreszahlen abfragte, zog ich heimlich ein Blatt aus der Tasche, auf dem ich mir die wichtigsten Daten in chronologischer Reihenfolge notiert hatte; diese verblüffenden Kenntnisse wurden gebührend ausgezeichnet.
Im Biologieunterricht zogen wir oft in Dreierreihen mit geschultertem Spaten zum Schulgarten vor der Stadt, um Bäume und Sträucher zu pflanzen. Auf dem Rückweg sangen wir: »Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, SA marschiert mit ruhig festem Schritt ...« oder »Schwer mit den Schätzen des Orients beladen«. Marschierten wir im Gleichschritt auf dem Schulhof ein, versammelte sich das Kollegium am Fenster des Lehrerzimmers und sah zu, wie der Musiklehrer, ein ehemaliger Hauptmann, die Front abschritt - natürlich nur zum Spaß.
Die Einstellung meines Vaters als Angestellter bei einer Behörde feierten wir im Frühjahr 1952 mit Kartoffelsalat und Würstchen. Jetzt begann es uns etwas besser zu gehen. Meine Mutter konnte sich einen Mantel kaufen, mein Vater ein weißes Hemd und eine neue Krawatte, ich bekam ein Paar feste Halbschuhe. Bis zum sechsten Lebensjahr war ich im Sommer sowieso barfuß gelaufen; im Winter hatte ich zumeist Holzpantinen getragen, die mit Stroh ausgestopft wurden. Waren Schuhe zu klein geworden, wurden sie aufgeschnitten und in Sandalen verwandelt.
Am Verhalten meiner Eltern und an den Reaktionen der Nachbarn merkte ich, daß sich etwas verändert hatte: Wir waren aufgerückt, wenn nicht sogar schon Privilegierte. Wer konnte das wissen; vielleicht war man von so einem, der jetzt bei der Behörde arbeitete, einmal abhängig. Wer hinter einem Schreibtisch saß, ein weißes Hemd und einen Schlips trug, war nicht mehr irgendwer. Und wenn er nur Zahlen in eine Liste eintrug oder Akten registrierte.
Damals lernte ich Menschen kennen, die man Originale nennen konnte; den alten Behrens zum Beispiel, der mit seiner Stummelpfeife zwischen den Zähnen neben seinem Haus in der Mühlenstraße auf der Bank saß. Er war Sozialdemokrat gewesen und es geblieben. Mehrere Jahre lief er vergeblich Sturm gegen die Wiedereinstellung eines Altnazis in den öffentlichen Dienst. Der Mann hieß Apken. Vor 1945 hatte er eine höhere Position in der örtlichen SA gehabt; nach Kriegsende, das allgemein als Zusammenbruch, Kapitulation oder Niederlage bezeichnet wurde, war Apken zunächst arbeitslos. Wenn Behrens ihm auf der Straße begegnete, spuckte er aus. »Der hat mich früher angespuckt«, sagte er, »ich spucke nur vor ihm aus.«
Allerdings war das nicht ganz ungefährlich, weil Alte Kameraden bekanntlich zusammenhalten, solange sie sich noch Vorteile voneinander versprechen. Stadt und Landkreis waren eine Hochburg des Faschismus gewesen. Schon bei den letzten Reichstagswahlen im Jahre 1933 stimmten mehr als 70 Prozent der Wähler für die NSDAP, während die Stimmanteile im Landesdurchschnitt bei 44 Prozent lagen. Auch nach dem Krieg noch erreichten die neonazistische Deutsche Reichspartei und die später verbotene Sozialistische Reichspartei bei den Bundestagswahlen hohe Stimmanteile.
Im Grunde war alles beim alten geblieben, die wenigsten hatten ihre Ansichten geändert, geschweige denn dazugelernt. Wer den Krieg begonnen und andere Völker unterdrückt und mit Elend überzogen hatte, war vergessen worden. Kaum einer, der die militärische Niederlage Hitlerdeutschlands als Befreiung empfunden hätte; solche Menschen - sie hießen Volksschädlinge, Wehrkraftzersetzer, Vaterlandsverräter, Nestbeschmutzer - waren beizeiten eliminiert worden. Das hörte sich nicht weiter schlimm an, und wer sprach schon noch davon. Tatsächlich bedeutete das auch hier, wie überall: Sie waren gequält, verjagt, gefoltert, inhaftiert, erschlagen, aufgehängt, erschossen, vergast worden. Es gab sie kaum noch. Für die meisten anderen bedeutete das Kriegsende zuallererst eine Demütigung; bedingungslos war man in die Hand des Feindes gefallen. Ja, wäre die Wunderwaffe, von der Hitler bis zuletzt sprach, noch rechtzeitig fertig geworden, die Amis, Tommys und der Iwan hätten ihr blaues Wunder erlebt. Das wurde hinter vorgehaltener Hand oder auch offen gesagt.
Nach einigen Jahren fand man sich schließlich damit ab, auch in diesen mehr abgelegenen Regionen des ehemaligen Deutschen Reiches, und nicht wenige merkten, daß es ihnen immer besser zu gehen begann. Die Bauern besaßen nach wie vor ihre Höfe, die Handwerker ihre Werkstätten, die Kaufleute ihre Geschäfte, die SA Leute ihre Siedlungshäuser. Nur die Flüchtlinge besaßen anfangs gar nichts. Aber sie mußten essen, trinken, wohnen, sich kleiden. Die Bevölkerung hatte sich fast verdoppelt, es wurde auch viel gebaut. Auf diese Weise gelangte mancher Einheimische innerhalb weniger Nachkriegsjahre zu bescheidenem oder sogar beträchtlichem Wohlstand, den er sich vorher nie hätte träumen lassen.
Der Kaufmann Schoon vergrößerte sein Geschäft und stellte zwei Verkäuferinnen ein; der Maurermeister Janssen, der ein paar alte Maschinen von seinem Vater geerbt hatte, wurde Bauunternehmer; der Textilienhändler Willms errichtete einen Neubau; der Milchmann Cassens, der vorher mit einem Handkarren durch die Straßen gezogen war, wurde Ladenbesitzer; der Gärtner Agena, dessen Frau ein kleines Blumengeschäft besaß, wurde Gemüsehändler und gründete eine Gartenbaufirma; der Fuhrunternehmer Reents kaufte einen Sattelschlepper und besaß wenige Jahre später eine gutgehende Spedition. Es ging wieder voran, billige Arbeitskräfte gab es an jeder Straßenecke. Der Mensch muß ein Ziel haben. Wenn es schon nicht Amsterdam, Paris oder Moskau sein kann, dann wenigstens Wohlstand. Auch so kann man die Welt erobern.
Erst Mitte der fünfziger Jahre fand die Gerichtsverhandlung gegen Apken und zwei weitere Altnazis statt, den Leiter der Landkrankenkasse und einen Textilienhändler. Ihnen wurde vorgeworfen, die Synagoge abgebrannt sowie an der Deportation zahlreicher Juden mitgewirkt zu haben. Brückstraße, Klusforder Straße und Mühlenstraße waren von Juden bewohnt gewesen, die zumeist Geschäfte besaßen. Die Enteignung jüdischen Vermögens nannte man vor 1945 Arisierung; dafür hatte es in jeder Stadt fachkundige und begehrliche Arier gegeben, die Parteimitglieder waren. Nach dem Krieg gab es in der ganzen Stadt keinen einzigen Juden mehr, erst recht keinen Kommunisten.
Als Zeuge trat der Sohn eines früheren Kohlen und Saatguthändlers aus der Brückstraße auf. Seine Eltern und Geschwister waren vergast worden. Die Angeklagten versuchten, alle Schuld auf den NSDAP Ortsgruppenleiter abzuwälzen, der gefallen war. Als sie die Erfolglosigkeit ihres Vorhabens erkannten, einigten sie sich offenbar auf eine neue Taktik. Jetzt nahm Apken einen Teil der Schuld auf sich und entlastete dadurch die anderen beiden. Er bekam vier Jahre Zuchthaus, die er zum größten Teil in Celle verbüßte. Seine Frau konnte es ablehnen, Fürsorge in Anspruch zu nehmen. Für sie und ihre Kinder wurde von anderer Seite gesorgt. Anschließend erhielt Apken zuerst eine Anstellung beim Landkreis, wo er sich aus politischen Gründen jedoch nicht zu halten vermochte. Daraufhin kam er zur Stadtverwaltung als Sachbearbeiter für das Einwohnermeldewesen.
Doch was kümmerten mich damals solche Geschichten. Was ging mich das an. Ich brauchte ein Fahrrad, denn inzwischen verbrachte ich meine Nachmittage im mehrere Kilometer entfernten Wald, und die langen Fußmärsche waren anstrengend und hinderlich. In den großen Ferien ging ich, um Geld zu verdienen, zum Erbsenpflücken. Andere Arbeit fand ich nicht.
Der Bus, der uns zu Bauern aufs Feld brachte, fuhr morgens um sieben Uhr. Für den Zentner Schoten gab es drei Mark. Abends um sechs ging es zurück in die Stadt, und die meisten der Frauen und Kinder schliefen schon im Bus ein. Nach vier Wochen bei Regen und Sonnenschein besaß ich fünfundsechzig Mark. Das reichte bei weitem nicht; und auch das Schrottsammeln, das ich in den folgenden Monaten mit größter Hartnäckigkeit betrieb, erbrachte nur Pfennigbeträge.
Im Jahr darauf arbeitete ich in einer Wäscherei. Ich half beim Abholen und Ausliefern der Wäsche, an den Maschinen und vor allem an der Heißmangel. Der Sommer war brütend heiß und die Arbeit kaum erträglich. Oft wurde mir schlecht, und ich kämpfte mit Brechreiz, Kopfschmerzen und Ohnmachtsanfällen. Aber am Ende der großen Ferien hatte ich die Summe zusammen, die das Fahrrad mit Gangschaltung kostete. Das hieß, ein bißchen unabhängiger zu sein.
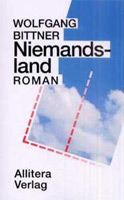
Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München
Der Autor
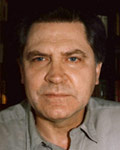 Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.Online-Flyer Nr. 52 vom 12.07.2006















