SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Literatur
Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 1
"Niemandsland"
von Wolfgang Bittner
Vorbemerkung
Von Zeit zu Zeit setzt sich in meinem Kopf der Gedanke fest, daß die Welt der Phantasie die tatsächliche, jedenfalls zu bevorzugende sei, während die sogenannte Realität mir höchst unwirklich erscheint und mich manchmal geradezu anwidert. Wir müssen essen, trinken, wohnen, uns kleiden; das sind die Grundbedürfnisse, und sie sind befriedigt. Was aber geschieht darüber hinaus? Und was könnte geschehen? Diese Frage, die mich mehr und mehr beschäftigt, verlangt immer dringender eine Antwort, die ich nicht nur denken, sondern nach der ich auch leben kann. Ich grüble, überlege, aber die Schlußfolgerungen aus diesem Gefühl der Unzufriedenheit bleiben undeutlich, und die verwirrende, beängstigende Unsicherheit der letzten Tage und Wochen nimmt wieder zu, trotz des warmen Sonnenlichts draußen auf dem frischen Grün der Bäume und auf der Haut.
Es wird Sommer. Früher war der Himmel an solchen Tagen sehr hoch und tiefblau, Bussarde kreisten bis zum Stadtrand, und auf dem Dach eines Bauernhauses an der Landstraße nisteten jedes Jahr die Störche. Am Horizont, als dicker Strich hinter den Zäunen und Wallhecken erkennbar, begann der Wald. Dahinter Heide und Moor. Flach das Land, schwarzgeflecktes Vieh dort, die Bauernhöfe ziegelrot. Gegen Abend zogen von der nahen See die Wolkenberge herauf. Früher, das erscheint mir wie gestern. Und heute? Als ob heute alles schlechter wäre, obwohl es sich besser zu leben scheint.
Hier, am Rande der Großstadt, hängt fast immer etwas Dunst in der Luft. Im Sommer wird es schnell schwül, wenn sich die Hitze in der von sanften Höhenzügen umgebenen tieferliegenden Innenstadt anstaut. Bis zum alten Marktplatz sind es drei Kilometer. Öffne ich das Fenster und beuge mich vor, erblicke ich zwischen den Hochhäusern und Wohnblöcken den Teil der Stadt, der sich drüben am Hang hinaufzieht. Nach Regentagen oder Gewittern kann ich über den Dächern und Bäumen die Kuppen der nahen Mittelgebirgszüge sehen.
I
Vorstadtsommer
Der Nachmittag hat angefangen. Ich sitze am Schreibtisch und arbeite. Das Zimmer ist groß, die schrägen Seitenwände aus braunem Holz treffen sich in der Spitze über den Querbalken, die das Dach stützen. Kommt man zur Tür herein, steht der Schreibtisch rechts unter dem schrägen Fenster, ein kleinerer unter der linken Seitenwand, daneben eine Liege. Die Tür wird eingefaßt von einem Bücherregal, das sich den Seitenwänden anpaßt. An der gegenüberliegenden Wand und unter den Schrägen stehen Ablagen, Truhen und Schränke, bedeckt mit Papieren.
Auf dem linken Schreibtisch liegt die noch aufgeschlagene Kladde mit den Aufzeichnungen, die mir von Tag zu Tag wichtiger werden. Der rechte Schreibtisch quillt über von Examensarbeiten, Prüfungsprotokollen und Notizzetteln, bei deren Anblick das Gefühl der Sinnlosigkeit zunimmt.
Ich lese: »Der Mensch ist nichts anderes als wozu er sich macht.« Ein weiterer Satz kommt hinzu: »Ich kann immer wählen, aber ich muß mir bewußt sein, daß ich, wenn ich nicht wähle, trotzdem wähle.« Und noch ein Satz: »Der Mensch ist verurteilt, frei zu sein.« Wie paßt das alles zusammen? Wie paßt es zu meinem Leben? Lange Zeit war ich überzeugt von solchen Sätzen, konnte mich danach richten, in den Veranstaltungen darüber sprechen und Seminare abhalten.
Den ganzen Vormittag habe ich versucht, mir einen Traum der vergangenen Nacht in Erinnerung zu rufen. Es will mir nicht gelingen. Wenige Sekunden nach dem Erwachen wußte ich noch, daß mich mein Traum in eine zurückliegende Wirklichkeit versetzt hatte. Immer wieder gibt es Ansatzpunkte, vage Gedächtnisfetzen. Eine Straße, ein Haus, gegenüber eine Ziegelmauer hinter den hell gefleckten Stämmen von Platanen; Menschen ohne Gesichter, wie Spuren. Auf der Straße fahren lange Kolonnen von Lastwagen mit Soldaten vorbei. Die Bilder fügen sich nicht zusammen, sind gleich wieder weg. Dafür wird ein Gefühl um so deutlicher: Angst. Was ist auf dieser Straße geschehen, vor dieser Mauer, in diesem Haus? Es muß lange her sein. Ungereimtes, längst Vergessenes, dennoch eingeprägt und hervorholbar wie alte abgegriffene Fotos, deren Ränder vergilbt sind.
Als Junge wollte ich Förster werden. Aber, immer ein Aber. Das Geld. Ich verbrachte die Nachmittage und die Ferien im Wald. Gleich nach dem Mittagessen oder schon nach dem Frühstück, je nach dem, verschwand ich, das Messer am Gürtel, ob es Sommer war oder Winter. Zumeist lief ich neun Kilometer durch Feldmark und Wald bis an den Rand eines ehemaligen Militärflugplatzes, wo ich mich zwischen den Betonbrocken eines gesprengten Munitionsdepots eingerichtet hatte. Manchmal schrieb ich Gedichte. Die Wochenenden verbrachte ich zusammen mit den Söhnen des Revierförsters, mit denen ich mich im Wald anfreundete. Wir besaßen Luftgewehre und schossen auf Konservendosen, die wir hochwarfen. Hin und wieder bekamen wir das Kleinkalibergewehr und die Erlaubnis, einen Eichelhäher oder eine Taube zu schießen. Katzen waren sowieso zum Abschuß freigegeben, sie galten als Schädlinge. Fingen sie sich in einer Kastenfalle, ließ der Forsteleve sie in einen Sack schlüpfen, den er mit einem Knüppel bearbeitete, bis sich nichts mehr regte. Ich sei ein guter Schütze, wurde gesagt. Aus mir könne etwas werden. Wer weiß.
Wie langsam, wie mühsam es vorangeht. Als stünde das Leben erst noch bevor. Diese erstaunlichen Bewegungen zwischen den zerklüfteten Landschaften in uns, über denen sich die schwebenden Phantasiegebilde erheben. Aber Erinnerung und Alltag lassen uns nicht aus den Klauen. Dann und wann leistet auch der Traum im Unterbewußten, was der schwerfälligere Verstand dem Bewußtsein vorenthält. Eine Straße, eine Mauer, ein Haus, das Grollen täglich näherkommender Geschütze, rasselnde Panzerketten. Lastwagen voller Soldaten fahren vorbei. Meine Mutter sagt: »Die OT.« Schaue ich im Lexikon nach, lese ich: »Fritz Todt (1891?1942), nationalsozialistischer Generalinspekteur für das Straßenwesen, Leiter des Baus der Autobahnen und des Westwalls. Nach ihm benannt die Organisation Todt (OT), für militärische Bauarbeiten.« Mir fällt ein: »Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.« Jetzt kehrte er heim.
Die Gegenwart ist wirklich und unwirklich zugleich. In ihr handeln, atmen, träumen, erinnern und planen wir. Das alles. Lebt besser, wer nicht erinnert, was war? Oder kann man sagen: es komme darauf an, das Wesentliche zu erfassen und das Unwesentliche beiseite zu lassen? Aber was ist das und wie diese Zerklüftungen erschließen? »Der Dinge, die am meisten fürs Vergessen geeignet sind«, sagt Gracian in seinem Handorakel, »erinnern wir uns am besten. Das Gedächtnis ist nicht allein widerspenstig, indem es uns verläßt, wenn wir es am meisten brauchen, sondern auch töricht, indem es herangelaufen kommt, wenn es gar nicht paßt.« Die unabweisbare Durchdringung des Wirklichen durch das Unwirkliche, diese Verwirrung, die uns den Blick verstellt. Unser Unvermögen, einfach den ganzen Gedankenschutt beiseitezuschieben, aufzuräumen damit, hindurchzugehen mit kindlichen Augen, als läge vor uns noch ein unberührtes Leben. Als seien wir aus einem bedrohlichen Traum erwacht und öffneten eine Tür nach draußen. Ins wirkliche Leben.
Die Zeit vergeht. Allmählich nehmen die Geräusche zu. Die Bürostunden sind zu Ende, und in den Fabriken hat die Schicht gewechselt. Zu Hause geht es weiter. Nach Feierabend wird der Garten bearbeitet, das Auto gewaschen oder eine weitere Verbesserung am Haus vorgenommen. Die Gärten sind schmal, die Zwischendecken der Häuser durchgehend aus Beton. Das Hämmern am Ende der Häuserreihe dringt durch bis zur anderen Seite. Die Toilettenspülung der Nachbarn zur Rechten und zur Linken, der Geruch eines mit Karbolineum gestrichenen Zauns. Wer hier für sich sein will, hat es nicht immer leicht, und Freundlichkeit wird nicht selten als Schwäche ausgelegt. »Hannover 96 hat gewonnen!« höre ich. »Was haben denn die Salatpflanzen gekostet?«
Ein Vorbau, neue Fenster aus Doppelglas, eine Überdachung für die Terrasse, das Wohnzimmer wird getäfelt. Hat jemand auch den Flur mit Holz verschalt, schließen sich die Nachbarn bald an. Die Frauen verdienen mit, sonst wären die Abzahlungsraten und Zinsen nicht aufzubringen. Eine Konfirmation, eine Beerdigung, ein neues Auto. Ob wir im nächsten Jahr den Keller ausbauen? Oder das Dachgeschoß? Die Obstbäume werden jedes Jahr im Spätherbst rigoros zurückgeschnitten; keiner ist höher als vier Meter, damit Licht bleibt für die Gemüsebeete. Abends werden die Rolläden heruntergelassen, das bläuliche Licht der Fernseher verschwindet. Nur noch das Rauschen der nahen Autobahn ist zu hören. Alles geht seinen Gang.
Ruth hat in der Zeitung gelesen, daß in der Nähe des Ostviertels neues Bauland erschlossen wird. Ihr gefällt unser Haus, aber nicht die Umgebung. Sie meint, wir sollten uns umsehen. Auch ich empfinde den Widerspruch. Auf der einen Seite der intellektuelle Anspruch und die Arbeit an der Hochschule, auf der anderen Seite diese Enge. Dennoch bin ich der Meinung, daß wir warten sollten, ich fürchte mich vor neuen Verpflichtungen. Hätte ich nicht das Gefühl, von Ruth mißverstanden zu werden, würde ich gern mit ihr darüber sprechen. Schon wieder entsteht dieses Druckgefühl im Magen, und die Handflächen sind von einem Moment auf den anderen schweißnaß. Ich gehe ins Badezimmer und lasse das kalte Wasser über die Unterarme laufen.
Die Vorlesung muß vorbereitet werden. Aber erneut drängt sich etwas ganz anderes dazwischen. Dieser Schrei! Er war auch in mir. Dann wieder Stille. Ich kam aus der Stadt und parkte gerade das Auto. Ich horchte. Nach einem Moment meinte ich, mich getäuscht zu haben. Doch kurz darauf kamen die Polizei und der Krankenwagen.
Heute berichtete die Zeitung über die Ermittlungen. Der Täter war zweiunddreißig Jahre alt, Versicherungsvertreter, er hatte mit seiner Freundin deren Eltern besucht. Sie wollte sich scheiden lassen, doch ihre Eltern waren dagegen, weil ihnen der neue Freund nicht gefiel. Er war dann nach einer heftigen Auseinandersetzung am späten Nachmittag weggegangen und hatte in einer Gastwirtschaft zwei Mitglieder des Schäferhunde?Clubs kennengelernt. Gemeinsam waren sie nach einigen Bieren und Schnäpsen in das Vereinshaus gegangen, wo eine Preisverleihung gefeiert wurde, hatten dort bis spät in die Nacht weitergetrunken und gelegentlich auch mit dem einzigen weiblichen Vereinsmitglied getanzt. Männerwitze sollen erzählt und schlüpfrige Lieder gesungen worden sein, wie das bei solchen Gelegenheiten üblich ist.
Am nächsten Vormittag erhielt die Freundin des Versicherungsvertreters einen Anruf, sie möge ihm sein Auto auf den Parkplatz vor den Wohnblocks bringen. Als sie es dort abgestellt hatte und zu ihrem Vater ins Auto gestiegen war, um nach Hause zurückzufahren, erschien ihr Freund. Oben, am Fenster, stand die Frau aus dem Schäferhunde?Club.
Es kam erneut zu einem Streit, in dessen Verlauf der Freund in das Handschuhfach seines Opels griff, einen Revolver hervorzog und sowohl den Vater als auch die Tochter erschoß. Sie rannte noch quer über die Straße, um in einem der Hauseingänge Schutz zu suchen. Dort brach sie dann, von mehreren Kugeln getroffen, zusammen und verblutete. Ihr Schreien habe ich bis heute im Ohr.
Sie habe in Hamburg als Prostituierte gearbeitet, stand in der Zeitung, und ihr Ehemann sei zugleich ihr Zuhälter gewesen, der neue Freund auch kein unbeschriebenes Blatt. In der ganzen Stadt sprach man an den folgenden Tagen darüber. Die Mutter, so war zu hören, habe einen Nervenzusammenbruch erlitten, kurz darauf einen Schlaganfall und liege auf den Tod in der Klinik. So werden Konflikte ausgetragen und beendet. In seltenen, spektakulären Fällen steht etwas darüber in der Zeitung. Die Leute wollten vor allem wissen, wer die Frau aus dem Schäferhunde?Club gewesen ist. Sie soll inzwischen umgezogen sein.
Unten die Stimmen der Nachbarn, als fielen sie übereinander her. Dabei treiben sie ihre Unterhaltung, und das Kreischen und Brüllen sind ihr Lachen und ihre Scherze. Dazwischen Hämmern, Bohren. Der Nachbar zur Linken hat sämtliche Bäume abgehackt und die Büsche herausgerissen; er möchte eine freie Gartenfläche haben für noch mehr Gemüse und Kohl.
Ruth ruft, sie müsse noch etwas besorgen. Julia kommt herauf und will mit mir spielen. »Mal doch etwas«, sage ich. Sie setzt sich an den linken Schreibtisch und malt unseren Garten: den Fliederbaum neben der Terrasse, den von Büschen umgebenen Rasen, den vor zwei Jahren gepflanzten Kirschbaum, die beiden Beerensträucher, im Hintergrund die Fichten und Kiefern. Sie fragt, ob Füchse richtige Ohren haben. Ich sage: »Sie sitzen oben am Kopf und sind spitz.« Sie hat in den Himmel über dem Garten einen Fuchs gemalt, genau neben die Sonne. Dahinter beginnt der Wald.
Die Zeit läuft mir weg, und wieder fehlt es am Konzept. Die Studenten erscheinen mir bedrohlich. Hätte ich mich besser vorbereitet, wie noch vor Wochen, wäre alles leichter. Ich wüßte in der Abendvorlesung vielleicht etwas Sinnvolles zu sagen. So spüre ich schon jetzt den faden Geschmack, während ich Sätze formuliere. Es hilft nichts, ich muß gehen, ich muß mich überwinden. Das fällt mir immer schwerer. Obwohl sich die Studenten in den letzten Jahren zu beflissenen Schülern entwickelt haben; nichts mehr von der Aufbruchstimmung der 67er/68er Jahre ist geblieben. Wer nicht die besten Zensuren bringt, bleibt auf der Strecke. Sie arbeiten auf ein Examen hin, das für viele den Beginn einer längeren Arbeitslosigkeit bedeutet. Am Ende steht fast immer ein Kompromiß, denn selten entsprechen die Bedingungen des Arbeitsmarktes dem Lebensentwurf.
Ich steige die Treppe hinunter. Ruth kommt aus der Küche und sagt, einen leichten Vorwurf in der Stimme: »Das Abendessen steht schon lange auf dem Tisch.« Sie bemerkt nicht meine Abwehr. »Willst du denn nichts essen, bevor du gehst?« fragt sie. »Später vielleicht«, antworte ich, »wenn ich zurückkomme. Jetzt mag ich nichts.« Sie verkneift sich eine Rüge, ein flüchtiger Kuß.
An der Haustür steht der Name. Meine Verhältnisse sind geordnet, ich bin nichts anderes als wozu ich mich gemacht habe. Ich muß vorher noch ins Büro, die Post durchsehen, ich muß mich jetzt beeilen. Aber wie paßt das alles zu mir?
Das Gehen bereitet Mühe, mir ist schlecht. Umkehren wäre die richtige Konsequenz, doch unmöglich. Es hilft nichts. Ich muß mir Klarheit verschaffen, denke ich, mich vergewissern, zurückgehen. Dennoch starte ich das Auto und fahre los.
Das Buch
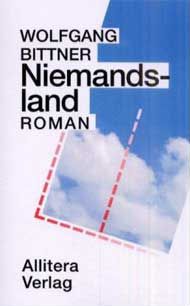 Der Roman führt zurück in die achtziger Jahre der Bundesrepublik. Der Ich-Erzähler, ein Universitätsdozent, gerät in eine Sinnkrise und Depression, aus der er sich durch das Erfassen seiner eigenen Geschichte zu befreien versucht. Er hat sich einen Standort geschaffen, doch die scheinbare Geborgenheit wird nach und nach in Frage gestellt. Das Gefühl der Sinnlosigkeit lähmt und läßt zugleich ahnen, daß die Ursache der Depression ein tiefes unterbewußtes Entsetzen ist. Fast zwanghaft spürt der Erzähler diesem unbestimmten Gefühl nach, nähert sich dem Ursprung seiner Angst. Ein Mosaik entsteht.
Der Roman führt zurück in die achtziger Jahre der Bundesrepublik. Der Ich-Erzähler, ein Universitätsdozent, gerät in eine Sinnkrise und Depression, aus der er sich durch das Erfassen seiner eigenen Geschichte zu befreien versucht. Er hat sich einen Standort geschaffen, doch die scheinbare Geborgenheit wird nach und nach in Frage gestellt. Das Gefühl der Sinnlosigkeit lähmt und läßt zugleich ahnen, daß die Ursache der Depression ein tiefes unterbewußtes Entsetzen ist. Fast zwanghaft spürt der Erzähler diesem unbestimmten Gefühl nach, nähert sich dem Ursprung seiner Angst. Ein Mosaik entsteht.
Rückblicke ziehen den Leser immer mehr in die Geschichte hinein: in die Kindheit nach dem Krieg, die Flucht aus Schlesien, das Leben in einem Barackenlager, in die Studentenzeit und die 68er-Bewegung, die Begegnung des jungen Juristen mit einer vom Erbe der Nazidiktatur belasteten Justiz. Die Suche nach dem Sinn des eigenen Lebens wird zugleich zur Suche nach dem Sinn in der Geschichte, führt zurück ins Mittelalter und in die Zeit der Eroberung Mexikos. Muster scheinen sich zu wiederholen, Spannungslinien laufen im Heute zusammen.
Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München
Der Autor
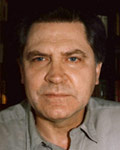 Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Online-Flyer Nr. 48 vom 14.06.2006
Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 1
"Niemandsland"
von Wolfgang Bittner
Vorbemerkung
Von Zeit zu Zeit setzt sich in meinem Kopf der Gedanke fest, daß die Welt der Phantasie die tatsächliche, jedenfalls zu bevorzugende sei, während die sogenannte Realität mir höchst unwirklich erscheint und mich manchmal geradezu anwidert. Wir müssen essen, trinken, wohnen, uns kleiden; das sind die Grundbedürfnisse, und sie sind befriedigt. Was aber geschieht darüber hinaus? Und was könnte geschehen? Diese Frage, die mich mehr und mehr beschäftigt, verlangt immer dringender eine Antwort, die ich nicht nur denken, sondern nach der ich auch leben kann. Ich grüble, überlege, aber die Schlußfolgerungen aus diesem Gefühl der Unzufriedenheit bleiben undeutlich, und die verwirrende, beängstigende Unsicherheit der letzten Tage und Wochen nimmt wieder zu, trotz des warmen Sonnenlichts draußen auf dem frischen Grün der Bäume und auf der Haut.
Es wird Sommer. Früher war der Himmel an solchen Tagen sehr hoch und tiefblau, Bussarde kreisten bis zum Stadtrand, und auf dem Dach eines Bauernhauses an der Landstraße nisteten jedes Jahr die Störche. Am Horizont, als dicker Strich hinter den Zäunen und Wallhecken erkennbar, begann der Wald. Dahinter Heide und Moor. Flach das Land, schwarzgeflecktes Vieh dort, die Bauernhöfe ziegelrot. Gegen Abend zogen von der nahen See die Wolkenberge herauf. Früher, das erscheint mir wie gestern. Und heute? Als ob heute alles schlechter wäre, obwohl es sich besser zu leben scheint.
Hier, am Rande der Großstadt, hängt fast immer etwas Dunst in der Luft. Im Sommer wird es schnell schwül, wenn sich die Hitze in der von sanften Höhenzügen umgebenen tieferliegenden Innenstadt anstaut. Bis zum alten Marktplatz sind es drei Kilometer. Öffne ich das Fenster und beuge mich vor, erblicke ich zwischen den Hochhäusern und Wohnblöcken den Teil der Stadt, der sich drüben am Hang hinaufzieht. Nach Regentagen oder Gewittern kann ich über den Dächern und Bäumen die Kuppen der nahen Mittelgebirgszüge sehen.
I
Vorstadtsommer
Der Nachmittag hat angefangen. Ich sitze am Schreibtisch und arbeite. Das Zimmer ist groß, die schrägen Seitenwände aus braunem Holz treffen sich in der Spitze über den Querbalken, die das Dach stützen. Kommt man zur Tür herein, steht der Schreibtisch rechts unter dem schrägen Fenster, ein kleinerer unter der linken Seitenwand, daneben eine Liege. Die Tür wird eingefaßt von einem Bücherregal, das sich den Seitenwänden anpaßt. An der gegenüberliegenden Wand und unter den Schrägen stehen Ablagen, Truhen und Schränke, bedeckt mit Papieren.
Auf dem linken Schreibtisch liegt die noch aufgeschlagene Kladde mit den Aufzeichnungen, die mir von Tag zu Tag wichtiger werden. Der rechte Schreibtisch quillt über von Examensarbeiten, Prüfungsprotokollen und Notizzetteln, bei deren Anblick das Gefühl der Sinnlosigkeit zunimmt.
Ich lese: »Der Mensch ist nichts anderes als wozu er sich macht.« Ein weiterer Satz kommt hinzu: »Ich kann immer wählen, aber ich muß mir bewußt sein, daß ich, wenn ich nicht wähle, trotzdem wähle.« Und noch ein Satz: »Der Mensch ist verurteilt, frei zu sein.« Wie paßt das alles zusammen? Wie paßt es zu meinem Leben? Lange Zeit war ich überzeugt von solchen Sätzen, konnte mich danach richten, in den Veranstaltungen darüber sprechen und Seminare abhalten.
Den ganzen Vormittag habe ich versucht, mir einen Traum der vergangenen Nacht in Erinnerung zu rufen. Es will mir nicht gelingen. Wenige Sekunden nach dem Erwachen wußte ich noch, daß mich mein Traum in eine zurückliegende Wirklichkeit versetzt hatte. Immer wieder gibt es Ansatzpunkte, vage Gedächtnisfetzen. Eine Straße, ein Haus, gegenüber eine Ziegelmauer hinter den hell gefleckten Stämmen von Platanen; Menschen ohne Gesichter, wie Spuren. Auf der Straße fahren lange Kolonnen von Lastwagen mit Soldaten vorbei. Die Bilder fügen sich nicht zusammen, sind gleich wieder weg. Dafür wird ein Gefühl um so deutlicher: Angst. Was ist auf dieser Straße geschehen, vor dieser Mauer, in diesem Haus? Es muß lange her sein. Ungereimtes, längst Vergessenes, dennoch eingeprägt und hervorholbar wie alte abgegriffene Fotos, deren Ränder vergilbt sind.
Als Junge wollte ich Förster werden. Aber, immer ein Aber. Das Geld. Ich verbrachte die Nachmittage und die Ferien im Wald. Gleich nach dem Mittagessen oder schon nach dem Frühstück, je nach dem, verschwand ich, das Messer am Gürtel, ob es Sommer war oder Winter. Zumeist lief ich neun Kilometer durch Feldmark und Wald bis an den Rand eines ehemaligen Militärflugplatzes, wo ich mich zwischen den Betonbrocken eines gesprengten Munitionsdepots eingerichtet hatte. Manchmal schrieb ich Gedichte. Die Wochenenden verbrachte ich zusammen mit den Söhnen des Revierförsters, mit denen ich mich im Wald anfreundete. Wir besaßen Luftgewehre und schossen auf Konservendosen, die wir hochwarfen. Hin und wieder bekamen wir das Kleinkalibergewehr und die Erlaubnis, einen Eichelhäher oder eine Taube zu schießen. Katzen waren sowieso zum Abschuß freigegeben, sie galten als Schädlinge. Fingen sie sich in einer Kastenfalle, ließ der Forsteleve sie in einen Sack schlüpfen, den er mit einem Knüppel bearbeitete, bis sich nichts mehr regte. Ich sei ein guter Schütze, wurde gesagt. Aus mir könne etwas werden. Wer weiß.
Wie langsam, wie mühsam es vorangeht. Als stünde das Leben erst noch bevor. Diese erstaunlichen Bewegungen zwischen den zerklüfteten Landschaften in uns, über denen sich die schwebenden Phantasiegebilde erheben. Aber Erinnerung und Alltag lassen uns nicht aus den Klauen. Dann und wann leistet auch der Traum im Unterbewußten, was der schwerfälligere Verstand dem Bewußtsein vorenthält. Eine Straße, eine Mauer, ein Haus, das Grollen täglich näherkommender Geschütze, rasselnde Panzerketten. Lastwagen voller Soldaten fahren vorbei. Meine Mutter sagt: »Die OT.« Schaue ich im Lexikon nach, lese ich: »Fritz Todt (1891?1942), nationalsozialistischer Generalinspekteur für das Straßenwesen, Leiter des Baus der Autobahnen und des Westwalls. Nach ihm benannt die Organisation Todt (OT), für militärische Bauarbeiten.« Mir fällt ein: »Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.« Jetzt kehrte er heim.
Die Gegenwart ist wirklich und unwirklich zugleich. In ihr handeln, atmen, träumen, erinnern und planen wir. Das alles. Lebt besser, wer nicht erinnert, was war? Oder kann man sagen: es komme darauf an, das Wesentliche zu erfassen und das Unwesentliche beiseite zu lassen? Aber was ist das und wie diese Zerklüftungen erschließen? »Der Dinge, die am meisten fürs Vergessen geeignet sind«, sagt Gracian in seinem Handorakel, »erinnern wir uns am besten. Das Gedächtnis ist nicht allein widerspenstig, indem es uns verläßt, wenn wir es am meisten brauchen, sondern auch töricht, indem es herangelaufen kommt, wenn es gar nicht paßt.« Die unabweisbare Durchdringung des Wirklichen durch das Unwirkliche, diese Verwirrung, die uns den Blick verstellt. Unser Unvermögen, einfach den ganzen Gedankenschutt beiseitezuschieben, aufzuräumen damit, hindurchzugehen mit kindlichen Augen, als läge vor uns noch ein unberührtes Leben. Als seien wir aus einem bedrohlichen Traum erwacht und öffneten eine Tür nach draußen. Ins wirkliche Leben.
Die Zeit vergeht. Allmählich nehmen die Geräusche zu. Die Bürostunden sind zu Ende, und in den Fabriken hat die Schicht gewechselt. Zu Hause geht es weiter. Nach Feierabend wird der Garten bearbeitet, das Auto gewaschen oder eine weitere Verbesserung am Haus vorgenommen. Die Gärten sind schmal, die Zwischendecken der Häuser durchgehend aus Beton. Das Hämmern am Ende der Häuserreihe dringt durch bis zur anderen Seite. Die Toilettenspülung der Nachbarn zur Rechten und zur Linken, der Geruch eines mit Karbolineum gestrichenen Zauns. Wer hier für sich sein will, hat es nicht immer leicht, und Freundlichkeit wird nicht selten als Schwäche ausgelegt. »Hannover 96 hat gewonnen!« höre ich. »Was haben denn die Salatpflanzen gekostet?«
Ein Vorbau, neue Fenster aus Doppelglas, eine Überdachung für die Terrasse, das Wohnzimmer wird getäfelt. Hat jemand auch den Flur mit Holz verschalt, schließen sich die Nachbarn bald an. Die Frauen verdienen mit, sonst wären die Abzahlungsraten und Zinsen nicht aufzubringen. Eine Konfirmation, eine Beerdigung, ein neues Auto. Ob wir im nächsten Jahr den Keller ausbauen? Oder das Dachgeschoß? Die Obstbäume werden jedes Jahr im Spätherbst rigoros zurückgeschnitten; keiner ist höher als vier Meter, damit Licht bleibt für die Gemüsebeete. Abends werden die Rolläden heruntergelassen, das bläuliche Licht der Fernseher verschwindet. Nur noch das Rauschen der nahen Autobahn ist zu hören. Alles geht seinen Gang.
Ruth hat in der Zeitung gelesen, daß in der Nähe des Ostviertels neues Bauland erschlossen wird. Ihr gefällt unser Haus, aber nicht die Umgebung. Sie meint, wir sollten uns umsehen. Auch ich empfinde den Widerspruch. Auf der einen Seite der intellektuelle Anspruch und die Arbeit an der Hochschule, auf der anderen Seite diese Enge. Dennoch bin ich der Meinung, daß wir warten sollten, ich fürchte mich vor neuen Verpflichtungen. Hätte ich nicht das Gefühl, von Ruth mißverstanden zu werden, würde ich gern mit ihr darüber sprechen. Schon wieder entsteht dieses Druckgefühl im Magen, und die Handflächen sind von einem Moment auf den anderen schweißnaß. Ich gehe ins Badezimmer und lasse das kalte Wasser über die Unterarme laufen.
Die Vorlesung muß vorbereitet werden. Aber erneut drängt sich etwas ganz anderes dazwischen. Dieser Schrei! Er war auch in mir. Dann wieder Stille. Ich kam aus der Stadt und parkte gerade das Auto. Ich horchte. Nach einem Moment meinte ich, mich getäuscht zu haben. Doch kurz darauf kamen die Polizei und der Krankenwagen.
Heute berichtete die Zeitung über die Ermittlungen. Der Täter war zweiunddreißig Jahre alt, Versicherungsvertreter, er hatte mit seiner Freundin deren Eltern besucht. Sie wollte sich scheiden lassen, doch ihre Eltern waren dagegen, weil ihnen der neue Freund nicht gefiel. Er war dann nach einer heftigen Auseinandersetzung am späten Nachmittag weggegangen und hatte in einer Gastwirtschaft zwei Mitglieder des Schäferhunde?Clubs kennengelernt. Gemeinsam waren sie nach einigen Bieren und Schnäpsen in das Vereinshaus gegangen, wo eine Preisverleihung gefeiert wurde, hatten dort bis spät in die Nacht weitergetrunken und gelegentlich auch mit dem einzigen weiblichen Vereinsmitglied getanzt. Männerwitze sollen erzählt und schlüpfrige Lieder gesungen worden sein, wie das bei solchen Gelegenheiten üblich ist.
Am nächsten Vormittag erhielt die Freundin des Versicherungsvertreters einen Anruf, sie möge ihm sein Auto auf den Parkplatz vor den Wohnblocks bringen. Als sie es dort abgestellt hatte und zu ihrem Vater ins Auto gestiegen war, um nach Hause zurückzufahren, erschien ihr Freund. Oben, am Fenster, stand die Frau aus dem Schäferhunde?Club.
Es kam erneut zu einem Streit, in dessen Verlauf der Freund in das Handschuhfach seines Opels griff, einen Revolver hervorzog und sowohl den Vater als auch die Tochter erschoß. Sie rannte noch quer über die Straße, um in einem der Hauseingänge Schutz zu suchen. Dort brach sie dann, von mehreren Kugeln getroffen, zusammen und verblutete. Ihr Schreien habe ich bis heute im Ohr.
Sie habe in Hamburg als Prostituierte gearbeitet, stand in der Zeitung, und ihr Ehemann sei zugleich ihr Zuhälter gewesen, der neue Freund auch kein unbeschriebenes Blatt. In der ganzen Stadt sprach man an den folgenden Tagen darüber. Die Mutter, so war zu hören, habe einen Nervenzusammenbruch erlitten, kurz darauf einen Schlaganfall und liege auf den Tod in der Klinik. So werden Konflikte ausgetragen und beendet. In seltenen, spektakulären Fällen steht etwas darüber in der Zeitung. Die Leute wollten vor allem wissen, wer die Frau aus dem Schäferhunde?Club gewesen ist. Sie soll inzwischen umgezogen sein.
Unten die Stimmen der Nachbarn, als fielen sie übereinander her. Dabei treiben sie ihre Unterhaltung, und das Kreischen und Brüllen sind ihr Lachen und ihre Scherze. Dazwischen Hämmern, Bohren. Der Nachbar zur Linken hat sämtliche Bäume abgehackt und die Büsche herausgerissen; er möchte eine freie Gartenfläche haben für noch mehr Gemüse und Kohl.
Ruth ruft, sie müsse noch etwas besorgen. Julia kommt herauf und will mit mir spielen. »Mal doch etwas«, sage ich. Sie setzt sich an den linken Schreibtisch und malt unseren Garten: den Fliederbaum neben der Terrasse, den von Büschen umgebenen Rasen, den vor zwei Jahren gepflanzten Kirschbaum, die beiden Beerensträucher, im Hintergrund die Fichten und Kiefern. Sie fragt, ob Füchse richtige Ohren haben. Ich sage: »Sie sitzen oben am Kopf und sind spitz.« Sie hat in den Himmel über dem Garten einen Fuchs gemalt, genau neben die Sonne. Dahinter beginnt der Wald.
Die Zeit läuft mir weg, und wieder fehlt es am Konzept. Die Studenten erscheinen mir bedrohlich. Hätte ich mich besser vorbereitet, wie noch vor Wochen, wäre alles leichter. Ich wüßte in der Abendvorlesung vielleicht etwas Sinnvolles zu sagen. So spüre ich schon jetzt den faden Geschmack, während ich Sätze formuliere. Es hilft nichts, ich muß gehen, ich muß mich überwinden. Das fällt mir immer schwerer. Obwohl sich die Studenten in den letzten Jahren zu beflissenen Schülern entwickelt haben; nichts mehr von der Aufbruchstimmung der 67er/68er Jahre ist geblieben. Wer nicht die besten Zensuren bringt, bleibt auf der Strecke. Sie arbeiten auf ein Examen hin, das für viele den Beginn einer längeren Arbeitslosigkeit bedeutet. Am Ende steht fast immer ein Kompromiß, denn selten entsprechen die Bedingungen des Arbeitsmarktes dem Lebensentwurf.
Ich steige die Treppe hinunter. Ruth kommt aus der Küche und sagt, einen leichten Vorwurf in der Stimme: »Das Abendessen steht schon lange auf dem Tisch.« Sie bemerkt nicht meine Abwehr. »Willst du denn nichts essen, bevor du gehst?« fragt sie. »Später vielleicht«, antworte ich, »wenn ich zurückkomme. Jetzt mag ich nichts.« Sie verkneift sich eine Rüge, ein flüchtiger Kuß.
An der Haustür steht der Name. Meine Verhältnisse sind geordnet, ich bin nichts anderes als wozu ich mich gemacht habe. Ich muß vorher noch ins Büro, die Post durchsehen, ich muß mich jetzt beeilen. Aber wie paßt das alles zu mir?
Das Gehen bereitet Mühe, mir ist schlecht. Umkehren wäre die richtige Konsequenz, doch unmöglich. Es hilft nichts. Ich muß mir Klarheit verschaffen, denke ich, mich vergewissern, zurückgehen. Dennoch starte ich das Auto und fahre los.
Das Buch
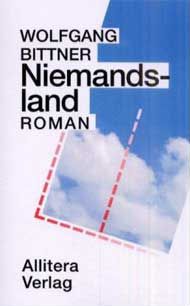 Der Roman führt zurück in die achtziger Jahre der Bundesrepublik. Der Ich-Erzähler, ein Universitätsdozent, gerät in eine Sinnkrise und Depression, aus der er sich durch das Erfassen seiner eigenen Geschichte zu befreien versucht. Er hat sich einen Standort geschaffen, doch die scheinbare Geborgenheit wird nach und nach in Frage gestellt. Das Gefühl der Sinnlosigkeit lähmt und läßt zugleich ahnen, daß die Ursache der Depression ein tiefes unterbewußtes Entsetzen ist. Fast zwanghaft spürt der Erzähler diesem unbestimmten Gefühl nach, nähert sich dem Ursprung seiner Angst. Ein Mosaik entsteht.
Der Roman führt zurück in die achtziger Jahre der Bundesrepublik. Der Ich-Erzähler, ein Universitätsdozent, gerät in eine Sinnkrise und Depression, aus der er sich durch das Erfassen seiner eigenen Geschichte zu befreien versucht. Er hat sich einen Standort geschaffen, doch die scheinbare Geborgenheit wird nach und nach in Frage gestellt. Das Gefühl der Sinnlosigkeit lähmt und läßt zugleich ahnen, daß die Ursache der Depression ein tiefes unterbewußtes Entsetzen ist. Fast zwanghaft spürt der Erzähler diesem unbestimmten Gefühl nach, nähert sich dem Ursprung seiner Angst. Ein Mosaik entsteht.Rückblicke ziehen den Leser immer mehr in die Geschichte hinein: in die Kindheit nach dem Krieg, die Flucht aus Schlesien, das Leben in einem Barackenlager, in die Studentenzeit und die 68er-Bewegung, die Begegnung des jungen Juristen mit einer vom Erbe der Nazidiktatur belasteten Justiz. Die Suche nach dem Sinn des eigenen Lebens wird zugleich zur Suche nach dem Sinn in der Geschichte, führt zurück ins Mittelalter und in die Zeit der Eroberung Mexikos. Muster scheinen sich zu wiederholen, Spannungslinien laufen im Heute zusammen.
Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München
Der Autor
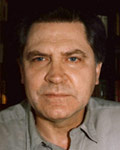 Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.
Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.Online-Flyer Nr. 48 vom 14.06.2006















