SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Kultur und Wissen
"Tabus der deutschen Geschichte"
Ein Aufklärungsbuch
Von Hans-Detlev v. Kirchbach
Glücklich ist, wer vergißt...
"Wir wünschen und halten es für nötig, daß auch im neuen Jahr der Versuch gemacht wird, die aufbauwilligen Kräfte der Nationalsozialisten zu praktischer Mitwirkung zu bringen", bekundete die Kölnische Zeitung am 1. Januar 1933. Jenes Organ erschien in einem Verlagshause, dessen Rechtsnachfolger dem Vernehmen noch heute in dieser Stadt existieren sollen. Und schon sind wir beim Thema des vorzustellenden Buches und damit bei einem eben auch sehr kölnischen Thema, über dessen Nachwirkungen wir in der NRhZ in den letzten Wochen gelegentlich berichten mußten: Die "Tabus der bundesdeutschen Geschichte" - so der Titel des verdienstvollen und bitter notwendigen Sammelbandes - sie sind auch Kölner Tabus. Und diese Geschichte wirkt unmittelbar in die Gegenwart nach.
Warum also in die Ferne schweifen, liegt das Gute doch so nah. Denn von der bildungsbürgerlich kultivierten Ranschmeiße der alten Kölnischen Zeitung an die vermeintlich so ungehobelten Nazis, vom ungeduldigen Herbeirufen der faschistischen Diktatur durch´s gepflegte rheinpreußische Bürgerorgan, will man heute nicht nur im größten örtlichen Pressepalast ungern hören. Ob in Berlin oder Bayreuth, ob in München oder Köln, die noble Bürgergesellschaft diente sich den sogenannten "National-Sozialisten" an, auch weil man von ihnen "Dienste" erwartete - vor allem nämlich eine brutale Zerschlagung aller wirklich sozialistischen Regungen. Wer aber aus welchen Motiven den später so genannten "braunen Mob" geradezu an die Macht geschoben hatte, wollten die unbeschadet "restaurierten" besseren Kreise der frühen Bundesrepublik schnell vergessen machen.
So legte sich ein dicker Mantel aus Tabus über eine Geschichte, bei deren Anblick man vor sich selbst hätte frösteln müssen - und die doch immer wieder hochbrach. Sei es, daß die Nazivergangenheit eines schleswig-holsteinischen Landesministers hochwirbelte, der seinerseits wiederum einen Hauptverantwortlichen der "Euthanasie", den NS-Professor Heyde alias Sawade, wissentlich gedeckt hatte. Oder daß die Umtriebe "alter Kameraden", etwa des SS-Hilfswerks HIAG oder des nazi-militaristischen "Stahlhelm", im Ausland peinlich auffielen.
Arm in Arm: die alten Kameraden
Auch im Inland gab´s da schon mal Widerspruch, wie er im Buche steht, erzählt vom mittlerweile 80jährigen Anwalt Heinrich Hannover. Denn der hatte 1955 Gewerkschafter zu verteidigen, die sich herausgenommen hatten, im niedersächsischen Goslar gegen eine Zusammenrottung eben jenes "Stahlhelms" zu demonstrieren, bei der ein Generalfeldmarschall der Nazi-Wehrmacht eine Hetzrede hielt. Die Tabugesellschaft funktionierte ja nicht nur durchs einverständige Schweigen, sondern auch durchs gewaltsame Wegprügeln und Wegschließen jeden Widerspruchs. Und so verdrosch - man kennt das ja, findet auch Hannover, bis heute - die Polizei im Dienst der alten Kameraden die Antifaschisten und Gewerkschafter. Die landeten vor Gericht und wurden von den dortigen "Kameraden" verknackt, mit der Klarstellung, daß die so genannte Meinungs- und Versammlungsfreiheit, so Hannover, "nur den in Goslar versammelten Militaristen und dem von ihnen hofierten Hitler-General" zustand. Dieser Sumpf, befindet der Autor, werde seit über 50 Jahren polizeilich und gerichtlich geschützt. "Aber es gibt geschichtsblinde Politiker und Publizisten, die ernsthaft fragen, woher die neonazistischen Kriegsflaggenträger kommen", beschreibt Hannover die anhaltenden Langzeitwirkungen der alten Tabuisierung, der sich neue hinzugesellt hat.
Schweigezeit
In der künstlichen Glasglocke der bundesrepublikanischen Restauration herrschte öffentliches "Beschweigen", umkleidet vom staatsoffiziellen Wegphrasieren im "Jargon der Eigentlichkeit". Im Familienkreise wiederum steigerte sich der Flüsterton vielleicht mal nach dem dritten Bier in kriegsmäßiges Poltern, so daß etwa der Rezensent schon als Achtjähriger mit dem Begriff "Flintenweiber" wohl vertraut war und irgendwie wußte, daß der Russe böse ist. Nur Störenfriede wie Wolfgang Staudte überreichten der selbstvergessenen westdeutschen Gesellschaft im allgemeinen und der selbstgerechten westdeutschen Justiz im besonderen angemessen dornige "Rosen für den Staatsanwalt". Diese "Tabus" sind zwar durchbrochen, seit die 68er das allgemeine Raunen schrill überschrieen. Doch statt des allgemeinen Tabus hat sich das individuelle durchgesetzt: Die anderen waren schlimm, aber bei uns gab es so etwas nicht. Zum Beispiel, wenn es, sagen wir, um das Thema "Arisierung" geht.
Doch widersteht der Sammelband der Versuchung, seinerseits an "linken" Mythen zu stricken. Etwa dem, daß nur die "herrschende Klasse" an allem schuld war und die Mehrheit nur in der Opferposition. Denn kaum war das Nazisystem etabliert, konnte es auch auf Massenkonsens bauen. Einen Konsens, der nicht nur auf aktuelle "Erfolge" zurückging, sondern nach Auffassung zum Beispiel der Sozialwissenschaftlerin Julia Schulze-Wessel sehr wohl auch auf tief verwurzelte Grundhaltungen, die die Nazis nur anzutippen und "aufzurufen" brauchten - vor allem nämlich den Antisemitismus. Dankenswerterweise - wenn auch daher sicher nicht zum Vergnügen aller LeserInnen - hat Schulze-Wessel in ihrem Beitrag "Schuld und Verleugnung - Funktion und Erscheinungsformen des Antisemitismus in der deutschen Nachkriegsgesellschaft" zumindest beiläufig auch auf linke, aber nicht minder "nationaltherapeutische" Verdrängungsleistungen hingewiesen. Diese ortet sie in staatlich organisierter Form zunächst einmal in der guten alten DDR:
"...Die reduzierte Faschismusanalyse, der zufolge das Großkapital mit Hilfe einer kleinen Clique Herrschender die Verbrechen zu verantworten habe, ließ im nachhinein die meisten Deutschen als Verführte und letztlich selbst als Opfer erscheinen. Damit entfiel eine wichtige Dimension in der Auseinandersetzung mit der Geschichte der NS-Verbrechen und der Vernichtung der europäischen Juden: die persönliche Auseinandersetzung jedes Einzelnen mit seiner persönlichen Verantwortung und Schuld."
Der zweite Schock der Emigranten
Was vor allem heimkehrende EmigrantInnen wie etwa Theodor W. Adorno zutiefst entsetzte, war ja nicht nur der Tatbestand, daß Gestalten wie Globke, Oberländer & Co. an zentralen Schaltstellen von Staat und Gesellschaft der Bundesrepublik ungebrochene Elite-Kontinuitäten verkörperten. Vielmehr stellte für sie "das allgemeine Verhalten in Deutschland" einen, so die Autorin, "zweiten Schock" nach dem Bekanntwerden der Vernichtungslager dar. Die herrschende "Restauration" fand von auch "unten" ihr Fundament: eben in jenem bis in viele Familienverästelungen verbreiteten "allgemeinen Verhalten", das sich in Charakteristika ausdrückte wie "ständig wiederkehrenden Versuchen, die Schuld bei anderen zu suchen, Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid anderer Menschen und Ignoranz der eigenen schuldhaften Verstrickungen". Die von den Nazis betriebene Suggerierung einer "Schicksalsgemeinschaft" auf Leben und Tod wirkte bei der Heimkehrergeneration auf anderer Ebene weiter: Bloß nicht dran rühren, Ruhe haben. So konnte das reaktionäre Führungspersonal der Bundesrepublik die Wiederbewaffnung durchsetzen, die Frauen wieder an Heim und Herd verbannen, und sich überhaupt manch Unglaubliches leisten. Mit am schlimsten in der Justiz.
Es richten die Rechten
Das Blut an den Roben der deutschen Rechtswahrer war noch nicht getrocknet, und schon wagte es der NS-Nachfolgestaat, NS-belastete Chargen auf die höchsten Richterposten zu hieven. Zum Beispiel Herrmann Weinkauff, ehemals Richter am Nazi-"Reichsgericht" zu Leipzig, der zum Präsidenten des Bundesgerichtshofs avancierte. In seiner Antrittsrede verlor der allerchristlichste Herr Gerichtspräsident nicht ein Wort an die Opfer des Faschismus und seiner Mordjustiz, beschwor statt dessen mit süßlichem Timbre die "Blutsbande" der Blutjuristen:
"Noch fehlen allerdings Brüder, die ihren Platz in unserer Mitte haben sollten. Niemand wäre glücklicher als wir, wenn sie bald gemeinsam mit uns am gemeinsamen deutschen Rechte arbeiten könnten."
Weinkauffs Ruf fand Gehör, und so schafften es die alten "Brüder" von Volks-, Reichs- und Sondergerichten bald wieder in Spitzenstellungen der "demokratischen Rechtspflege". Mit einschlägigen Resultaten: Weinkauffs BGH erhob 1954 zwar die "Verlobtenkuppelei" in einem heute nur noch als Satire lesbaren Urteil zu einem schweren Vergehen wider Sitte, Moral und "Abendland", sprach dafür aber aber reihenweise Naziverbrecher aus dem Kreise von Wehrmacht, Polizei und selbstredend Justiz frei. "Das Wirken des Bundesgerichtshofs war schauerlich", so bewertet heute Ralph Giordano diese Epoche der bundesdeutschen Rechtsgeschichte.
Zweites Beispiel, das Otto Köhler der Tabuisierung entreißt: Hermann Höpker-Aschoff, erster Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Noch wenige Jahre zuvor hatte der Hüter unserer demokratischen Verfassung als, so Autor Köhler, "hochrangiger Mitarbeiter der Leichenfledderer und Plünderungsspezialisten" gewirkt. In den Jahren des Tabus war Höpker-Aschoff Leiter der Abteilung IV - "Vermögensverwaltung des ehemaligen polnischen Staates" - bei der Nazi- "Haupttreuhandstelle Ost". In dieser Funktion half er jenem Staat, der vor dem Grundgesetz existierte, bei der Ausplünderung polnischer und insbesondere jüdischer Vermögenswerte, vulgo "Arisierung". Nach Inkrafttreten unseres rechtsstaatlichen Grundgesetzes schönte man einfach Höpker-Aschoffs Lebenslauf. Unser demokratischer Rechtsstaat behauptet offiziell bis heute, der Rechtsprofessor und ehemalige preußische Finanzminister (1925-1931) habe sich im 3. Reich ins "Privatleben" zurückgezogen. Tabus der deutschen Geschichte - sie bleiben Tabus der bundesdeutschen Gegenwart; nicht immer, aber oft.
Offensive der Gegenaufklärung
Kein Wunder, denn wenn wir im Rechtssystem und direkt beim Bundesverfassungsgericht bleiben: Die "verweigerte Selbstaufklärung der Justiz", so der pensionierte Richter am Oberlandesgericht Braunschweig und unermüdliche rechtshistorische Aufklärer Helmut Kramer in seinem gleichlautenden Beitrag, findet dem Autor zufolge gerade in der Hochjustiz längst wieder scharf konturierte Protagonisten. Wie zum Beispiel den einflußreichen Verfassungsrichter Udo di Fabio. Der möchte die dumme "tausendjährige" Geschichte am liebsten gleich ganz umschreiben, und zwar so, wie man sie in den güldenen fünfziger Jahre gern gehabt hätte.
Mit schwerem altem Mythendunst aus einer ganz großen rhetorischen Nebelmaschine möchte Udo di Fabio alle zwischenzeitliche historisch-kritische Aufklärung wegblasen. Und aus dem magischen Urgrund der bundesdeutschen Gründungslegenden soll wieder der vereinzelte und letztlich schicksalhaft unbegreifliche, alienhafte "Dämon" Adolf auferstehen, der ganz und gar im Alleingang das treudeutsche Volk "behext" und "verführt" habe, so wie eine "zu verführende Frau". Hitler war, so einer der höchsten Richter dieses Staates, überhaupt kein Deutscher; er war nur "ein verkleideter Deutscher". So sind´s also wieder mal die anderen, welche auch immer, gewesen, und "wir" können beruhigt zur Tagesordnung übergehen - auf der laut di Fabio die Aufrüstung der "nationalen Identität" zu stehen habe.
Solche beiläufigen Beispiele zeigen, warum wir heute so manchmal meinen könnten, eine Zeitmaschine hätte uns zurück in die Fünfziger gebeamt. Es muß jedenfalls seinen Grund haben, warum ein offener Reaktionär wie Udo di Fabio eine Schaltstelle in diesem Staat besetzen kann. Emanzipation und Aufklärung nach 1968 sind in den Ansätzen stecken geblieben, die Grundfesten des Obrigkeitsstaates und die dazugehörigen Legitimations-Ideologien aber sind noch vorhanden, und zwar spätestens seit Otto Schilys Durchmarsch in den totalen Überwachungsstaat unerschütterlicher denn je.
Kapitalismuskritik - das größte Tabu
Vor allem aber, und darauf weist Herausgeber Eckart Spoo hin: Das größte Tabu in dieser Republik ist wieder, wie vor 68, jegliches Denken in System-Alternativen, jede Infragestellung der kapitalistischen Ordnung. Horkheimers Einsicht, auf die Spoo verweist - "Wer nicht vom Kapitalismus reden will, soll vom Faschismus schweigen" - macht die Crux dieser Tabuisierung deutlich. Heute ist wieder die Regression angesagt.
Wieder wird die Gebärpflicht der deutschen, wohlgemerkt deutschblütigen Frau beschworen. Mit bürokratisch anmaßenden Islamistentests und strunzdummen "Einbürgerungsfragebögen" wird völkische Ausgrenzung staatsverbindlich. Nach widerstandsloser Durchsetzung eines weltweiten militärischen Offensivkonzepts will die Regierung nun auch das Militär als Kampftruppe im Inneren einsetzen. Gegen Streiks und Demonstrationen zum Beispiel. Und breite Mehrheiten lassen sich ihre eigene soziale und zivile Entrechtung widerspruchslos gefallen: die alle Bereiche durchziehende Totalüberwachung ebenso wie die unverschämte Enteignung von Rentnern und Arbeitslosen.
Denn vor allem eines wurde damals und wird bis heute "tabuisiert" in diesem Deutschland: Aufstand, aufrechter Gang, Emanzipation, Widerstand.
Dieses Buch - über das Ossietzky sich gefreut hätte - aber könnte eine Bresche schlagen. Wenn es die heutigen Tabuverwalter nicht zu verhindern wissen.
Eckart Spoo, Hg.
"Tabus der deutschen Geschichte"
Verlag Ossietzky GmbH
Vordere Schöneworth 21
30167 Hannover
1.Aufl. 2006
ISBN 3-90808137-4-6
245 S.
15 Euro
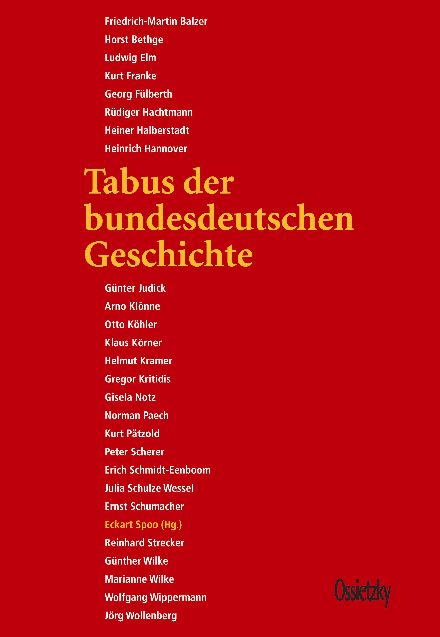
Foto: Verlag Ossietzky
Online-Flyer Nr. 44 vom 16.05.2006
"Tabus der deutschen Geschichte"
Ein Aufklärungsbuch
Von Hans-Detlev v. Kirchbach
Glücklich ist, wer vergißt...
"Wir wünschen und halten es für nötig, daß auch im neuen Jahr der Versuch gemacht wird, die aufbauwilligen Kräfte der Nationalsozialisten zu praktischer Mitwirkung zu bringen", bekundete die Kölnische Zeitung am 1. Januar 1933. Jenes Organ erschien in einem Verlagshause, dessen Rechtsnachfolger dem Vernehmen noch heute in dieser Stadt existieren sollen. Und schon sind wir beim Thema des vorzustellenden Buches und damit bei einem eben auch sehr kölnischen Thema, über dessen Nachwirkungen wir in der NRhZ in den letzten Wochen gelegentlich berichten mußten: Die "Tabus der bundesdeutschen Geschichte" - so der Titel des verdienstvollen und bitter notwendigen Sammelbandes - sie sind auch Kölner Tabus. Und diese Geschichte wirkt unmittelbar in die Gegenwart nach.
Warum also in die Ferne schweifen, liegt das Gute doch so nah. Denn von der bildungsbürgerlich kultivierten Ranschmeiße der alten Kölnischen Zeitung an die vermeintlich so ungehobelten Nazis, vom ungeduldigen Herbeirufen der faschistischen Diktatur durch´s gepflegte rheinpreußische Bürgerorgan, will man heute nicht nur im größten örtlichen Pressepalast ungern hören. Ob in Berlin oder Bayreuth, ob in München oder Köln, die noble Bürgergesellschaft diente sich den sogenannten "National-Sozialisten" an, auch weil man von ihnen "Dienste" erwartete - vor allem nämlich eine brutale Zerschlagung aller wirklich sozialistischen Regungen. Wer aber aus welchen Motiven den später so genannten "braunen Mob" geradezu an die Macht geschoben hatte, wollten die unbeschadet "restaurierten" besseren Kreise der frühen Bundesrepublik schnell vergessen machen.
So legte sich ein dicker Mantel aus Tabus über eine Geschichte, bei deren Anblick man vor sich selbst hätte frösteln müssen - und die doch immer wieder hochbrach. Sei es, daß die Nazivergangenheit eines schleswig-holsteinischen Landesministers hochwirbelte, der seinerseits wiederum einen Hauptverantwortlichen der "Euthanasie", den NS-Professor Heyde alias Sawade, wissentlich gedeckt hatte. Oder daß die Umtriebe "alter Kameraden", etwa des SS-Hilfswerks HIAG oder des nazi-militaristischen "Stahlhelm", im Ausland peinlich auffielen.
Arm in Arm: die alten Kameraden
Auch im Inland gab´s da schon mal Widerspruch, wie er im Buche steht, erzählt vom mittlerweile 80jährigen Anwalt Heinrich Hannover. Denn der hatte 1955 Gewerkschafter zu verteidigen, die sich herausgenommen hatten, im niedersächsischen Goslar gegen eine Zusammenrottung eben jenes "Stahlhelms" zu demonstrieren, bei der ein Generalfeldmarschall der Nazi-Wehrmacht eine Hetzrede hielt. Die Tabugesellschaft funktionierte ja nicht nur durchs einverständige Schweigen, sondern auch durchs gewaltsame Wegprügeln und Wegschließen jeden Widerspruchs. Und so verdrosch - man kennt das ja, findet auch Hannover, bis heute - die Polizei im Dienst der alten Kameraden die Antifaschisten und Gewerkschafter. Die landeten vor Gericht und wurden von den dortigen "Kameraden" verknackt, mit der Klarstellung, daß die so genannte Meinungs- und Versammlungsfreiheit, so Hannover, "nur den in Goslar versammelten Militaristen und dem von ihnen hofierten Hitler-General" zustand. Dieser Sumpf, befindet der Autor, werde seit über 50 Jahren polizeilich und gerichtlich geschützt. "Aber es gibt geschichtsblinde Politiker und Publizisten, die ernsthaft fragen, woher die neonazistischen Kriegsflaggenträger kommen", beschreibt Hannover die anhaltenden Langzeitwirkungen der alten Tabuisierung, der sich neue hinzugesellt hat.
Schweigezeit
In der künstlichen Glasglocke der bundesrepublikanischen Restauration herrschte öffentliches "Beschweigen", umkleidet vom staatsoffiziellen Wegphrasieren im "Jargon der Eigentlichkeit". Im Familienkreise wiederum steigerte sich der Flüsterton vielleicht mal nach dem dritten Bier in kriegsmäßiges Poltern, so daß etwa der Rezensent schon als Achtjähriger mit dem Begriff "Flintenweiber" wohl vertraut war und irgendwie wußte, daß der Russe böse ist. Nur Störenfriede wie Wolfgang Staudte überreichten der selbstvergessenen westdeutschen Gesellschaft im allgemeinen und der selbstgerechten westdeutschen Justiz im besonderen angemessen dornige "Rosen für den Staatsanwalt". Diese "Tabus" sind zwar durchbrochen, seit die 68er das allgemeine Raunen schrill überschrieen. Doch statt des allgemeinen Tabus hat sich das individuelle durchgesetzt: Die anderen waren schlimm, aber bei uns gab es so etwas nicht. Zum Beispiel, wenn es, sagen wir, um das Thema "Arisierung" geht.
Doch widersteht der Sammelband der Versuchung, seinerseits an "linken" Mythen zu stricken. Etwa dem, daß nur die "herrschende Klasse" an allem schuld war und die Mehrheit nur in der Opferposition. Denn kaum war das Nazisystem etabliert, konnte es auch auf Massenkonsens bauen. Einen Konsens, der nicht nur auf aktuelle "Erfolge" zurückging, sondern nach Auffassung zum Beispiel der Sozialwissenschaftlerin Julia Schulze-Wessel sehr wohl auch auf tief verwurzelte Grundhaltungen, die die Nazis nur anzutippen und "aufzurufen" brauchten - vor allem nämlich den Antisemitismus. Dankenswerterweise - wenn auch daher sicher nicht zum Vergnügen aller LeserInnen - hat Schulze-Wessel in ihrem Beitrag "Schuld und Verleugnung - Funktion und Erscheinungsformen des Antisemitismus in der deutschen Nachkriegsgesellschaft" zumindest beiläufig auch auf linke, aber nicht minder "nationaltherapeutische" Verdrängungsleistungen hingewiesen. Diese ortet sie in staatlich organisierter Form zunächst einmal in der guten alten DDR:
"...Die reduzierte Faschismusanalyse, der zufolge das Großkapital mit Hilfe einer kleinen Clique Herrschender die Verbrechen zu verantworten habe, ließ im nachhinein die meisten Deutschen als Verführte und letztlich selbst als Opfer erscheinen. Damit entfiel eine wichtige Dimension in der Auseinandersetzung mit der Geschichte der NS-Verbrechen und der Vernichtung der europäischen Juden: die persönliche Auseinandersetzung jedes Einzelnen mit seiner persönlichen Verantwortung und Schuld."
Der zweite Schock der Emigranten
Was vor allem heimkehrende EmigrantInnen wie etwa Theodor W. Adorno zutiefst entsetzte, war ja nicht nur der Tatbestand, daß Gestalten wie Globke, Oberländer & Co. an zentralen Schaltstellen von Staat und Gesellschaft der Bundesrepublik ungebrochene Elite-Kontinuitäten verkörperten. Vielmehr stellte für sie "das allgemeine Verhalten in Deutschland" einen, so die Autorin, "zweiten Schock" nach dem Bekanntwerden der Vernichtungslager dar. Die herrschende "Restauration" fand von auch "unten" ihr Fundament: eben in jenem bis in viele Familienverästelungen verbreiteten "allgemeinen Verhalten", das sich in Charakteristika ausdrückte wie "ständig wiederkehrenden Versuchen, die Schuld bei anderen zu suchen, Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid anderer Menschen und Ignoranz der eigenen schuldhaften Verstrickungen". Die von den Nazis betriebene Suggerierung einer "Schicksalsgemeinschaft" auf Leben und Tod wirkte bei der Heimkehrergeneration auf anderer Ebene weiter: Bloß nicht dran rühren, Ruhe haben. So konnte das reaktionäre Führungspersonal der Bundesrepublik die Wiederbewaffnung durchsetzen, die Frauen wieder an Heim und Herd verbannen, und sich überhaupt manch Unglaubliches leisten. Mit am schlimsten in der Justiz.
Es richten die Rechten
Das Blut an den Roben der deutschen Rechtswahrer war noch nicht getrocknet, und schon wagte es der NS-Nachfolgestaat, NS-belastete Chargen auf die höchsten Richterposten zu hieven. Zum Beispiel Herrmann Weinkauff, ehemals Richter am Nazi-"Reichsgericht" zu Leipzig, der zum Präsidenten des Bundesgerichtshofs avancierte. In seiner Antrittsrede verlor der allerchristlichste Herr Gerichtspräsident nicht ein Wort an die Opfer des Faschismus und seiner Mordjustiz, beschwor statt dessen mit süßlichem Timbre die "Blutsbande" der Blutjuristen:
"Noch fehlen allerdings Brüder, die ihren Platz in unserer Mitte haben sollten. Niemand wäre glücklicher als wir, wenn sie bald gemeinsam mit uns am gemeinsamen deutschen Rechte arbeiten könnten."
Weinkauffs Ruf fand Gehör, und so schafften es die alten "Brüder" von Volks-, Reichs- und Sondergerichten bald wieder in Spitzenstellungen der "demokratischen Rechtspflege". Mit einschlägigen Resultaten: Weinkauffs BGH erhob 1954 zwar die "Verlobtenkuppelei" in einem heute nur noch als Satire lesbaren Urteil zu einem schweren Vergehen wider Sitte, Moral und "Abendland", sprach dafür aber aber reihenweise Naziverbrecher aus dem Kreise von Wehrmacht, Polizei und selbstredend Justiz frei. "Das Wirken des Bundesgerichtshofs war schauerlich", so bewertet heute Ralph Giordano diese Epoche der bundesdeutschen Rechtsgeschichte.
Zweites Beispiel, das Otto Köhler der Tabuisierung entreißt: Hermann Höpker-Aschoff, erster Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Noch wenige Jahre zuvor hatte der Hüter unserer demokratischen Verfassung als, so Autor Köhler, "hochrangiger Mitarbeiter der Leichenfledderer und Plünderungsspezialisten" gewirkt. In den Jahren des Tabus war Höpker-Aschoff Leiter der Abteilung IV - "Vermögensverwaltung des ehemaligen polnischen Staates" - bei der Nazi- "Haupttreuhandstelle Ost". In dieser Funktion half er jenem Staat, der vor dem Grundgesetz existierte, bei der Ausplünderung polnischer und insbesondere jüdischer Vermögenswerte, vulgo "Arisierung". Nach Inkrafttreten unseres rechtsstaatlichen Grundgesetzes schönte man einfach Höpker-Aschoffs Lebenslauf. Unser demokratischer Rechtsstaat behauptet offiziell bis heute, der Rechtsprofessor und ehemalige preußische Finanzminister (1925-1931) habe sich im 3. Reich ins "Privatleben" zurückgezogen. Tabus der deutschen Geschichte - sie bleiben Tabus der bundesdeutschen Gegenwart; nicht immer, aber oft.
Offensive der Gegenaufklärung
Kein Wunder, denn wenn wir im Rechtssystem und direkt beim Bundesverfassungsgericht bleiben: Die "verweigerte Selbstaufklärung der Justiz", so der pensionierte Richter am Oberlandesgericht Braunschweig und unermüdliche rechtshistorische Aufklärer Helmut Kramer in seinem gleichlautenden Beitrag, findet dem Autor zufolge gerade in der Hochjustiz längst wieder scharf konturierte Protagonisten. Wie zum Beispiel den einflußreichen Verfassungsrichter Udo di Fabio. Der möchte die dumme "tausendjährige" Geschichte am liebsten gleich ganz umschreiben, und zwar so, wie man sie in den güldenen fünfziger Jahre gern gehabt hätte.
Mit schwerem altem Mythendunst aus einer ganz großen rhetorischen Nebelmaschine möchte Udo di Fabio alle zwischenzeitliche historisch-kritische Aufklärung wegblasen. Und aus dem magischen Urgrund der bundesdeutschen Gründungslegenden soll wieder der vereinzelte und letztlich schicksalhaft unbegreifliche, alienhafte "Dämon" Adolf auferstehen, der ganz und gar im Alleingang das treudeutsche Volk "behext" und "verführt" habe, so wie eine "zu verführende Frau". Hitler war, so einer der höchsten Richter dieses Staates, überhaupt kein Deutscher; er war nur "ein verkleideter Deutscher". So sind´s also wieder mal die anderen, welche auch immer, gewesen, und "wir" können beruhigt zur Tagesordnung übergehen - auf der laut di Fabio die Aufrüstung der "nationalen Identität" zu stehen habe.
Solche beiläufigen Beispiele zeigen, warum wir heute so manchmal meinen könnten, eine Zeitmaschine hätte uns zurück in die Fünfziger gebeamt. Es muß jedenfalls seinen Grund haben, warum ein offener Reaktionär wie Udo di Fabio eine Schaltstelle in diesem Staat besetzen kann. Emanzipation und Aufklärung nach 1968 sind in den Ansätzen stecken geblieben, die Grundfesten des Obrigkeitsstaates und die dazugehörigen Legitimations-Ideologien aber sind noch vorhanden, und zwar spätestens seit Otto Schilys Durchmarsch in den totalen Überwachungsstaat unerschütterlicher denn je.
Kapitalismuskritik - das größte Tabu
Vor allem aber, und darauf weist Herausgeber Eckart Spoo hin: Das größte Tabu in dieser Republik ist wieder, wie vor 68, jegliches Denken in System-Alternativen, jede Infragestellung der kapitalistischen Ordnung. Horkheimers Einsicht, auf die Spoo verweist - "Wer nicht vom Kapitalismus reden will, soll vom Faschismus schweigen" - macht die Crux dieser Tabuisierung deutlich. Heute ist wieder die Regression angesagt.
Wieder wird die Gebärpflicht der deutschen, wohlgemerkt deutschblütigen Frau beschworen. Mit bürokratisch anmaßenden Islamistentests und strunzdummen "Einbürgerungsfragebögen" wird völkische Ausgrenzung staatsverbindlich. Nach widerstandsloser Durchsetzung eines weltweiten militärischen Offensivkonzepts will die Regierung nun auch das Militär als Kampftruppe im Inneren einsetzen. Gegen Streiks und Demonstrationen zum Beispiel. Und breite Mehrheiten lassen sich ihre eigene soziale und zivile Entrechtung widerspruchslos gefallen: die alle Bereiche durchziehende Totalüberwachung ebenso wie die unverschämte Enteignung von Rentnern und Arbeitslosen.
Denn vor allem eines wurde damals und wird bis heute "tabuisiert" in diesem Deutschland: Aufstand, aufrechter Gang, Emanzipation, Widerstand.
Dieses Buch - über das Ossietzky sich gefreut hätte - aber könnte eine Bresche schlagen. Wenn es die heutigen Tabuverwalter nicht zu verhindern wissen.
Eckart Spoo, Hg.
"Tabus der deutschen Geschichte"
Verlag Ossietzky GmbH
Vordere Schöneworth 21
30167 Hannover
1.Aufl. 2006
ISBN 3-90808137-4-6
245 S.
15 Euro
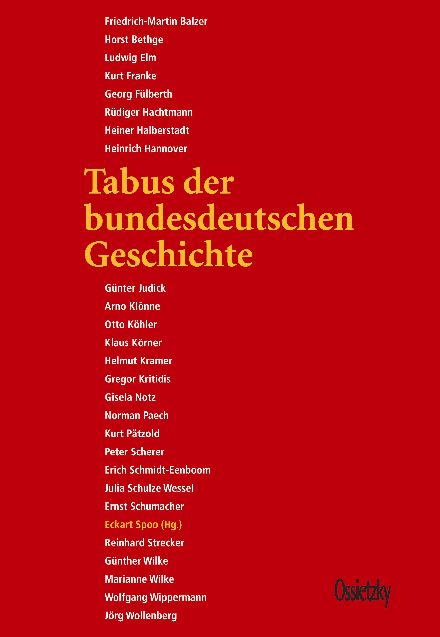
Foto: Verlag Ossietzky
Online-Flyer Nr. 44 vom 16.05.2006















