SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Kultur und Wissen
Interview mit dem Verleger Hans-Joachim Gelberg
"Das Wichtigste für einen Verlag sind die Autoren"
Von Wolfgang Bittner
Wolfgang Bittner: Ihr Name ist zum Markenzeichen für eine Buchreihe geworden, die eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen begleitet hat: Beltz & Gelberg. Wie hat das damals angefangen?
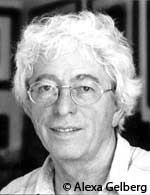 Hans-Joachim Gelberg: Ich bin 1971 nach Weinheim gekommen und habe dort zusammen mit dem Verleger Dr. Beltz Rübelmann im Rahmen des pädagogischen Beltz Verlages das Programm Beltz & Gelberg begründet, ein Programm mit neuen, modernen Kinderbüchern. Es war die Absicht - und das ist sicher gelungen - der Kinderliteratur ganz neue Impulse zu geben, neue Autoren zu gewinnen und neue Themen zu finden.
Hans-Joachim Gelberg: Ich bin 1971 nach Weinheim gekommen und habe dort zusammen mit dem Verleger Dr. Beltz Rübelmann im Rahmen des pädagogischen Beltz Verlages das Programm Beltz & Gelberg begründet, ein Programm mit neuen, modernen Kinderbüchern. Es war die Absicht - und das ist sicher gelungen - der Kinderliteratur ganz neue Impulse zu geben, neue Autoren zu gewinnen und neue Themen zu finden.
Woher kommt Ihr Interesse für die Kinder- und Jugendliteratur? Haben Sie schon als Kind viel gelesen - wie war Ihre familiäre Situation?
Ich bin 1930 in Dortmund geboren, mein Vater war Postbeamter und wir hatten eine bürgerliche Umwelt. Ich habe sehr früh mit Literatur angefangen, erinnere mich, dass ich als Kind einmal meine Märklin-Autos gegen ein Buch eingetauscht habe; es war Tom Sawyer von Mark Twain. Also, schon damals war das Buch für mich wertvoller als so ein Spielzeug, und ich bin zeitlebens Leser geblieben.
Wie sind Sie in der Kriegs- und Nachkriegszeit an Bücher herangekommen?
Meine Familie, das heißt also meine Eltern mit mir und meiner Schwester, mussten damals Wien, wo wir vorübergehend gelebt hatten, verlassen und wir kamen in Lüdenscheid bei einer Tante unter. Da gab es eine Riesenbibliothek und ich hatte das Glück, von morgens bis abends lesen zu können - die Schule hatte damals noch nicht wieder angefangen. Ich habe diesen Bücherschrank von A bis Z durchgearbeitet und war gerade bei Dostojewskis Raskolnikow angelangt, als mein Onkel aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam, mich an den Ohren hochzog und sagte: "Was liest du denn da? Das ist noch nichts für dich." Er nahm mir das Buch weg, aber ich hatte sowieso schon fast alles gelesen, einschließlich der Casanova-Ausgabe.
Haben Sie auch Kinderbücher gelesen?
Damals gab es wenig Kinderliteratur, und die es gab, habe ich nicht gelesen, kann mich jedenfalls nicht erinnern. Die großen klassischen Kinderbücher wie "Die Schatzinsel" sind bei mir nicht vorgekommen. Ich habe die gesamte moderne und auch die alte Kinderliteratur erst als Erwachsener gelesen. In meiner Wiener Zeit habe ich allerdings Karl May gelesen; das war eine meiner wichtigsten Lektüren als Kind.
Hat Sie die Lektüre von Karl May in irgendeiner Weise und in irgendeiner Richtung beeinflusst?
O ja. Ich saß mit einem Freund an der Karlsbrücke auf der Mauer und wir ließen die Beine baumeln - beide Karl-May-Leser - und spannen uns einen großen Roman, den wir schreiben wollten: ein Karl-May-Plagiat sozusagen. Aber das ist natürlich nie geschrieben worden.
Was hat Sie denn seinerzeit geistig angeregt und beeinflusst?
Ich war als kleines Kind ein Spielkind. Ich hab viel für mich selbst gemacht, Spiele erfunden, große Szenarien aufgebaut und dramatische Spiele mit Holzpuppen und dergleichen gemacht. Später waren es dann wohl Eindrücke, die von außen kamen: die Natur, der Wald; letzten Endes war es aber immer wieder die Literatur. Ich wollte schon als Zehn-, Elf-, Zwölfjähriger Romane schreiben, ich wollte ein großer Dichter werden; ich stellte mir vor, dass ich eines Tages sehr berühmt sein würde - also diese Spinnereien, die man als Kind so hat.
Wie haben Sie dann im Alter von 17 Jahren Ihren Beruf gefunden?
Da ich dauernd las, sagte mein Vater, nachdem ich mich weigerte das Abitur zu machen - ich hasste die Schule -: "Am besten der Junge wird Buchhändler." Ich wurde also 1948 bei einer Buchhandlung angemeldet, das war nach der Währungsreform, und der Buchhandel rationierte die Bücher. Die Verlage schickten nur bestimmte Mengen, weil das Papier fehlte. Da ich nun als Lehrling immer die Buchpakete auspackte, kam ich als erster an die Bücher heran und fing an, mir eine eigene Bibliothek aufzubauen, kaufte viele Bücher, die ich auch las.
Was waren das für Bücher, die Sie gelesen haben?
Das waren die modernen Amerikaner, die seinerzeit übersetzt wurden. Es kamen Rowohlts Rotationsromane heraus, diese Zeitungsformate mit amerikanischen und englischen Autoren, Graham Greene zum Beispiel und viele andere, eine Literatur, die ich bis dahin nicht kannte. Ich habe zu dieser Zeit viel Lyrik gelesen, selber natürlich auch Gedichte gemacht - das gehört dazu -, und ich habe diese Buchhändlerlehre wie eine Universität benutzt, ich wurde sehr kundig.
Gab es dabei eine Anleitung, einen Lehrer oder Mentor, der Sie gefördert hat?
Das ist eine eher autodidaktische Entwicklung gewesen. Ich bin über die Literatur an diesen Beruf gekommen, den ich leidenschaftlich gern gemacht habe, war dann in Dortmund bei der Buchhandlung Borgmann, die es nicht mehr gibt, Gehilfe. Diese Buchhandlung hatte einen katholischen Hintergrund, aber es war die modernste in Dortmund. Man ging einfach zu Borgmann, um gute Literatur zu kaufen, einschließlich derjenigen, die ich unter dem Ladentisch verkaufte, zum Beispiel Henry Miller, dessen Romane zu der Zeit teils verboten waren.
Wie lange waren Sie Buchhändler und was haben Sie anschließend gemacht?
Einschließlich der Lehrzeit war ich 15 Jahre Buchhändler, und in dieser Zeit einige Jahre Fachlehrer. Ich habe Buchhandelslehrlinge an der Berufsschule unterrichtet, und das war für mich gleichzeitig der Sprung in eine neue Möglichkeit. Ich wollte weiterkommen und wurde Lektor, zuerst im Arena Verlag in Würzburg. Von da an war meine verlegerische Tätigkeit in Vorbereitung.
Wohin sind Sie von Würzburg aus gegangen?
 Ich wurde Lektor im Georg Bitter Verlag in Recklinghausen, einem Verlag, der sich mit der Gruppe 61 identifizierte, also mit Autoren wie Günter Wallraff und Max von der Grün. Es gab dort Kinderbücher, wofür ich eingestellt wurde, und auch pädagogische und theologische Sachbücher. Ich hatte das Glück im Unglück, dass der Cheflektor krank wurde und nicht wiederkam, so dass ich das gesamte Programm steuern musste. Mein erstes Buch war ein Eheführer: "Vollendung ehelicher Liebe" von einem katholischen Arzt, der mehr oder weniger warnend das kranke Geschlechtsleben schilderte. Da ich im Manuskriptschrank unter den vielen hundert Manuskripten kein einziges gescheites sonst fand, habe ich das mit dem Autor umgeschrieben - viel Arbeit - und ein erfolgreiches sehr positives Buch für katholische Eheleute daraus gemacht.
Ich wurde Lektor im Georg Bitter Verlag in Recklinghausen, einem Verlag, der sich mit der Gruppe 61 identifizierte, also mit Autoren wie Günter Wallraff und Max von der Grün. Es gab dort Kinderbücher, wofür ich eingestellt wurde, und auch pädagogische und theologische Sachbücher. Ich hatte das Glück im Unglück, dass der Cheflektor krank wurde und nicht wiederkam, so dass ich das gesamte Programm steuern musste. Mein erstes Buch war ein Eheführer: "Vollendung ehelicher Liebe" von einem katholischen Arzt, der mehr oder weniger warnend das kranke Geschlechtsleben schilderte. Da ich im Manuskriptschrank unter den vielen hundert Manuskripten kein einziges gescheites sonst fand, habe ich das mit dem Autor umgeschrieben - viel Arbeit - und ein erfolgreiches sehr positives Buch für katholische Eheleute daraus gemacht.
Sie haben dann vor allem Kinderliteratur verlegt.
Ja, das erste Kinderbuch von Peter Härtling kam in meinem Programm; ich lernte Josef Guggenmos kennen, und das Buch "Was denkt die Maus am Donnerstag" erschien; ich arbeitete mit dem jungen Wallraff zusammen, und eine seiner ersten Geschichten hat mein Lektorat. Hinzu kamen meine ersten Anthologien mit zum Teil unbekannten Autoren, ich konnte aber auch Preußler und Ende dafür gewinnen.
Sie hatten also beim Georg Bitter Verlag die Möglichkeit, sich intensiver in die Kinderliteratur einzuarbeiten?
Ja, ich war fünf Jahre im Bitter Verlag und er erhielt in dieser Zeit viermal den deutschen Jugendbuchpreis, was sensationell war. Ich war als junger Lektor sozusagen schon der King der Kinderliteratur, und das war wohl der Anlass für Dr. Beltz Rübelmann, mich für ein eigenes Programm zu holen. Ich begann unter dem orangefarbenen Gewand, einer Art Signalfarbe, dieses Programm Beltz & Gelberg zu etablieren, das zu einem Türöffner für die neue, moderne Kinderliteratur wurde.
Wie war die ökonomische Situation des Verlages?
Nach dem ersten Jahr hatte ich einen Umsatz von einer Million, später schwoll das auf 18 Millionen an. Zuerst war das ein Alleingang. Ich machte die Typografie, lektorierte die Bücher, besorgte die Illustrationen, machte die Werbung und die Pressearbeit, bis der Verlag größer wurde und ich Mitarbeiter einstellen konnte.
Sie hatten bestimmte Intentionen und Vorstellungen für die verlegerische Arbeit ...
Mir wurde sehr schnell klar, dass ich nur eine Marktchance habe, wenn ich das, was ich am besten kann und wollte, auch mache: eine moderne Kinderliteratur, die den Versuch macht, Kinder und Erwachsene auf eine Stufe zu bringen, Kinder ernst zu nehmen, ihnen beizubringen, dass sie in dieser Welt eine Möglichkeit haben mitzureden. Ich machte zum Beispiel das "Neinbuch"; es begann ja auch die antiautoritäre Kinderliteratur, ich war ein bisschen ein Rädelsführer dieser Entwicklung. Der Handel hat das zuerst skeptisch beurteilt, aber dann kam mit der Bildungsreform und einer Veränderung der Pädagogik ein Bedürfnis nach dieser Art von Kinderbüchern auf, mein Programm wurde führend, war begehrt und wurde bald auch nachgeahmt.
Hat Sie die 68er-Bewegung beeinflusst?
Natürlich hat mich die Zeitströmung damals beeinflusst, das neue Denken in der Literatur und Politik. Man kann Bücher sowieso nur aus seinem Umfeld heraus machen. Damals veränderte sich die Pädagogik, unser Verhältnis zu Kindern, infolgedessen auch die Literatur. Kinderliteratur ist immer eine Folge dessen, was in der Gesellschaft passiert. Unter anderem machte ich damals mit Janosch Märchen, die neu und aufklärerisch erzählt wurden; wir begannen Märchen neu zu erfinden, und das hat ja Auswirkungen bis in die Gegenwart.
In letzter Zeit gibt es einen starken Trend zur fantastischen Literatu,r und die realistische Literatur ist dadurch sehr ins Hintertreffen geraten. Wie sehen Sie das?
Ich begann mit realistischen Büchern, die natürlich auch ihre fantastischen Seiten haben. Aber es gibt ja immer wieder andere Trends, jetzt eben das Fantastische mit den großen Vorbildern wie Tolkien und mit Büchern, die eine Welle hervorgerufen haben wie die Harry-Potter-Romane. Dass dieser Trend so stark durchgeschlagen hat, ist ein großes Problem, denn es gibt anderen Büchern nebenher wenig Chancen. Natürlich wird sich dieser Trend wieder ändern, aber leider verfolgen viele Verlage keine eigenen Programmideen, sondern sie machen das nach, was "in" ist. Die Harry-Potter-Welle bedeutet, dass alle Verlage plötzlich in diese Richtung arbeiten und auch Autoren so schreiben. Aber in einem Verlag müssen eigene Ideen und Vorstellungen entwickelt und auf dem Markt durchgesetzt werden. Natürlich weiß der Markt zunächst nichts davon, man muss ihm etwas geben. Ich habe immer wieder solche neuen Ideen verwirklicht, eine Taschenbuchreihe angefangen oder das Magazin "Der bunte Hund" gegründet.
Wie war Ihr Verhältnis zu den von Ihnen verlegten Autoren?
Das Wichtigste für einen Verlag sind die Autoren, beim Bilderbuch selbstverständlich auch die Künstler. Die Autoren zu pflegen ist die erste Aufgabe eines Verlags, denn ohne Autoren ist der Verlag nichts wert. Das habe ich immer beherzigt. Ein junger Autor, der ja nicht sofort eine Erfolgsgeschichte schreiben kann, muss aufgebaut werden. Es passiert immer wieder, dass ein Autor mit einem Buch startet, und es wird kein sonderlicher Erfolg. Aber wenn man die Überzeugung hat, dass sich da etwas entwickeln kann, bedeutet das für den Verlag, dass er anfangs vielleicht nur schlappe, möglicherweise nicht verkaufte Auflagen hat, ein hohes Risiko also. Ich habe das oft gemacht, Autoren aufgebaut, die zuerst keine großen Markterfolge hatten, wie zum Beispiel Mirjam Pressler, inzwischen aber durch Preise und Öffentlichkeitsarbeit bekannt geworden sind.
Viele Verlagsprogramme werden von Übersetzungen dominiert. Wie stehen Sie dazu?
Zum Programm gehören natürlich auch Übersetzungen, die Weltliteratur ist auch beim Kinderbuch seit langem eingekehrt. Aber in der Tat gibt es viele Verlage, die fast ausschließlich Übersetzungen bringen. Das ist auf die Dauer nicht gut. Ein Verlag muss eigene Autoren haben, und zwar mit allen Rechten, die er dabei erwirbt. Bei den Übersetzungen erwirbt man ja keine weiteren Rechte und das ist letzten Endes auch nicht so lukrativ.
Wie sieht es mit der Kritik im Kinder- und Jugendbuch aus?
Die Literaturkritik befasst sich in erster Linie mit der Erwachsenenliteratur. Das ist eine große Schwierigkeit. Es gibt zwar eine Kritik der Kinderliteratur in unseren Medien, aber nur in Randbezirken, sehr sparsam und noch dazu in Form von Lobkritiken. Das ist keine echte Literaturkritik, die erforderlichenfalls auch herausstellt, was nicht gut ist. Wenn ich beispielsweise an "Tintenherz" von Cornelia Funke denke, das ich vor einiger Zeit rezensiert habe, dann muss man sagen, dass dieses Erfolgsbuch, das eine riesige Auflage hat und bei Kindern sehr begehrt ist, literarisch-kritisch gesehen ein triviales Buch ist. So etwas müsste beleuchtet werden, aber das findet selten statt.
Sie haben sich zeitweise selber um den Vertrieb gekümmert. Mögen Sie verraten, worauf es dabei ankommt?
Programmverlage, in denen engagierte Literatur erscheint, also keine Trivialliteratur, sondern Bücher, die Anforderungen an den Leser stellen, haben das Problem, an den Leser oder den Käufer solcher anspruchsvolleren Bücher heranzukommen. Ich habe meine Bücher deswegen immer erkennbar gehalten, anfangs durch diese orangene Farbe. Ich habe selber mit vielen Buchhändlern gesprochen, mit Journalisten, Redaktionen und versucht Überzeugungsarbeit zu leisten. Information ist das Wichtigste für den Verkauf von Büchern.
Nun sind viele Bücher heutzutage nur kurze Zeit auf dem Markt ...
 Wir haben streng genommen eine Überproduktion. Die Verlage machen generell zu viele Bücher, immer in der Hoffnung, dass darunter ein "Seller" ist. Es wird sozusagen ein Netz ausgeworfen und man hofft, damit einen dicken Fisch zu fangen. Dafür werden viele Fische in den Teich geschmissen, also Bücher, die oft schon nach einem halben Jahr wieder verramscht werden. Das ist ein großes Problem. Der Buchhändler muss erleben, dass sein Bestand schnell veraltet und keinen Wert mehr hat; deshalb kauft er vorsichtig ein. Die Verlage müssen lernen - heute mehr denn je -, dass Bücher Verantwortung bedeuten. Man darf nicht einfach mal so Bücher machen, weil sie sich gerade gut verkaufen oder weil sie einem Trend folgen. Man muss selber von den Büchern, die man macht, überzeugt sein. Bücher, die man woanders abgeguckt hat oder die kopiert sind, sollten am besten verschwinden.
Wir haben streng genommen eine Überproduktion. Die Verlage machen generell zu viele Bücher, immer in der Hoffnung, dass darunter ein "Seller" ist. Es wird sozusagen ein Netz ausgeworfen und man hofft, damit einen dicken Fisch zu fangen. Dafür werden viele Fische in den Teich geschmissen, also Bücher, die oft schon nach einem halben Jahr wieder verramscht werden. Das ist ein großes Problem. Der Buchhändler muss erleben, dass sein Bestand schnell veraltet und keinen Wert mehr hat; deshalb kauft er vorsichtig ein. Die Verlage müssen lernen - heute mehr denn je -, dass Bücher Verantwortung bedeuten. Man darf nicht einfach mal so Bücher machen, weil sie sich gerade gut verkaufen oder weil sie einem Trend folgen. Man muss selber von den Büchern, die man macht, überzeugt sein. Bücher, die man woanders abgeguckt hat oder die kopiert sind, sollten am besten verschwinden.
Sie sind nun seit einiger Zeit im Ruhestand. Wie gefällt Ihnen das?
Ich bin 1997 nach 27 Jahren Beltz & Gelberg und 50 Berufsjahren aus dem täglichen Erwerbsleben ausgeschieden, bin Rentner - so nennt man das wohl - und habe endlich Zeit, mich mit Büchern zu befassen, die ich nicht beruflich lesen oder redigieren muss. Natürlich habe ich nicht aufgehört, mich für Kinderliteratur zu interessieren. Ich halte Vorträge, betreue noch einige Autoren weiter und hatte außerdem einen Lehrauftrag an der Frankfurter Universität. So ist jeder Tag spannend und literaturträchtig; abgesehen von meiner Familie, insbesondere meinen Enkelkindern, die ich oft bei mir habe. Kinder haben uns viel zu sagen, wir müssen nur zuhören, und Kinderliteratur bedeutet schließlich, dass sie sich intensiv mit Kindheit beschäftigt. Kindheit ist eine der wichtigsten Zeiten im Leben des Menschen und wir müssen alles tun, dass Kinder glückliche Kindheiten haben und auch gute Kinderbücher.
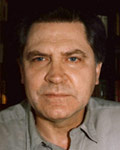 (Eine Sammlung mit Interviews von Persönlichkeiten der Zeitgeschichte erscheint demnächst in Zusammenarbeit mit dem WDR unter dem Titel "Ich mische mich ein")
(Eine Sammlung mit Interviews von Persönlichkeiten der Zeitgeschichte erscheint demnächst in Zusammenarbeit mit dem WDR unter dem Titel "Ich mische mich ein")
Mehr über Hans-Joachim Gelberg und seinen Gesprächspartner Wolfgang Bittner unter: www.beltz.de und www.wolfgangbittner.de
Wolfgang Bittner
Foto: NRhZ-Archiv
Online-Flyer Nr. 31 vom 14.02.2006
Interview mit dem Verleger Hans-Joachim Gelberg
"Das Wichtigste für einen Verlag sind die Autoren"
Von Wolfgang Bittner
Wolfgang Bittner: Ihr Name ist zum Markenzeichen für eine Buchreihe geworden, die eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen begleitet hat: Beltz & Gelberg. Wie hat das damals angefangen?
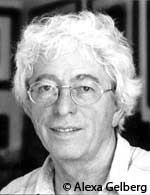 Hans-Joachim Gelberg: Ich bin 1971 nach Weinheim gekommen und habe dort zusammen mit dem Verleger Dr. Beltz Rübelmann im Rahmen des pädagogischen Beltz Verlages das Programm Beltz & Gelberg begründet, ein Programm mit neuen, modernen Kinderbüchern. Es war die Absicht - und das ist sicher gelungen - der Kinderliteratur ganz neue Impulse zu geben, neue Autoren zu gewinnen und neue Themen zu finden.
Hans-Joachim Gelberg: Ich bin 1971 nach Weinheim gekommen und habe dort zusammen mit dem Verleger Dr. Beltz Rübelmann im Rahmen des pädagogischen Beltz Verlages das Programm Beltz & Gelberg begründet, ein Programm mit neuen, modernen Kinderbüchern. Es war die Absicht - und das ist sicher gelungen - der Kinderliteratur ganz neue Impulse zu geben, neue Autoren zu gewinnen und neue Themen zu finden.Woher kommt Ihr Interesse für die Kinder- und Jugendliteratur? Haben Sie schon als Kind viel gelesen - wie war Ihre familiäre Situation?
Ich bin 1930 in Dortmund geboren, mein Vater war Postbeamter und wir hatten eine bürgerliche Umwelt. Ich habe sehr früh mit Literatur angefangen, erinnere mich, dass ich als Kind einmal meine Märklin-Autos gegen ein Buch eingetauscht habe; es war Tom Sawyer von Mark Twain. Also, schon damals war das Buch für mich wertvoller als so ein Spielzeug, und ich bin zeitlebens Leser geblieben.
Wie sind Sie in der Kriegs- und Nachkriegszeit an Bücher herangekommen?
Meine Familie, das heißt also meine Eltern mit mir und meiner Schwester, mussten damals Wien, wo wir vorübergehend gelebt hatten, verlassen und wir kamen in Lüdenscheid bei einer Tante unter. Da gab es eine Riesenbibliothek und ich hatte das Glück, von morgens bis abends lesen zu können - die Schule hatte damals noch nicht wieder angefangen. Ich habe diesen Bücherschrank von A bis Z durchgearbeitet und war gerade bei Dostojewskis Raskolnikow angelangt, als mein Onkel aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam, mich an den Ohren hochzog und sagte: "Was liest du denn da? Das ist noch nichts für dich." Er nahm mir das Buch weg, aber ich hatte sowieso schon fast alles gelesen, einschließlich der Casanova-Ausgabe.
Haben Sie auch Kinderbücher gelesen?
Damals gab es wenig Kinderliteratur, und die es gab, habe ich nicht gelesen, kann mich jedenfalls nicht erinnern. Die großen klassischen Kinderbücher wie "Die Schatzinsel" sind bei mir nicht vorgekommen. Ich habe die gesamte moderne und auch die alte Kinderliteratur erst als Erwachsener gelesen. In meiner Wiener Zeit habe ich allerdings Karl May gelesen; das war eine meiner wichtigsten Lektüren als Kind.
Hat Sie die Lektüre von Karl May in irgendeiner Weise und in irgendeiner Richtung beeinflusst?
O ja. Ich saß mit einem Freund an der Karlsbrücke auf der Mauer und wir ließen die Beine baumeln - beide Karl-May-Leser - und spannen uns einen großen Roman, den wir schreiben wollten: ein Karl-May-Plagiat sozusagen. Aber das ist natürlich nie geschrieben worden.
Was hat Sie denn seinerzeit geistig angeregt und beeinflusst?
Ich war als kleines Kind ein Spielkind. Ich hab viel für mich selbst gemacht, Spiele erfunden, große Szenarien aufgebaut und dramatische Spiele mit Holzpuppen und dergleichen gemacht. Später waren es dann wohl Eindrücke, die von außen kamen: die Natur, der Wald; letzten Endes war es aber immer wieder die Literatur. Ich wollte schon als Zehn-, Elf-, Zwölfjähriger Romane schreiben, ich wollte ein großer Dichter werden; ich stellte mir vor, dass ich eines Tages sehr berühmt sein würde - also diese Spinnereien, die man als Kind so hat.
Wie haben Sie dann im Alter von 17 Jahren Ihren Beruf gefunden?
Da ich dauernd las, sagte mein Vater, nachdem ich mich weigerte das Abitur zu machen - ich hasste die Schule -: "Am besten der Junge wird Buchhändler." Ich wurde also 1948 bei einer Buchhandlung angemeldet, das war nach der Währungsreform, und der Buchhandel rationierte die Bücher. Die Verlage schickten nur bestimmte Mengen, weil das Papier fehlte. Da ich nun als Lehrling immer die Buchpakete auspackte, kam ich als erster an die Bücher heran und fing an, mir eine eigene Bibliothek aufzubauen, kaufte viele Bücher, die ich auch las.
Was waren das für Bücher, die Sie gelesen haben?
Das waren die modernen Amerikaner, die seinerzeit übersetzt wurden. Es kamen Rowohlts Rotationsromane heraus, diese Zeitungsformate mit amerikanischen und englischen Autoren, Graham Greene zum Beispiel und viele andere, eine Literatur, die ich bis dahin nicht kannte. Ich habe zu dieser Zeit viel Lyrik gelesen, selber natürlich auch Gedichte gemacht - das gehört dazu -, und ich habe diese Buchhändlerlehre wie eine Universität benutzt, ich wurde sehr kundig.
Gab es dabei eine Anleitung, einen Lehrer oder Mentor, der Sie gefördert hat?
Das ist eine eher autodidaktische Entwicklung gewesen. Ich bin über die Literatur an diesen Beruf gekommen, den ich leidenschaftlich gern gemacht habe, war dann in Dortmund bei der Buchhandlung Borgmann, die es nicht mehr gibt, Gehilfe. Diese Buchhandlung hatte einen katholischen Hintergrund, aber es war die modernste in Dortmund. Man ging einfach zu Borgmann, um gute Literatur zu kaufen, einschließlich derjenigen, die ich unter dem Ladentisch verkaufte, zum Beispiel Henry Miller, dessen Romane zu der Zeit teils verboten waren.
Wie lange waren Sie Buchhändler und was haben Sie anschließend gemacht?
Einschließlich der Lehrzeit war ich 15 Jahre Buchhändler, und in dieser Zeit einige Jahre Fachlehrer. Ich habe Buchhandelslehrlinge an der Berufsschule unterrichtet, und das war für mich gleichzeitig der Sprung in eine neue Möglichkeit. Ich wollte weiterkommen und wurde Lektor, zuerst im Arena Verlag in Würzburg. Von da an war meine verlegerische Tätigkeit in Vorbereitung.
Wohin sind Sie von Würzburg aus gegangen?
 Ich wurde Lektor im Georg Bitter Verlag in Recklinghausen, einem Verlag, der sich mit der Gruppe 61 identifizierte, also mit Autoren wie Günter Wallraff und Max von der Grün. Es gab dort Kinderbücher, wofür ich eingestellt wurde, und auch pädagogische und theologische Sachbücher. Ich hatte das Glück im Unglück, dass der Cheflektor krank wurde und nicht wiederkam, so dass ich das gesamte Programm steuern musste. Mein erstes Buch war ein Eheführer: "Vollendung ehelicher Liebe" von einem katholischen Arzt, der mehr oder weniger warnend das kranke Geschlechtsleben schilderte. Da ich im Manuskriptschrank unter den vielen hundert Manuskripten kein einziges gescheites sonst fand, habe ich das mit dem Autor umgeschrieben - viel Arbeit - und ein erfolgreiches sehr positives Buch für katholische Eheleute daraus gemacht.
Ich wurde Lektor im Georg Bitter Verlag in Recklinghausen, einem Verlag, der sich mit der Gruppe 61 identifizierte, also mit Autoren wie Günter Wallraff und Max von der Grün. Es gab dort Kinderbücher, wofür ich eingestellt wurde, und auch pädagogische und theologische Sachbücher. Ich hatte das Glück im Unglück, dass der Cheflektor krank wurde und nicht wiederkam, so dass ich das gesamte Programm steuern musste. Mein erstes Buch war ein Eheführer: "Vollendung ehelicher Liebe" von einem katholischen Arzt, der mehr oder weniger warnend das kranke Geschlechtsleben schilderte. Da ich im Manuskriptschrank unter den vielen hundert Manuskripten kein einziges gescheites sonst fand, habe ich das mit dem Autor umgeschrieben - viel Arbeit - und ein erfolgreiches sehr positives Buch für katholische Eheleute daraus gemacht.Sie haben dann vor allem Kinderliteratur verlegt.
Ja, das erste Kinderbuch von Peter Härtling kam in meinem Programm; ich lernte Josef Guggenmos kennen, und das Buch "Was denkt die Maus am Donnerstag" erschien; ich arbeitete mit dem jungen Wallraff zusammen, und eine seiner ersten Geschichten hat mein Lektorat. Hinzu kamen meine ersten Anthologien mit zum Teil unbekannten Autoren, ich konnte aber auch Preußler und Ende dafür gewinnen.
Sie hatten also beim Georg Bitter Verlag die Möglichkeit, sich intensiver in die Kinderliteratur einzuarbeiten?
Ja, ich war fünf Jahre im Bitter Verlag und er erhielt in dieser Zeit viermal den deutschen Jugendbuchpreis, was sensationell war. Ich war als junger Lektor sozusagen schon der King der Kinderliteratur, und das war wohl der Anlass für Dr. Beltz Rübelmann, mich für ein eigenes Programm zu holen. Ich begann unter dem orangefarbenen Gewand, einer Art Signalfarbe, dieses Programm Beltz & Gelberg zu etablieren, das zu einem Türöffner für die neue, moderne Kinderliteratur wurde.
Wie war die ökonomische Situation des Verlages?
Nach dem ersten Jahr hatte ich einen Umsatz von einer Million, später schwoll das auf 18 Millionen an. Zuerst war das ein Alleingang. Ich machte die Typografie, lektorierte die Bücher, besorgte die Illustrationen, machte die Werbung und die Pressearbeit, bis der Verlag größer wurde und ich Mitarbeiter einstellen konnte.
Sie hatten bestimmte Intentionen und Vorstellungen für die verlegerische Arbeit ...
Mir wurde sehr schnell klar, dass ich nur eine Marktchance habe, wenn ich das, was ich am besten kann und wollte, auch mache: eine moderne Kinderliteratur, die den Versuch macht, Kinder und Erwachsene auf eine Stufe zu bringen, Kinder ernst zu nehmen, ihnen beizubringen, dass sie in dieser Welt eine Möglichkeit haben mitzureden. Ich machte zum Beispiel das "Neinbuch"; es begann ja auch die antiautoritäre Kinderliteratur, ich war ein bisschen ein Rädelsführer dieser Entwicklung. Der Handel hat das zuerst skeptisch beurteilt, aber dann kam mit der Bildungsreform und einer Veränderung der Pädagogik ein Bedürfnis nach dieser Art von Kinderbüchern auf, mein Programm wurde führend, war begehrt und wurde bald auch nachgeahmt.
Hat Sie die 68er-Bewegung beeinflusst?
Natürlich hat mich die Zeitströmung damals beeinflusst, das neue Denken in der Literatur und Politik. Man kann Bücher sowieso nur aus seinem Umfeld heraus machen. Damals veränderte sich die Pädagogik, unser Verhältnis zu Kindern, infolgedessen auch die Literatur. Kinderliteratur ist immer eine Folge dessen, was in der Gesellschaft passiert. Unter anderem machte ich damals mit Janosch Märchen, die neu und aufklärerisch erzählt wurden; wir begannen Märchen neu zu erfinden, und das hat ja Auswirkungen bis in die Gegenwart.
In letzter Zeit gibt es einen starken Trend zur fantastischen Literatu,r und die realistische Literatur ist dadurch sehr ins Hintertreffen geraten. Wie sehen Sie das?
Ich begann mit realistischen Büchern, die natürlich auch ihre fantastischen Seiten haben. Aber es gibt ja immer wieder andere Trends, jetzt eben das Fantastische mit den großen Vorbildern wie Tolkien und mit Büchern, die eine Welle hervorgerufen haben wie die Harry-Potter-Romane. Dass dieser Trend so stark durchgeschlagen hat, ist ein großes Problem, denn es gibt anderen Büchern nebenher wenig Chancen. Natürlich wird sich dieser Trend wieder ändern, aber leider verfolgen viele Verlage keine eigenen Programmideen, sondern sie machen das nach, was "in" ist. Die Harry-Potter-Welle bedeutet, dass alle Verlage plötzlich in diese Richtung arbeiten und auch Autoren so schreiben. Aber in einem Verlag müssen eigene Ideen und Vorstellungen entwickelt und auf dem Markt durchgesetzt werden. Natürlich weiß der Markt zunächst nichts davon, man muss ihm etwas geben. Ich habe immer wieder solche neuen Ideen verwirklicht, eine Taschenbuchreihe angefangen oder das Magazin "Der bunte Hund" gegründet.
Wie war Ihr Verhältnis zu den von Ihnen verlegten Autoren?
Das Wichtigste für einen Verlag sind die Autoren, beim Bilderbuch selbstverständlich auch die Künstler. Die Autoren zu pflegen ist die erste Aufgabe eines Verlags, denn ohne Autoren ist der Verlag nichts wert. Das habe ich immer beherzigt. Ein junger Autor, der ja nicht sofort eine Erfolgsgeschichte schreiben kann, muss aufgebaut werden. Es passiert immer wieder, dass ein Autor mit einem Buch startet, und es wird kein sonderlicher Erfolg. Aber wenn man die Überzeugung hat, dass sich da etwas entwickeln kann, bedeutet das für den Verlag, dass er anfangs vielleicht nur schlappe, möglicherweise nicht verkaufte Auflagen hat, ein hohes Risiko also. Ich habe das oft gemacht, Autoren aufgebaut, die zuerst keine großen Markterfolge hatten, wie zum Beispiel Mirjam Pressler, inzwischen aber durch Preise und Öffentlichkeitsarbeit bekannt geworden sind.
Viele Verlagsprogramme werden von Übersetzungen dominiert. Wie stehen Sie dazu?
Zum Programm gehören natürlich auch Übersetzungen, die Weltliteratur ist auch beim Kinderbuch seit langem eingekehrt. Aber in der Tat gibt es viele Verlage, die fast ausschließlich Übersetzungen bringen. Das ist auf die Dauer nicht gut. Ein Verlag muss eigene Autoren haben, und zwar mit allen Rechten, die er dabei erwirbt. Bei den Übersetzungen erwirbt man ja keine weiteren Rechte und das ist letzten Endes auch nicht so lukrativ.
Wie sieht es mit der Kritik im Kinder- und Jugendbuch aus?
Die Literaturkritik befasst sich in erster Linie mit der Erwachsenenliteratur. Das ist eine große Schwierigkeit. Es gibt zwar eine Kritik der Kinderliteratur in unseren Medien, aber nur in Randbezirken, sehr sparsam und noch dazu in Form von Lobkritiken. Das ist keine echte Literaturkritik, die erforderlichenfalls auch herausstellt, was nicht gut ist. Wenn ich beispielsweise an "Tintenherz" von Cornelia Funke denke, das ich vor einiger Zeit rezensiert habe, dann muss man sagen, dass dieses Erfolgsbuch, das eine riesige Auflage hat und bei Kindern sehr begehrt ist, literarisch-kritisch gesehen ein triviales Buch ist. So etwas müsste beleuchtet werden, aber das findet selten statt.
Sie haben sich zeitweise selber um den Vertrieb gekümmert. Mögen Sie verraten, worauf es dabei ankommt?
Programmverlage, in denen engagierte Literatur erscheint, also keine Trivialliteratur, sondern Bücher, die Anforderungen an den Leser stellen, haben das Problem, an den Leser oder den Käufer solcher anspruchsvolleren Bücher heranzukommen. Ich habe meine Bücher deswegen immer erkennbar gehalten, anfangs durch diese orangene Farbe. Ich habe selber mit vielen Buchhändlern gesprochen, mit Journalisten, Redaktionen und versucht Überzeugungsarbeit zu leisten. Information ist das Wichtigste für den Verkauf von Büchern.
Nun sind viele Bücher heutzutage nur kurze Zeit auf dem Markt ...
 Wir haben streng genommen eine Überproduktion. Die Verlage machen generell zu viele Bücher, immer in der Hoffnung, dass darunter ein "Seller" ist. Es wird sozusagen ein Netz ausgeworfen und man hofft, damit einen dicken Fisch zu fangen. Dafür werden viele Fische in den Teich geschmissen, also Bücher, die oft schon nach einem halben Jahr wieder verramscht werden. Das ist ein großes Problem. Der Buchhändler muss erleben, dass sein Bestand schnell veraltet und keinen Wert mehr hat; deshalb kauft er vorsichtig ein. Die Verlage müssen lernen - heute mehr denn je -, dass Bücher Verantwortung bedeuten. Man darf nicht einfach mal so Bücher machen, weil sie sich gerade gut verkaufen oder weil sie einem Trend folgen. Man muss selber von den Büchern, die man macht, überzeugt sein. Bücher, die man woanders abgeguckt hat oder die kopiert sind, sollten am besten verschwinden.
Wir haben streng genommen eine Überproduktion. Die Verlage machen generell zu viele Bücher, immer in der Hoffnung, dass darunter ein "Seller" ist. Es wird sozusagen ein Netz ausgeworfen und man hofft, damit einen dicken Fisch zu fangen. Dafür werden viele Fische in den Teich geschmissen, also Bücher, die oft schon nach einem halben Jahr wieder verramscht werden. Das ist ein großes Problem. Der Buchhändler muss erleben, dass sein Bestand schnell veraltet und keinen Wert mehr hat; deshalb kauft er vorsichtig ein. Die Verlage müssen lernen - heute mehr denn je -, dass Bücher Verantwortung bedeuten. Man darf nicht einfach mal so Bücher machen, weil sie sich gerade gut verkaufen oder weil sie einem Trend folgen. Man muss selber von den Büchern, die man macht, überzeugt sein. Bücher, die man woanders abgeguckt hat oder die kopiert sind, sollten am besten verschwinden.Sie sind nun seit einiger Zeit im Ruhestand. Wie gefällt Ihnen das?
Ich bin 1997 nach 27 Jahren Beltz & Gelberg und 50 Berufsjahren aus dem täglichen Erwerbsleben ausgeschieden, bin Rentner - so nennt man das wohl - und habe endlich Zeit, mich mit Büchern zu befassen, die ich nicht beruflich lesen oder redigieren muss. Natürlich habe ich nicht aufgehört, mich für Kinderliteratur zu interessieren. Ich halte Vorträge, betreue noch einige Autoren weiter und hatte außerdem einen Lehrauftrag an der Frankfurter Universität. So ist jeder Tag spannend und literaturträchtig; abgesehen von meiner Familie, insbesondere meinen Enkelkindern, die ich oft bei mir habe. Kinder haben uns viel zu sagen, wir müssen nur zuhören, und Kinderliteratur bedeutet schließlich, dass sie sich intensiv mit Kindheit beschäftigt. Kindheit ist eine der wichtigsten Zeiten im Leben des Menschen und wir müssen alles tun, dass Kinder glückliche Kindheiten haben und auch gute Kinderbücher.
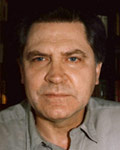 (Eine Sammlung mit Interviews von Persönlichkeiten der Zeitgeschichte erscheint demnächst in Zusammenarbeit mit dem WDR unter dem Titel "Ich mische mich ein")
(Eine Sammlung mit Interviews von Persönlichkeiten der Zeitgeschichte erscheint demnächst in Zusammenarbeit mit dem WDR unter dem Titel "Ich mische mich ein")Mehr über Hans-Joachim Gelberg und seinen Gesprächspartner Wolfgang Bittner unter: www.beltz.de und www.wolfgangbittner.de
Wolfgang Bittner
Foto: NRhZ-Archiv
Online-Flyer Nr. 31 vom 14.02.2006















