SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Inland
Robert Bosch-Stiftung ganz im Sinne des NSDAP-Förderers Robert Bosch
Deutsche "Gestaltungskraft" in die "Arena"
von Hans Georg
Die in Stuttgart ansässige Robert-Bosch-Stiftung beruft ein "Stiftungskolleg für internationale Aufgaben" ein und will deutsche Hochschulabsolventen in einem einjährigen Lehrgang auf "internationale Führungsaufgaben" vorbereiten. An der Ausschreibung beteiligt sich neben der Bosch-Stiftung und der Studienstiftung des deutschen Volkes auch das Auswärtige Amt. Die Initiatoren sehen Deutschland in den Entscheidungsgremien internationaler Organisationen unterrepräsentiert und wollen eine eng vernetzte deutsche Bildungselite dorthin entsenden, um die "Gestaltungskraft" Deutschlands in der "internationalen Arena" zu forcieren. Die kämpferische Metaphorik zielt nicht nur auf UNO, EU, OSZE, Weltbank und NATO, sondern auch auf "global tätige Wirtschaftsunternehmen". Die federführend mit dem "Stiftungskolleg" befasste Bosch-Stiftung sieht sich in der Tradition des Stiftungsgründers Robert Bosch. Der süddeutsche Industrielle (1861-1942) gehörte zu den frühen Förderern des nationalsozialistischen Regimes und profitierte während des Zweiten Weltkriegs sowohl von der Produktion für das deutsche Militär als auch von der Ausbeutung nach Deutschland verschleppter Zwangsarbeiter.
"Strategisch angelegte soziale Netzwerke"
Im Rahmen des Stiftungskollegs für internationale Aufgaben vergibt die Bosch-Stiftung seit 1995 jährlich zwanzig Stipendien an "leistungsstarke und zielorientierte Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen, die internationale Führungsaufgaben anstreben".[1] Da die "Präsenz deutscher Mitarbeiter" in den Entscheidungsgremien der Europäischen Union und der Vereinten Nationen "immer noch nicht dem Engagement Deutschlands als Beitragszahler und seiner politischen Verantwortung" entspreche, herrsche ein großer Bedarf an akademischem Nachwuchs, heißt es.[2] Die Bosch-Stiftung betont ausdrücklich den "Elitecharakter" ihres Ausbildungsprogramms, der nicht zuletzt darin zum Ausdruck komme, dass sich die Bewerber einem "harte(n) Auswahlverfahren" unterwerfen müssten.[3] Laut Aussage eines Absolventen besteht das Ziel des Stiftungskollegs letztlich darin, innerhalb internationaler Organisationen und global tätiger Firmen "strategisch angelegte soziale Netzwerke" deutscher Führungskräfte aufzubauen.[4]
Auf diesem Gebiet verfügt die Bosch-Stiftung bereits über eine mehrjährige Erfahrung. Sie beteiligt sich an der "Berliner Initiative" der Bundesregierung, in die neben dem Auswärtigen Amt auch zahlreiche Think Tanks der deutschen Außenpolitik involviert sind. Zu diesen zählen die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) und der industrienahe "Tönissteiner Kreis". Gemeinsames Ziel ist die "strategische Planung und Steuerung der deutschen Personalpolitik" gegenüber den Organen der Europäischen Union und anderen internationalen Organisationen.[5]
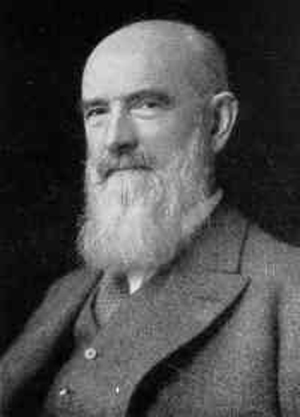
Robert Bosch
Foto: NRhZ-Archiv
Mit dem AA Kultur nach Osteuropa
Mit dem Auswärtigen Amt (AA) ist die Bosch-Stiftung auch noch in anderer Hinsicht verbunden. In gegenseitiger "Abstimmung" werden "Kulturmanager" ausgebildet, die den Aufbau deutscher "Kulturzentren" und Bibliotheken in den Staaten Osteuropas leiten. [6] Durchgeführt wird dieses "Programm" vom "Institut für Auslandsbeziehungen" (ifa), das sich mit finanzieller Unterstützung des AA insbesondere die Stärkung und Förderung der "kulturellen Identität" der osteuropäischen "deutschen Minderheiten" zur Aufgabe gemacht hat.[7]
Das ifa versteht sich selbst als Nachfolger des "Deutschen Ausland-Instituts", dessen Mitarbeiter an der Deportation und Ermordung der europäischen Juden während des Zweiten Weltkriegs beteiligt waren; die Bosch-Stiftung beruft sich ihrerseits uneingeschränkt positiv auf ihren Gründer Robert Bosch (1861-1942), insbesondere auf dessen vermeintlich arbeitnehmerfreundliche und friedliebende Haltung. Der süddeutsche Industrielle gehörte zu den frühen Förderern der NSDAP. Gemeinsam mit Hermann Schmitz, Vorstandsmitglied der IG Farbenindustrie AG, brachte er im Februar 1933 eine Spende der Großindustrie für Adolf Hitler auf den Weg.[8] Wie die Ermittler der US-Militärregierung in Deutschland nach 1945 feststellten, war Boschs Unternehmen, der Robert-Bosch-Konzern, "einer der größten Hersteller von Auto- und Flugzeugmotorenteilen und Zündsystemen in Europa"; ohne das dort vorhandene Know-how hätte man "die Motoren für die Panzer, Stukas und Fahrzeuge für den Blitzkrieg niemals (...) bauen können". Zudem, so die Ermittler weiter, habe Bosch während des Zweiten Weltkriegs "zahlreiche Zwangsarbeiter" beschäftigt.[9]
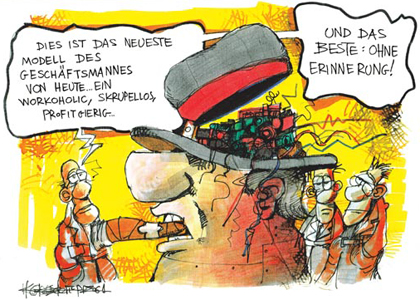
Karikatur: Kostas Koufogiorgos
Sprachliche Kampf-Metaphorik
Der Geschichtsklitterung in eigener Sache entspricht das bei der Bosch-Stiftung vorherrschende Verständnis historischer Zusammenhänge. Den von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg sieht man hier als Teil eines "europäischen Bürgerkriegs", der erst mit dem Untergang der Sowjetunion sein Ende gefunden habe, wie der "Bereichsleiter Völkerverständigung" der Stiftung, Peter Theiner, in Anlehnung an den revisionistischen Historiker Ernst Nolte formuliert.[10] Sprachliche Kampf-Metaphorik findet sich auch in der "strategischen Personalpolitik" der Stiftung gegenüber internationalen Organisationen: Absolventen des aktuell wieder ausgeschriebenen "Stiftungskollegs" machten sich im September 2005 bei einem Kongress gemeinsam mit hochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft Gedanken darüber, welche "Gestaltungskraft" Deutschland in der "internationalen Arena" geltend machen könne.[11]
[1] Stiftungskolleg für internationale Aufgaben der Robert-Bosch-Stiftung und der Studienstiftung des deutschen Volkes in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt; www.bosch-stiftung.de/stiftungskolleg
[2] International Verantwortung übernehmen; Nachrichten der Robert-Bosch-Stiftung, 14. Jahrgang Nr. 2, Oktober 2005, S. 1
[3] ebd., S. 2
[4] Frankfurt, Lima, Paris; Uni-Magazin 7/2003
[5] s. dazu Deutsche Personalinteressen
[6] Robert-Bosch-Stiftung: Bericht 2004, Stuttgart 2005, S. 73
[7] s. dazu Modernes Deutschlandbild
[8] Office of Military Government for Germany, United States (OMGUS): Ermittlungen gegen die IG Farben, Nördlingen 1986, S. 162
[9] Office of Military Government for Germany, United States (OMGUS): Ermittlungen gegen die Dresdner Bank, Nördlingen 1986, S. 249f.
[10] Peter Theiner: Engagement für Verständigung; Das Parlament Nr. 33/34, 11.08.2003
[11] International Verantwortung übernehmen; Nachrichten der Robert-Bosch-Stiftung, 14. Jahrgang Nr. 2, Oktober 2005, S. 1
Online-Flyer Nr. 29 vom 31.01.2006
Robert Bosch-Stiftung ganz im Sinne des NSDAP-Förderers Robert Bosch
Deutsche "Gestaltungskraft" in die "Arena"
von Hans Georg
Die in Stuttgart ansässige Robert-Bosch-Stiftung beruft ein "Stiftungskolleg für internationale Aufgaben" ein und will deutsche Hochschulabsolventen in einem einjährigen Lehrgang auf "internationale Führungsaufgaben" vorbereiten. An der Ausschreibung beteiligt sich neben der Bosch-Stiftung und der Studienstiftung des deutschen Volkes auch das Auswärtige Amt. Die Initiatoren sehen Deutschland in den Entscheidungsgremien internationaler Organisationen unterrepräsentiert und wollen eine eng vernetzte deutsche Bildungselite dorthin entsenden, um die "Gestaltungskraft" Deutschlands in der "internationalen Arena" zu forcieren. Die kämpferische Metaphorik zielt nicht nur auf UNO, EU, OSZE, Weltbank und NATO, sondern auch auf "global tätige Wirtschaftsunternehmen". Die federführend mit dem "Stiftungskolleg" befasste Bosch-Stiftung sieht sich in der Tradition des Stiftungsgründers Robert Bosch. Der süddeutsche Industrielle (1861-1942) gehörte zu den frühen Förderern des nationalsozialistischen Regimes und profitierte während des Zweiten Weltkriegs sowohl von der Produktion für das deutsche Militär als auch von der Ausbeutung nach Deutschland verschleppter Zwangsarbeiter.
"Strategisch angelegte soziale Netzwerke"
Im Rahmen des Stiftungskollegs für internationale Aufgaben vergibt die Bosch-Stiftung seit 1995 jährlich zwanzig Stipendien an "leistungsstarke und zielorientierte Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen, die internationale Führungsaufgaben anstreben".[1] Da die "Präsenz deutscher Mitarbeiter" in den Entscheidungsgremien der Europäischen Union und der Vereinten Nationen "immer noch nicht dem Engagement Deutschlands als Beitragszahler und seiner politischen Verantwortung" entspreche, herrsche ein großer Bedarf an akademischem Nachwuchs, heißt es.[2] Die Bosch-Stiftung betont ausdrücklich den "Elitecharakter" ihres Ausbildungsprogramms, der nicht zuletzt darin zum Ausdruck komme, dass sich die Bewerber einem "harte(n) Auswahlverfahren" unterwerfen müssten.[3] Laut Aussage eines Absolventen besteht das Ziel des Stiftungskollegs letztlich darin, innerhalb internationaler Organisationen und global tätiger Firmen "strategisch angelegte soziale Netzwerke" deutscher Führungskräfte aufzubauen.[4]
Auf diesem Gebiet verfügt die Bosch-Stiftung bereits über eine mehrjährige Erfahrung. Sie beteiligt sich an der "Berliner Initiative" der Bundesregierung, in die neben dem Auswärtigen Amt auch zahlreiche Think Tanks der deutschen Außenpolitik involviert sind. Zu diesen zählen die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) und der industrienahe "Tönissteiner Kreis". Gemeinsames Ziel ist die "strategische Planung und Steuerung der deutschen Personalpolitik" gegenüber den Organen der Europäischen Union und anderen internationalen Organisationen.[5]
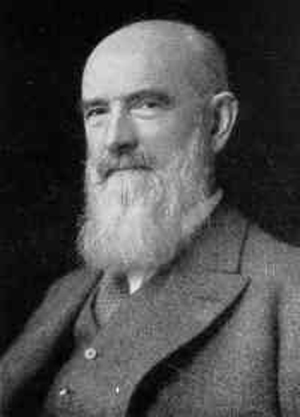
Robert Bosch
Foto: NRhZ-Archiv
Mit dem AA Kultur nach Osteuropa
Mit dem Auswärtigen Amt (AA) ist die Bosch-Stiftung auch noch in anderer Hinsicht verbunden. In gegenseitiger "Abstimmung" werden "Kulturmanager" ausgebildet, die den Aufbau deutscher "Kulturzentren" und Bibliotheken in den Staaten Osteuropas leiten. [6] Durchgeführt wird dieses "Programm" vom "Institut für Auslandsbeziehungen" (ifa), das sich mit finanzieller Unterstützung des AA insbesondere die Stärkung und Förderung der "kulturellen Identität" der osteuropäischen "deutschen Minderheiten" zur Aufgabe gemacht hat.[7]
Das ifa versteht sich selbst als Nachfolger des "Deutschen Ausland-Instituts", dessen Mitarbeiter an der Deportation und Ermordung der europäischen Juden während des Zweiten Weltkriegs beteiligt waren; die Bosch-Stiftung beruft sich ihrerseits uneingeschränkt positiv auf ihren Gründer Robert Bosch (1861-1942), insbesondere auf dessen vermeintlich arbeitnehmerfreundliche und friedliebende Haltung. Der süddeutsche Industrielle gehörte zu den frühen Förderern der NSDAP. Gemeinsam mit Hermann Schmitz, Vorstandsmitglied der IG Farbenindustrie AG, brachte er im Februar 1933 eine Spende der Großindustrie für Adolf Hitler auf den Weg.[8] Wie die Ermittler der US-Militärregierung in Deutschland nach 1945 feststellten, war Boschs Unternehmen, der Robert-Bosch-Konzern, "einer der größten Hersteller von Auto- und Flugzeugmotorenteilen und Zündsystemen in Europa"; ohne das dort vorhandene Know-how hätte man "die Motoren für die Panzer, Stukas und Fahrzeuge für den Blitzkrieg niemals (...) bauen können". Zudem, so die Ermittler weiter, habe Bosch während des Zweiten Weltkriegs "zahlreiche Zwangsarbeiter" beschäftigt.[9]
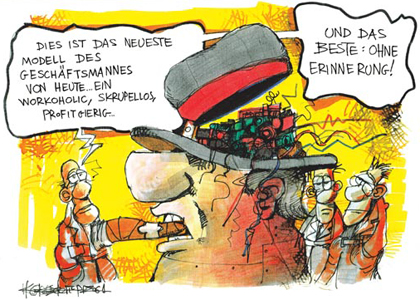
Karikatur: Kostas Koufogiorgos
Sprachliche Kampf-Metaphorik
Der Geschichtsklitterung in eigener Sache entspricht das bei der Bosch-Stiftung vorherrschende Verständnis historischer Zusammenhänge. Den von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg sieht man hier als Teil eines "europäischen Bürgerkriegs", der erst mit dem Untergang der Sowjetunion sein Ende gefunden habe, wie der "Bereichsleiter Völkerverständigung" der Stiftung, Peter Theiner, in Anlehnung an den revisionistischen Historiker Ernst Nolte formuliert.[10] Sprachliche Kampf-Metaphorik findet sich auch in der "strategischen Personalpolitik" der Stiftung gegenüber internationalen Organisationen: Absolventen des aktuell wieder ausgeschriebenen "Stiftungskollegs" machten sich im September 2005 bei einem Kongress gemeinsam mit hochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft Gedanken darüber, welche "Gestaltungskraft" Deutschland in der "internationalen Arena" geltend machen könne.[11]
[1] Stiftungskolleg für internationale Aufgaben der Robert-Bosch-Stiftung und der Studienstiftung des deutschen Volkes in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt; www.bosch-stiftung.de/stiftungskolleg
[2] International Verantwortung übernehmen; Nachrichten der Robert-Bosch-Stiftung, 14. Jahrgang Nr. 2, Oktober 2005, S. 1
[3] ebd., S. 2
[4] Frankfurt, Lima, Paris; Uni-Magazin 7/2003
[5] s. dazu Deutsche Personalinteressen
[6] Robert-Bosch-Stiftung: Bericht 2004, Stuttgart 2005, S. 73
[7] s. dazu Modernes Deutschlandbild
[8] Office of Military Government for Germany, United States (OMGUS): Ermittlungen gegen die IG Farben, Nördlingen 1986, S. 162
[9] Office of Military Government for Germany, United States (OMGUS): Ermittlungen gegen die Dresdner Bank, Nördlingen 1986, S. 249f.
[10] Peter Theiner: Engagement für Verständigung; Das Parlament Nr. 33/34, 11.08.2003
[11] International Verantwortung übernehmen; Nachrichten der Robert-Bosch-Stiftung, 14. Jahrgang Nr. 2, Oktober 2005, S. 1
Online-Flyer Nr. 29 vom 31.01.2006















