SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Lokales
Ein für alle "zur Faulheit erzogenen Deutschen" notwendiger Nachruf
"Diskret, geheimer noch als geheim"
wirkte Bankier von Oppenheim
von Werner Rügemer
Alfred Freiherr von Oppenheim war bis zu seinem plötzlichen Tod im Januar dieses Jahres der vermutlich bei weitem reichste Bürger Kölns und auch der einflussreichste. Seiner wurde gedacht, im hohen Dom, in den Zeitungen, in denen er auch Zeit seines Lebens zu Wort kam. Aber die Bürger in Stadt und Land wissen in ihrer überwältigten Mehrheit so gut wie nichts über den Verstorbenen. Deshalb und weil er, seine Bank und sein Werk nachwirken, erscheint ein nachgereichter Nachruf notwendig.
Wir kennen den Spruch, über Tote solle man nichts Böses sagen. Die klassische Formel aus einer Wiege des sogenannten Abendlandes heißt bekanntlich "De mortuis nihil nisi bene", also über Verstorbene solle man nur Gutes sagen. Es wird über diesen Verstorbenen nur die Wahrheit gesagt werden, nichts als die reine Wahrheit. Wir werden ihn vor allem mit seinen eigenen Worten und Taten zitieren, die er gewiss nicht für böse, sondern für gut gehalten hat.
Zur Trauerfeier hatten sich zweitausend geladene Gäste im Dom versammelt. Aus Düsseldorf, Essen, Frankfurt und Troisdorf, auch aus Köln waren schwarze Nobelkarossen auf dem abgesperrten Roncalli-Platz vorgefahren, der von schwarz gekleideten security guards diskret bewacht wurde. Aber kein einheimisches Volk begehrte Einlass, kein Volk trauerte.

Trauergäste verlassen den Dom - © arbeiterfotografie.com
Welcher gemeine Kölner Bürger, welche gemeine Kölner Bürgerin wusste schon, dass Alfred Freiherr von Oppenheim auf der Liste der reichsten Deutschen zuletzt Platz 25 erklommen hatte? Und zwar mit dem geschätzten, wohl keineswegs vollständigen, aber durchaus nennenswerten Privatvermögen von 3 Milliarden Euro? Er hätte also, beispielsweise, die Schulden seiner völlig überschuldeten Heimatstadt mit einem Schlag vollständig abzahlen können und er hätte immer noch Hunderte Millionen übrig gehabt. Auf der Liste der reichsten Menschen der Welt rangierte er auf Platz 247.
Möglicherweise liegt diese Unbekanntheit des Verstorbenen an seiner aufwendigen und zugleich sehr diskreten Lebens- und Arbeitsweise. Wenn er gelegentlich in seiner Geburtsstadt war, wohnte er in der Familienvilla im parkreichen Stadtteil Marienburg, in der Lindenallee, am südlichsten Ende der Stadt, wo kein Kiosk, kein Café, keine Kneipe, kein Museum, kein Supermarkt und kein Tante-Emma-Laden, kein Hotel und keine Suppenküche die bürgerliche Privatheit stören, wo keine Straßenbahn und kein Bus vorbeikommt. Am Eingangsportal des Anwesens hätte ein verirrter Bürger den Namen des Bewohners nicht finden können.
Einen Teil des Jahres verbrachte der Verstorbene, der viel in seinen geliebten Vereinigten Staaten von Amerika zu tun hatte, in einer Villa am Ocean Boulevard im noblen Palm Beach. Das liegt im fernen Florida, wo seine Frau dem Museum ihre Fotografien-Sammlung schenkte und dafür als Mäzenin gefeiert wurde.
Einen anderen Teil des Jahres verbrachte der Verstorbene in seinem Penthouse in der Markgrafenstraße am Berliner Gendarmenmarkt, denn er war ein Bewunderer Preußens und lebte zunehmend gern im historischen Ambiente der altneudeutschen Hauptstadt. Viele Tage verbrachte er auf kulturvollen Festspielen wie in Bayreuth, denn er liebte Wagner über alles. Viele Wochen auch war er fern seiner Heimatstadt, weil er etwa mit seiner Yacht "Passepartout" das Horn von Afrika umsegelte beziehungsweise von seiner livrierten Mannschaft umsegeln ließ.
"Erst ab fünf Millionen Euro flüssig"
So konnten die Kölner über ihren reichsten Mitbürger bestenfalls etwas aus den Zeitungen erfahren, vor allem seiner Lieblingszeitung "Welt am Sonntag". "Ein Berg von Mann im Maßanzug. Goldene Taschenuhr am Revers. Aristokratische Nase unter schlohweißem Haar, oft eine Zigarre Monte Christo Nr. 2 zwischen den Fingern", so wurde er in einem Interview charakterisiert. Zur besten Zigarre dürfe zudem der beste Wein nicht fehlen, ein Chateau Margaux, der immer auch auf seiner Yacht "Passepartout" bereitgehalten werden müsse.
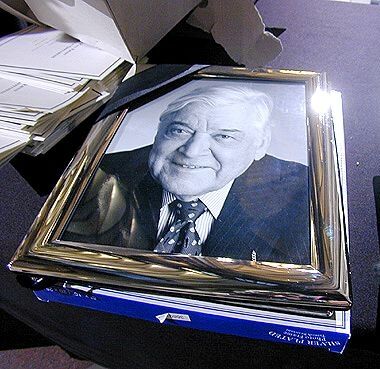
Alfred Freiherr von Oppenheim - © arbeiterfotografie.com
Die Chefreporterin der "Welt am Sonntag" beschrieb ihn "einen der letzten Grandseigneurs der deutschen Hochfinanz", seit 1964 Teilhaber, dann auch Vorstandssprecher und Hauptaktionär des Bankhauses Salomon Oppenheim junior & Compagnie, der größten Privatbank Europas mit Sitz in Köln. Die Chefreporterin referierte auch, der Bankier Wert lege darauf, dass man in seiner Bank erst ab fünf Millionen Euro flüssig aufwärts ein Konto eröffnen dürfe. "Kleinkunden empfehlen wir eher die öffentlichen Kreditanstalten", habe der Grandseigneur mit seiner heiseren Stimme gesagt, um die, die weniger als fünf Millionen Euro anlegen können, von seiner Bank fernzuhalten. Abends in Berlin ging der Verstorbene mit seiner Frau gern ins Theater, in die Oper, denn in Berlin war es standesgemäß. "Da trifft man auch Seinesgleichen", etwa die Ottos vom Otto-Versand und die Beisheims von Metro, so zitierte ihn die Chefreporterin.
Er habe aber auch sehr Unschönes in der neuen deutschen Hauptstadt erleiden müssen, ließ er seine Lieblingszeitung wissen. So kritisierte er scharf, dass die deutsche Regierung "sich im Irak-Krieg gegen die USA stellte". Berlin sei die "Hauptstadt der Scheinheiligen und Undankbaren". Dagegen habe er sich mit allen Kräften gestellt. Er zeige "Flagge", wie er der Chefreporterin anvertraute. Bereits die Fußmatte an der Eingangstür zum Penthouse sei ein Symbol des Widerstands. Sie war als US-Flagge mit Stars and Stripes gestaltet. Ebenso habe der Bankier auf seine jeweils ausgewählte Tageskrawatte ein Fähnchen mit dem Sternenbanner aufgesteckt.
"Der Deutsche ist zu faul geworden"
Und noch ein strenges Wort des Verstorbenen gegen den "Zeitgeist" der Deutschen publizierte die "Welt am Sonntag": "Jammern hilft nicht. Die Berliner müssen sich einen Ruck geben und aus ihrer Lethargie aufwachen... Dieser Staat hat die Menschen nach dem Krieg zu sehr verwöhnt. Der Deutsche ist zu faul geworden. Hier werden die Kinder schon in den Schulen regelrecht zur Faulheit erzogen."
In seiner Bank hingegen gab es keine Lethargie und keine Faulheit. So konnte er im Jahr 1999 verkünden lassen: "Das beste Jahr in unserer 211-jährigen Geschichte". Und 2003 sei der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr sogar um 71 Prozent gesteigert worden. Trotz der "großen Zahl der Pleiten und der bedrückend hohen Arbeitslosigkeit", hatte die Bank damals erklärt.
Das entsprach den hohen Ansprüchen des Verstorbenen. So etwas Ordinäres wie Bankschalter gibt es bis heute nicht in den Filialen in der Düsseldorfer Königsallee, in der Berliner Jägerstraße, am Münchner Odeonsplatz, im Palais Equitable am Wiener Eisen-Platz und in der verschwiegenen Allée Scheffer in Luxemburg. Stattdessen wird man mit den fünf Millionen aufwärts flüssig, wenn angemeldet, so in Köln Unter Sachsenhausen Nr. 4, von Menschen, die "Diener" heißen, empfangen und persönlich betreut. Denn: "Unsere Zielgruppe sind die 10.000 reichsten Deutschen, die über 50 % des gesamten Vermögens der deutschen Bevölkerung verfügen", sagt Matthias Graf von Krockow, der vom Verstorbenen ausgesuchte Nachfolger. "Hier sind wir Marktführer", fügt der Graf hinzu, denn 2003 konnte man die Zahl der schalterlosen Kunden von 5.000 auf 6.000 erhöhen.
Für die verwaltete die Bank im letzten Lebens- und Arbeitsjahr des Verstorbenen 62 Milliarden Euro. Teilt man die 62 Milliarden durch die 6000 Kunden, so kommt man auf gut 10 Millionen für den Durchschnittskunden. Zu ihnen zählen allerdings viele Kinder, auf die die Familienvermögen auch aus steuerlichen Gründen frühzeitig verteilt werden. Das drückt den Durchschnittsbetrag auf die vergleichsweise niedrigen 10 Millionen herab.
Die fleißigen Kunden der Oppenheim-Bank
Für die mit freien 50 Millionen flüssig aufwärts wartet die Bank mit einem Sonderservice auf, genannt Oppenheim Vermögens Treuhand, OVT. "Wir suchen nicht nur die besten Experten für unterschiedliche Anlagegruppen, wir erledigen auch die komplette Finanzbuchhaltung", sagt der für diese Großkunden zuständige Gesellschafter Baron Hubertus Maria Gustavo Rukavina de Vidograd. Seine treue Hand ergreifen rund 40 Kunden, die bei der OVT zusammen 5 Milliarden Euro verwalten lassen. Sie, die in den Augen des Verstorbenen gewiss nicht zu den vom Staat zur Faulheit erzogenen Deutschen zählen, haben also fleißig je durchschnittlich 110 Millionen in der OVT angelegt.
Das tun etwa die Haribo-Eigentümerfamilie Riegel, die Verlegerfamilie Neven DuMont, die LTU-Inhaber Conle, die Baustoff-Haniels, der Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Arend Oetker mit Sprösslingen, Ex-Sotheby´s Chef Graf Douglas, Klaus Mangold von DaimlerChrysler Financial Services und von Toll Collect, mehrere Mitglieder des mit Adenauer verbundenen Werhahn-Clans, Wolfgang Urban und Thomas Middelhoff von KarstadtQuelle, der frühere IHK-Präsident Otto Wolff von Amerongen. Übrigens auch das Kölner Erzbistum.
Vor allem dort, wo seit 1999 neuer Reichtum aufkam, hat die Bank in den blühenden Jahren der rot-grünen Regierung weitere Niederlassungen eröffnet: In Berlin, Wien, Baden-Baden, Stuttgart, Salzburg, Genf und zuletzt, im Mai 2004, in Frankfurt. Denn dort, so schätzt die Oppenheim Research GmbH, beläuft sich das Potential vermögender Privatkunden auf jeweils etwa 1.000 Personen.
"Für wenige tun wir alles"
"Für wenige tun wir alles", ist ein Wahlspruch der Bank. Die Frage, was dieses "alles" ist, das die Bank für diese "wenigen" tut, führt uns zu weiteren Aspekten in der beruflichen Tätigkeit des Verstorbenen. "Wir sind diskret, geheimer noch als geheim", hat Oppenheim seiner Lieblingszeitung anvertraut. Doch wann und wo hat seine Bank nach diesem Motto praktiziert? Das war zum Beispiel damals, als in Deutschland nicht mehr die Mithilfe der Bank bespendeten Parteien an der Regierung waren, sondern als sich eine Katastrophe anzubahnen schien: "Mehr Demokratie wagen", riefen damals schauerlich hunderttausende vom Staat zur Faulheit erzogene, junge Deutsche. Es drohte korrektere Steuereintreibung und ähnliches Unheil. Also eröffnete die Bank Oppenheim 1970 in der finanziellen Grauzone Luxemburg eine Dépendance, danach eine weitere in Zürich. Diese Banktochter in der Schweizer Grauzone lag dem Verstorbenen besonders am Herzen, hier war er bis zu seinem Tode Vorsitzender des Aufsichtsrats.
Diskret, geheimer als geheim: Das lässt sich auch verwirklichen, wenn man verschiedene Finanzoasen miteinander kombiniert. Ein Beispiel: Der "Multi-Manager-Fonds" PharmaW/Health der Oppenheim-Bank wird von der Tochterbank in Zürich gemanagt. Seinen juristischen Standort hat er in Luxemburg. Dirigiert wird er aus Köln. Die Anleger gehören zumeist zu den "ab 5 Millionen flüssig aufwärts" in Deutschland. Die Fondsmanager legen das Geld in den "aussichtsreichsten Pharma-, Biotechnologie- und HealthCare-Unternehmen" an, vor allem in den USA. Die Bank wirbt damit, dass der Fonds vom "überdurchschnittlichen Zukunftspotential der Gesundheitsindustrie" profitiere. Die Rendite seit dem Start 1993 betrage bis heute 24 Prozent, pro Jahr.
Das nennen die Fondsmanager eine "gesunde Rendite". Sie wird vor allem dort erzielt, wo wie im Vorbildstaat des Verstorbenen, den USA, das medizinische Leistungssystem besonders weit privatisiert ist. Die Fondsmanager haben übrigens ausgerechnet, um wie viele Prozent die Rendite sinken würde, wenn bei der damals anstehenden Präsidentenwahl in den USA der demokratische Kandidat Kerry gewinnen und behutsame Reformen durchsetzen würde. Schauerlich wäre ein solcher Präsident in den Augen der Fondsmanager gewesen. Denn er verstand nichts von Gesundheit, zumindest nichts von einer gesunden Rendite im Sinne der Oppenheim-Kunden.
Erfahrenen Geldwäscher eingekauft
Ein anderer Trick, mit dem die Bank nach dem Motto "diskret, geheimer noch als geheim" den reichsten Deutschen hilft, besteht darin, mehrere finanzielle Grauzonen kaskadenartig hintereinander zu schalten. Damit kann man den deutschen Fiskus umgehen. Beim Gesundheitsfonds PharmaW/Health wird dies schon ansatzweise praktiziert, wenn auch noch westeuropäisch-konventionell. Aber fleißige Angestellte der Bank helfen den Kunden, von Zürich und Genf aus, die Geldanlagen auch in entfernten Grauzonen wie Britisch-Westindien, Curacao oder Panama zu bunkern.
Der Verstorbene holte sich dazu erfahrene Geldwäscher aus anderen Banken, die noch größere Freiheiten hatten als seine Privatbank in old Europe. Der schon erwähnte Teilhaber Baron Hubertus Maria Gustavo Rukavina de Vidograd hatte bis 1999 in der Abteilung Privatkunden der weltgrößten Bank, der Citibank, in New York gearbeitet. Die Citibank aber war in vieler Hinsicht das große Vorbild des Verstorbenen, der seine Lehrjahre an der Wall Street verbrachte.
Untersuchungen des Ständigen Ausschusses des US-Kongresses zur Geldwäsche ergaben: Etwa die Hälfte der weltweit jährlich zwischen 500 und 1000 Milliarden Dollar gewaschenen Gelder werden in US-Banken gewaschen, und die Citibank spielt hier eine führende Rolle. Baron Hubertus war in der Citibank verantwortlich für vermögende Privatkunden. Für sie wurden "shell companies", also Briefkastenfirmen auf den Bahamas, den Cayman Islands, in der City von London und in der Schweiz eingerichtet.
Unter anderem betreute Baron Hubertus den Kunden Raoul Salinas, Bruder des ehemaligen mexikanischen Präsidenten Carlos Salinas. Für den Salinas-Clan hatte die Citibank, laut Berichten des Geldwäscheausschusses seit 1992 Hunderte Millionen aus staatlichen Armutsbekämpfungsprogrammen in solchen "shell companies" versteckt, diesmal in London. Nach der Verhaftung von Salinas schlug Baron Hubertus vor, die Gelder zum besseren Versteck in die Schweiz zu transferieren. Das geschah mit etwa 114 Millionen Dollar. Nach dem Salinas-Skandal und nach seiner Vernehmung durch den Kongress-Ausschuss musste Baron Hubertus bei der Citibank ausscheiden. In der Bank Oppenheim des weltoffenen Köln fand er Aufnahme als persönlich haftender Gesellschafter. Er wurde in der Oppenheim Vermögens Treuhand zuständig für die Großkunden, also die mit mehr als 50 Millionen.
Fortsetzung folgt im nächsten Flyer!
Online-Flyer Nr. 03 vom 22.08.2005
Ein für alle "zur Faulheit erzogenen Deutschen" notwendiger Nachruf
"Diskret, geheimer noch als geheim"
wirkte Bankier von Oppenheim
von Werner Rügemer
Alfred Freiherr von Oppenheim war bis zu seinem plötzlichen Tod im Januar dieses Jahres der vermutlich bei weitem reichste Bürger Kölns und auch der einflussreichste. Seiner wurde gedacht, im hohen Dom, in den Zeitungen, in denen er auch Zeit seines Lebens zu Wort kam. Aber die Bürger in Stadt und Land wissen in ihrer überwältigten Mehrheit so gut wie nichts über den Verstorbenen. Deshalb und weil er, seine Bank und sein Werk nachwirken, erscheint ein nachgereichter Nachruf notwendig.
Wir kennen den Spruch, über Tote solle man nichts Böses sagen. Die klassische Formel aus einer Wiege des sogenannten Abendlandes heißt bekanntlich "De mortuis nihil nisi bene", also über Verstorbene solle man nur Gutes sagen. Es wird über diesen Verstorbenen nur die Wahrheit gesagt werden, nichts als die reine Wahrheit. Wir werden ihn vor allem mit seinen eigenen Worten und Taten zitieren, die er gewiss nicht für böse, sondern für gut gehalten hat.
Zur Trauerfeier hatten sich zweitausend geladene Gäste im Dom versammelt. Aus Düsseldorf, Essen, Frankfurt und Troisdorf, auch aus Köln waren schwarze Nobelkarossen auf dem abgesperrten Roncalli-Platz vorgefahren, der von schwarz gekleideten security guards diskret bewacht wurde. Aber kein einheimisches Volk begehrte Einlass, kein Volk trauerte.

Trauergäste verlassen den Dom - © arbeiterfotografie.com
Welcher gemeine Kölner Bürger, welche gemeine Kölner Bürgerin wusste schon, dass Alfred Freiherr von Oppenheim auf der Liste der reichsten Deutschen zuletzt Platz 25 erklommen hatte? Und zwar mit dem geschätzten, wohl keineswegs vollständigen, aber durchaus nennenswerten Privatvermögen von 3 Milliarden Euro? Er hätte also, beispielsweise, die Schulden seiner völlig überschuldeten Heimatstadt mit einem Schlag vollständig abzahlen können und er hätte immer noch Hunderte Millionen übrig gehabt. Auf der Liste der reichsten Menschen der Welt rangierte er auf Platz 247.
Möglicherweise liegt diese Unbekanntheit des Verstorbenen an seiner aufwendigen und zugleich sehr diskreten Lebens- und Arbeitsweise. Wenn er gelegentlich in seiner Geburtsstadt war, wohnte er in der Familienvilla im parkreichen Stadtteil Marienburg, in der Lindenallee, am südlichsten Ende der Stadt, wo kein Kiosk, kein Café, keine Kneipe, kein Museum, kein Supermarkt und kein Tante-Emma-Laden, kein Hotel und keine Suppenküche die bürgerliche Privatheit stören, wo keine Straßenbahn und kein Bus vorbeikommt. Am Eingangsportal des Anwesens hätte ein verirrter Bürger den Namen des Bewohners nicht finden können.
Einen Teil des Jahres verbrachte der Verstorbene, der viel in seinen geliebten Vereinigten Staaten von Amerika zu tun hatte, in einer Villa am Ocean Boulevard im noblen Palm Beach. Das liegt im fernen Florida, wo seine Frau dem Museum ihre Fotografien-Sammlung schenkte und dafür als Mäzenin gefeiert wurde.
Einen anderen Teil des Jahres verbrachte der Verstorbene in seinem Penthouse in der Markgrafenstraße am Berliner Gendarmenmarkt, denn er war ein Bewunderer Preußens und lebte zunehmend gern im historischen Ambiente der altneudeutschen Hauptstadt. Viele Tage verbrachte er auf kulturvollen Festspielen wie in Bayreuth, denn er liebte Wagner über alles. Viele Wochen auch war er fern seiner Heimatstadt, weil er etwa mit seiner Yacht "Passepartout" das Horn von Afrika umsegelte beziehungsweise von seiner livrierten Mannschaft umsegeln ließ.
"Erst ab fünf Millionen Euro flüssig"
So konnten die Kölner über ihren reichsten Mitbürger bestenfalls etwas aus den Zeitungen erfahren, vor allem seiner Lieblingszeitung "Welt am Sonntag". "Ein Berg von Mann im Maßanzug. Goldene Taschenuhr am Revers. Aristokratische Nase unter schlohweißem Haar, oft eine Zigarre Monte Christo Nr. 2 zwischen den Fingern", so wurde er in einem Interview charakterisiert. Zur besten Zigarre dürfe zudem der beste Wein nicht fehlen, ein Chateau Margaux, der immer auch auf seiner Yacht "Passepartout" bereitgehalten werden müsse.
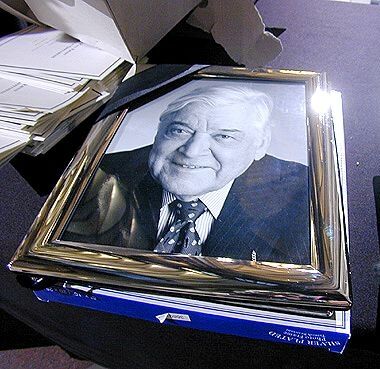
Alfred Freiherr von Oppenheim - © arbeiterfotografie.com
Die Chefreporterin der "Welt am Sonntag" beschrieb ihn "einen der letzten Grandseigneurs der deutschen Hochfinanz", seit 1964 Teilhaber, dann auch Vorstandssprecher und Hauptaktionär des Bankhauses Salomon Oppenheim junior & Compagnie, der größten Privatbank Europas mit Sitz in Köln. Die Chefreporterin referierte auch, der Bankier Wert lege darauf, dass man in seiner Bank erst ab fünf Millionen Euro flüssig aufwärts ein Konto eröffnen dürfe. "Kleinkunden empfehlen wir eher die öffentlichen Kreditanstalten", habe der Grandseigneur mit seiner heiseren Stimme gesagt, um die, die weniger als fünf Millionen Euro anlegen können, von seiner Bank fernzuhalten. Abends in Berlin ging der Verstorbene mit seiner Frau gern ins Theater, in die Oper, denn in Berlin war es standesgemäß. "Da trifft man auch Seinesgleichen", etwa die Ottos vom Otto-Versand und die Beisheims von Metro, so zitierte ihn die Chefreporterin.
Er habe aber auch sehr Unschönes in der neuen deutschen Hauptstadt erleiden müssen, ließ er seine Lieblingszeitung wissen. So kritisierte er scharf, dass die deutsche Regierung "sich im Irak-Krieg gegen die USA stellte". Berlin sei die "Hauptstadt der Scheinheiligen und Undankbaren". Dagegen habe er sich mit allen Kräften gestellt. Er zeige "Flagge", wie er der Chefreporterin anvertraute. Bereits die Fußmatte an der Eingangstür zum Penthouse sei ein Symbol des Widerstands. Sie war als US-Flagge mit Stars and Stripes gestaltet. Ebenso habe der Bankier auf seine jeweils ausgewählte Tageskrawatte ein Fähnchen mit dem Sternenbanner aufgesteckt.
"Der Deutsche ist zu faul geworden"
Und noch ein strenges Wort des Verstorbenen gegen den "Zeitgeist" der Deutschen publizierte die "Welt am Sonntag": "Jammern hilft nicht. Die Berliner müssen sich einen Ruck geben und aus ihrer Lethargie aufwachen... Dieser Staat hat die Menschen nach dem Krieg zu sehr verwöhnt. Der Deutsche ist zu faul geworden. Hier werden die Kinder schon in den Schulen regelrecht zur Faulheit erzogen."
In seiner Bank hingegen gab es keine Lethargie und keine Faulheit. So konnte er im Jahr 1999 verkünden lassen: "Das beste Jahr in unserer 211-jährigen Geschichte". Und 2003 sei der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr sogar um 71 Prozent gesteigert worden. Trotz der "großen Zahl der Pleiten und der bedrückend hohen Arbeitslosigkeit", hatte die Bank damals erklärt.
Das entsprach den hohen Ansprüchen des Verstorbenen. So etwas Ordinäres wie Bankschalter gibt es bis heute nicht in den Filialen in der Düsseldorfer Königsallee, in der Berliner Jägerstraße, am Münchner Odeonsplatz, im Palais Equitable am Wiener Eisen-Platz und in der verschwiegenen Allée Scheffer in Luxemburg. Stattdessen wird man mit den fünf Millionen aufwärts flüssig, wenn angemeldet, so in Köln Unter Sachsenhausen Nr. 4, von Menschen, die "Diener" heißen, empfangen und persönlich betreut. Denn: "Unsere Zielgruppe sind die 10.000 reichsten Deutschen, die über 50 % des gesamten Vermögens der deutschen Bevölkerung verfügen", sagt Matthias Graf von Krockow, der vom Verstorbenen ausgesuchte Nachfolger. "Hier sind wir Marktführer", fügt der Graf hinzu, denn 2003 konnte man die Zahl der schalterlosen Kunden von 5.000 auf 6.000 erhöhen.
Für die verwaltete die Bank im letzten Lebens- und Arbeitsjahr des Verstorbenen 62 Milliarden Euro. Teilt man die 62 Milliarden durch die 6000 Kunden, so kommt man auf gut 10 Millionen für den Durchschnittskunden. Zu ihnen zählen allerdings viele Kinder, auf die die Familienvermögen auch aus steuerlichen Gründen frühzeitig verteilt werden. Das drückt den Durchschnittsbetrag auf die vergleichsweise niedrigen 10 Millionen herab.
Die fleißigen Kunden der Oppenheim-Bank
Für die mit freien 50 Millionen flüssig aufwärts wartet die Bank mit einem Sonderservice auf, genannt Oppenheim Vermögens Treuhand, OVT. "Wir suchen nicht nur die besten Experten für unterschiedliche Anlagegruppen, wir erledigen auch die komplette Finanzbuchhaltung", sagt der für diese Großkunden zuständige Gesellschafter Baron Hubertus Maria Gustavo Rukavina de Vidograd. Seine treue Hand ergreifen rund 40 Kunden, die bei der OVT zusammen 5 Milliarden Euro verwalten lassen. Sie, die in den Augen des Verstorbenen gewiss nicht zu den vom Staat zur Faulheit erzogenen Deutschen zählen, haben also fleißig je durchschnittlich 110 Millionen in der OVT angelegt.
Das tun etwa die Haribo-Eigentümerfamilie Riegel, die Verlegerfamilie Neven DuMont, die LTU-Inhaber Conle, die Baustoff-Haniels, der Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Arend Oetker mit Sprösslingen, Ex-Sotheby´s Chef Graf Douglas, Klaus Mangold von DaimlerChrysler Financial Services und von Toll Collect, mehrere Mitglieder des mit Adenauer verbundenen Werhahn-Clans, Wolfgang Urban und Thomas Middelhoff von KarstadtQuelle, der frühere IHK-Präsident Otto Wolff von Amerongen. Übrigens auch das Kölner Erzbistum.
Vor allem dort, wo seit 1999 neuer Reichtum aufkam, hat die Bank in den blühenden Jahren der rot-grünen Regierung weitere Niederlassungen eröffnet: In Berlin, Wien, Baden-Baden, Stuttgart, Salzburg, Genf und zuletzt, im Mai 2004, in Frankfurt. Denn dort, so schätzt die Oppenheim Research GmbH, beläuft sich das Potential vermögender Privatkunden auf jeweils etwa 1.000 Personen.
"Für wenige tun wir alles"
"Für wenige tun wir alles", ist ein Wahlspruch der Bank. Die Frage, was dieses "alles" ist, das die Bank für diese "wenigen" tut, führt uns zu weiteren Aspekten in der beruflichen Tätigkeit des Verstorbenen. "Wir sind diskret, geheimer noch als geheim", hat Oppenheim seiner Lieblingszeitung anvertraut. Doch wann und wo hat seine Bank nach diesem Motto praktiziert? Das war zum Beispiel damals, als in Deutschland nicht mehr die Mithilfe der Bank bespendeten Parteien an der Regierung waren, sondern als sich eine Katastrophe anzubahnen schien: "Mehr Demokratie wagen", riefen damals schauerlich hunderttausende vom Staat zur Faulheit erzogene, junge Deutsche. Es drohte korrektere Steuereintreibung und ähnliches Unheil. Also eröffnete die Bank Oppenheim 1970 in der finanziellen Grauzone Luxemburg eine Dépendance, danach eine weitere in Zürich. Diese Banktochter in der Schweizer Grauzone lag dem Verstorbenen besonders am Herzen, hier war er bis zu seinem Tode Vorsitzender des Aufsichtsrats.
Diskret, geheimer als geheim: Das lässt sich auch verwirklichen, wenn man verschiedene Finanzoasen miteinander kombiniert. Ein Beispiel: Der "Multi-Manager-Fonds" PharmaW/Health der Oppenheim-Bank wird von der Tochterbank in Zürich gemanagt. Seinen juristischen Standort hat er in Luxemburg. Dirigiert wird er aus Köln. Die Anleger gehören zumeist zu den "ab 5 Millionen flüssig aufwärts" in Deutschland. Die Fondsmanager legen das Geld in den "aussichtsreichsten Pharma-, Biotechnologie- und HealthCare-Unternehmen" an, vor allem in den USA. Die Bank wirbt damit, dass der Fonds vom "überdurchschnittlichen Zukunftspotential der Gesundheitsindustrie" profitiere. Die Rendite seit dem Start 1993 betrage bis heute 24 Prozent, pro Jahr.
Das nennen die Fondsmanager eine "gesunde Rendite". Sie wird vor allem dort erzielt, wo wie im Vorbildstaat des Verstorbenen, den USA, das medizinische Leistungssystem besonders weit privatisiert ist. Die Fondsmanager haben übrigens ausgerechnet, um wie viele Prozent die Rendite sinken würde, wenn bei der damals anstehenden Präsidentenwahl in den USA der demokratische Kandidat Kerry gewinnen und behutsame Reformen durchsetzen würde. Schauerlich wäre ein solcher Präsident in den Augen der Fondsmanager gewesen. Denn er verstand nichts von Gesundheit, zumindest nichts von einer gesunden Rendite im Sinne der Oppenheim-Kunden.
Erfahrenen Geldwäscher eingekauft
Ein anderer Trick, mit dem die Bank nach dem Motto "diskret, geheimer noch als geheim" den reichsten Deutschen hilft, besteht darin, mehrere finanzielle Grauzonen kaskadenartig hintereinander zu schalten. Damit kann man den deutschen Fiskus umgehen. Beim Gesundheitsfonds PharmaW/Health wird dies schon ansatzweise praktiziert, wenn auch noch westeuropäisch-konventionell. Aber fleißige Angestellte der Bank helfen den Kunden, von Zürich und Genf aus, die Geldanlagen auch in entfernten Grauzonen wie Britisch-Westindien, Curacao oder Panama zu bunkern.
Der Verstorbene holte sich dazu erfahrene Geldwäscher aus anderen Banken, die noch größere Freiheiten hatten als seine Privatbank in old Europe. Der schon erwähnte Teilhaber Baron Hubertus Maria Gustavo Rukavina de Vidograd hatte bis 1999 in der Abteilung Privatkunden der weltgrößten Bank, der Citibank, in New York gearbeitet. Die Citibank aber war in vieler Hinsicht das große Vorbild des Verstorbenen, der seine Lehrjahre an der Wall Street verbrachte.
Untersuchungen des Ständigen Ausschusses des US-Kongresses zur Geldwäsche ergaben: Etwa die Hälfte der weltweit jährlich zwischen 500 und 1000 Milliarden Dollar gewaschenen Gelder werden in US-Banken gewaschen, und die Citibank spielt hier eine führende Rolle. Baron Hubertus war in der Citibank verantwortlich für vermögende Privatkunden. Für sie wurden "shell companies", also Briefkastenfirmen auf den Bahamas, den Cayman Islands, in der City von London und in der Schweiz eingerichtet.
Unter anderem betreute Baron Hubertus den Kunden Raoul Salinas, Bruder des ehemaligen mexikanischen Präsidenten Carlos Salinas. Für den Salinas-Clan hatte die Citibank, laut Berichten des Geldwäscheausschusses seit 1992 Hunderte Millionen aus staatlichen Armutsbekämpfungsprogrammen in solchen "shell companies" versteckt, diesmal in London. Nach der Verhaftung von Salinas schlug Baron Hubertus vor, die Gelder zum besseren Versteck in die Schweiz zu transferieren. Das geschah mit etwa 114 Millionen Dollar. Nach dem Salinas-Skandal und nach seiner Vernehmung durch den Kongress-Ausschuss musste Baron Hubertus bei der Citibank ausscheiden. In der Bank Oppenheim des weltoffenen Köln fand er Aufnahme als persönlich haftender Gesellschafter. Er wurde in der Oppenheim Vermögens Treuhand zuständig für die Großkunden, also die mit mehr als 50 Millionen.
Fortsetzung folgt im nächsten Flyer!
Online-Flyer Nr. 03 vom 22.08.2005















