SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Literatur
Veröffentlicht zum 80. Geburtstag des Kölner Schriftstellers
Weißer Jahrgang
Von Karl C. Fischer
 Was mich prägte, geschah in den fünfziger Jahren. Es waren meine Ängste vor der Einberufung in die Bundeswehr. Dabei konnte ich den entstellten Körper von Fritz nicht vergessen, an dessen Tod ich mich schuldig fühlte und Alpträume bekam. Erst als ich mir geschworen hatte, nie Hitlerjunge zu werden und erst recht nicht Soldat, ging es mir besser. Fritz war Mitzögling im Waisenhaus, dem ich half, sich umzubringen, damit ihn der Heimleiter, ein sadistischer SA-Mann, nicht erschlug. Das war im September 1944.
Was mich prägte, geschah in den fünfziger Jahren. Es waren meine Ängste vor der Einberufung in die Bundeswehr. Dabei konnte ich den entstellten Körper von Fritz nicht vergessen, an dessen Tod ich mich schuldig fühlte und Alpträume bekam. Erst als ich mir geschworen hatte, nie Hitlerjunge zu werden und erst recht nicht Soldat, ging es mir besser. Fritz war Mitzögling im Waisenhaus, dem ich half, sich umzubringen, damit ihn der Heimleiter, ein sadistischer SA-Mann, nicht erschlug. Das war im September 1944.
Im März 1945 befreiten amerikanische Truppen Frankfurt. Meine Angst schwand, dass man mich zwingen würde, Menschen zu töten. Am 8. Mai pflückte ich aus Freude über die herbeigesehnte Freiheit Trümmerblumen und steckte sie mir an die Hosenträger.
Drei Monate später gab es noch keinen Unterricht, aber die Frankfurter Rundschau, die erste deutsche Zeitung. Ich übte lesen und versuchte zu erfahren, was das noch fremde Wort Demokratie bedeutete.
Ich las, die katholischen Bischöfe hätten sich zur Mitverantwortung für die Verbrechen der NS-Zeit bekannt und auch die evangelische Kirche habe ihre Schuld zugegeben. Man schrieb, die CDU sei für Sozialismus und die SPD für die Sozialisierung der Wirtschaft. Doch über Demokratie sprach meist nur die Militärregierung.
Wieso, dachte ich noch im Januar 1946, als mich die Schulbehörde aufforderte, einmal in der Woche bei einer Lehrerin Aufgaben abzuholen. Als Unterrichtsmaterial diente das Lesebuch für Volksschulen von 1939, in dem auch Hitlers Reden standen.
Die Militärregierung verbot, NSDAP-Mitglieder zu beschäftigen und die Spruchkammern begannen mit den Entnazifizierungsverfahren. Mein Onkel, ein Spruchkammervorsitzender, stufte einen Nachbarn, der zu den SS-Totenkopfverbänden gehört hatte, als minderbelastet ein. Nach den Landtagswahlen im Dezember 1946 eröffnete der Mann ein Pelzgeschäft, in dem Ware angeboten wurde, die man alteingesessenen Händlern in Leipzig gestohlen hatte. Onkel verzieh dem Mann, vergaß aber seine Opfer. So beging der Kerl weiter Unrecht. Nun ahnte ich, Demokratie war nicht so wehrlos, wie sie der Onkel vorlebte.
Alle hungerten, auch die Kinder, doch nur sie starben zu Tausenden an Tuberkulose. Ich durfte überleben, aber ich musste nach langer Liegezeit in der Klinik erst wieder laufen lernen und dann die dritte Klasse nachholen. Nach meiner Versetzung in die vierte Klasse im Herbst 1947, berichtete die Zeitung ab Februar 1948 regelmäßig über die deutsche Bewegung von 1848, die ein Parlament sowie Presse- und Redefreiheit forderte. Zum Geburtstag bekam ich ein Buch über die deutsche Revolution, das 1893 herausgekommen war und Ereignisse schilderte, die mich ahnen ließen, was Demokratie war.
Ein Bericht faszinierte mich besonders. Er hatte mit dem Tag zu tun, an dem Robert Blum, der Führer der linken Fraktion des Paulskirchenparlaments, standrechtlich in Wien erschossen wurde. Jahre danach kletterte an jedem 9. November ein Mauergeselle auf den Frankfurter Domturm und hisste die verbotene schwarz-rot-goldene Fahne. Und jedes Mal musste der Senat der Stadt am anderen Tag einen Mann suchen, der bereit war, das Symbol deutscher Freiheit wieder herunterzuholen.
Ich erlebte das Programm für die Hundertjahrfeier zum Gedenken an die erste deutsche Nationalversammlung, das drei Tage dauerte. Am Hauptfeiertag läuteten schon um 8 Uhr alle Glocken. Professor Hallstein sprach, der Kanzler der Universität Chicago, Oberbürgermeister Kolb, der Direktor der Militärregierung und auch zuletzt der Festredner Fritz von Unruh, ein glühender Pazifist, der gerade aus der Emigration zurückgekehrt war.
Einen Monat später starb Opa Rausch, der einen Laden an der Ecke hatte. Er schenkte mir immer Bonbons. Seine Witwe behauptete, sie habe keine Ware mehr. Als ich durchs Kellerfenster sah, entdeckte ich Stapel mit Kaffee, Kakao, Butter und Seife. Am anderen Tag war Währungsreform, aber ich hatte nicht mal genug Geld, um ein Tütchen Bruchschokolade kaufen zu können.
Im Juli, als die Militärgouverneure den Ministerpräsidenten im IG-Farben-Haus den Auftrag zur Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung übergaben, sah ich mit Tausenden am Grüneburgplatz die Ankunft der Wagen.
Zwei Monate später stand in der Frankfurter Rundschau, der Hessische Ministerpräsident habe in Bonn die Beratungen des Parlamentarischen Rates eröffnet, dass das vorläufige Grundgesetz beschließen sollte. Und ich las, Frankfurt werde als Sitz des Wirtschaftsrates, der Bizonenämter und Ort der ersten Nationalversammlung am Ende der Beratung zur provisorischen Hauptstadt Westdeutschlands bestimmt.
Als ich im April 1949 meine Aufnahmeprüfung ins Gymnasium bestanden hatte, schrieb ich in ein Heft: Meine Heimatstadt wird Sitz einer vorläufigen Regierung im Westen, wie Berlin im Osten. Wenn die Menschen dann keine Armee wollen, bleiben wir vereint und Deutschland wird zu der Demokratie, für die ich mich stets einsetzen will.
Im Mai wurde Bonn Bundeshauptstadt und man verkündete das Grundgesetz. Vier Monate später fanden die ersten Bundestagswahlen statt. Doch schon im Oktober 1950, als ich im Internat lebte, entsetzte es meinen Lehrer, der die nordischen Länder lieben gelernt hatte, dass Pläne für eine Wiederbewaffnung geschmiedet wurden. Meine Schulkameraden, oft Söhne reicher, adliger Eltern, wollten sogar lieber auswandern, als in der Armee dienen.
Meinen Schulabschluss machte ich drei Jahre später in einer Schule in Baden, wo ich neben dem Unterricht in der Schreinerei arbeitete und bei einem jüdischen Ehepaar, das das KZ überlebt hatte, Schauspielunterricht erhielt.
Bevor ich die Lehre antrat, arbeitete ich als Bote in einem Verlag und als Heizer beim CVJM, dessen Leiter ein Schwede war, der hierher kam, um den Deutschen vorzuleben, was Demokratie war. Nachdem 1953 die zweite Bundestagswahl stattgefunden hatte und 1954 die Wehrergänzung zum Grundgesetz vom Parlament gebilligt wurde, reiste der Mann wieder in seine Heimat.
Als ich mit drei Bewerbern aus 200 ausgewählt wurde, die im März 1954 ihre Lehre als technische Zeichner bei einer Fabrik in Frankfurt antraten, hatte ich gute Chancen, Schiffbauingenieur zu werden, mein Traumberuf.
Ende Oktober wurde die Bundesrepublik, die noch keine Armee hatte, bei der Pariser Konferenz eingeladen, der NATO beizutreten. In der Mittagspause stritten viele der 100 Heranwachsenden des ersten Lehrjahres in der Kantine laut darüber. Einige bestürmten sogar die Ausbilder mit Fragen über die Zukunft. Wir ahnten, dass wir zu dem Jahrgang zählten, den man zuerst einzöge, wenn die Armee gegründet würde. Das wollte keiner. Wir hatten gerade Bombennächte überlebt, waren von Tieffliegern beschossen worden und hatten Großeltern, Eltern und Geschwister an der Front oder unter Trümmern verloren.
Ich blickte Werner an, meinen Nachbar an der Werkbank, ein Pfarrerssohn, dessen Großeltern in Buchenwald umgebracht worden waren. "Ich will nicht Soldat werden!" sagte ich.
"Ich auch nicht!" betonte Werner.
Der Obermeister eilte herbei: "Ihr seid hier in der Lehre und nicht zum Politisieren!" rief er.
"Wir haben das Recht, uns frei zu äußern. Steht im Grundgesetz!" widersprach ich erregt.
"Und du fällst immer auf, du mit deinem extremen Gerechtigkeitssinn!" schrie der Obermeister. "Eine Widerrede, und du fliegst!"
Drei Monate arbeitete ich still an meiner Drehbank oder zeichnete Schaltanlagen. Ende Januar 1955 wurden die Pariser Verträge ratifiziert. Es stand in der BILD-Zeitung, die ich in der Pause in der Lehrwerkstatt las.
"Ich zünde mich an, wenn ich zur Armee muss", schrie ich.
"Du versündigst dich!" rief Werner. "Außerdem weißt du noch nicht genau, welchen Jahrgang sie zuerst einberufen, wenn es überhaupt zu einer Bundesarmee kommt".
"Wenn das aber passiert und ich dran sein sollte...", unterbrach ich ihn.
"Aber es sind viele dagegen, nicht nur die Lehrlinge hier".
"Das reicht nicht!" schrie ich und sah, wie sich immer mehr Leute um uns versammelten.
"Es werden täglich mehr!" triumphierte Werner. "Der Widerstand gegen die Aufrüstung, der doch nur der deutschen Einheit dient, begann vor vier Jahren mit dem Rücktritt von Innenminister Heinemann".
"Genau", rief ein Ausbilder. "Er gründete mit Frau Wessel vom Zentrum die GVP wegen der geplanten Rüstung. Nun haben wir die außerparlamentarische Bewegung und die SPD auf unserer Seite. Und da soll es je wieder deutsches Militär geben?"
Bevor der Obermeister angerannt kam, standen einige wieder an ihren Werkbänken, aber es ging ein Raunen durch die Reihen, als er rief: "In einem Jahr steht die Armee!" Kurz abwartend fügte er hinzu: "Der erste Jahrgang dürfte dann der von 1937 sein!"
Da brüllte fast das ganze erste Lehrjahr, rund 100 Lehrlinge: "Nicht mit uns! Nicht mit uns!"
In mir tobte es, wie damals als Fritz mich anbettelte, ihm die Granaten zuzustecken, damit ihn der Heimleiter nicht mehr quälte. Auch jetzt musste ich was tun, um wieder frei atmen zu können und mich nie wieder mitschuldig zu fühlen.
Ich sprang auf die Werkbank, erhob die Hand zum Schwur und gelobte: "Sollten die mich einziehen, verbrenne ich mich mitten auf der Hauptwache!"
"Ich erinnere dich daran!" schrie der Obermeister, riss mich herunter und stieß mich vor sich her, der Meisterbude zu. Am nächsten Tag musste ich meine Papiere abholen. Da warteten 50 Lehrlinge, der Sohn des Pfarrers an der Spitze und sagten mir drohend, mich jeden 29. Januar an meinen Schwur zu erinnern.
Am 29. Januar 1956 standen tatsächlich 20 von ihnen vor der Firma, bei der ich als Operator von Bürodruckern arbeitete und wollten mich an meinen Schwur erinnern.
"Es gibt noch keine Wehrpflicht!" rief ich. "Sie mussten doch die erste Parade mit Freiwilligen abhalten!" Auf dem Heimweg betete ich, wie jeden Tag seit diesem letzten Januar, still dafür, das Entsetzliche möge niemals eintreten.
Es dauerte bis zum Juli 1956, als ich erfuhr, dass ich wegen des Stichtages 30. Juni genau achtundsechzig Tage zu alt für den ersten Jahrgang gezogener Rekruten sei und 'weißer Jahrgang'.
Ich atmete auf, fühlte mich wie neu geboren, unendlich dankbar und stark genug, ein Leben lang für Demokratie zu kämpfen.

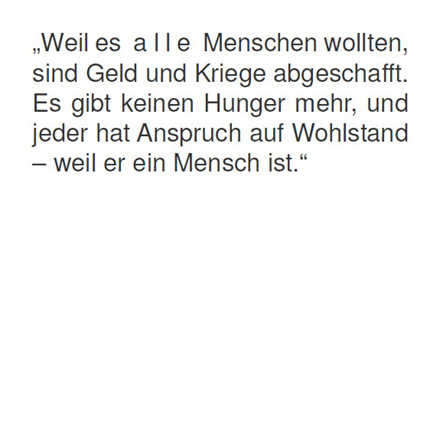
Aus der Arbeiterfotografie-Ausstellung "Kriegskinder" (siehe dazu auch http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=22222)
Siehe auch Auszüge aus dem Buch von Karl C. Fischer ERWACHSENDE KINDER:
1 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=23651
2 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=23667
3 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=23705
4 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=23728
5 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=23749
6 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=23766
Online-Flyer Nr. 612 vom 10.05.2017
Veröffentlicht zum 80. Geburtstag des Kölner Schriftstellers
Weißer Jahrgang
Von Karl C. Fischer
 Was mich prägte, geschah in den fünfziger Jahren. Es waren meine Ängste vor der Einberufung in die Bundeswehr. Dabei konnte ich den entstellten Körper von Fritz nicht vergessen, an dessen Tod ich mich schuldig fühlte und Alpträume bekam. Erst als ich mir geschworen hatte, nie Hitlerjunge zu werden und erst recht nicht Soldat, ging es mir besser. Fritz war Mitzögling im Waisenhaus, dem ich half, sich umzubringen, damit ihn der Heimleiter, ein sadistischer SA-Mann, nicht erschlug. Das war im September 1944.
Was mich prägte, geschah in den fünfziger Jahren. Es waren meine Ängste vor der Einberufung in die Bundeswehr. Dabei konnte ich den entstellten Körper von Fritz nicht vergessen, an dessen Tod ich mich schuldig fühlte und Alpträume bekam. Erst als ich mir geschworen hatte, nie Hitlerjunge zu werden und erst recht nicht Soldat, ging es mir besser. Fritz war Mitzögling im Waisenhaus, dem ich half, sich umzubringen, damit ihn der Heimleiter, ein sadistischer SA-Mann, nicht erschlug. Das war im September 1944.Im März 1945 befreiten amerikanische Truppen Frankfurt. Meine Angst schwand, dass man mich zwingen würde, Menschen zu töten. Am 8. Mai pflückte ich aus Freude über die herbeigesehnte Freiheit Trümmerblumen und steckte sie mir an die Hosenträger.
Drei Monate später gab es noch keinen Unterricht, aber die Frankfurter Rundschau, die erste deutsche Zeitung. Ich übte lesen und versuchte zu erfahren, was das noch fremde Wort Demokratie bedeutete.
Ich las, die katholischen Bischöfe hätten sich zur Mitverantwortung für die Verbrechen der NS-Zeit bekannt und auch die evangelische Kirche habe ihre Schuld zugegeben. Man schrieb, die CDU sei für Sozialismus und die SPD für die Sozialisierung der Wirtschaft. Doch über Demokratie sprach meist nur die Militärregierung.
Wieso, dachte ich noch im Januar 1946, als mich die Schulbehörde aufforderte, einmal in der Woche bei einer Lehrerin Aufgaben abzuholen. Als Unterrichtsmaterial diente das Lesebuch für Volksschulen von 1939, in dem auch Hitlers Reden standen.
Die Militärregierung verbot, NSDAP-Mitglieder zu beschäftigen und die Spruchkammern begannen mit den Entnazifizierungsverfahren. Mein Onkel, ein Spruchkammervorsitzender, stufte einen Nachbarn, der zu den SS-Totenkopfverbänden gehört hatte, als minderbelastet ein. Nach den Landtagswahlen im Dezember 1946 eröffnete der Mann ein Pelzgeschäft, in dem Ware angeboten wurde, die man alteingesessenen Händlern in Leipzig gestohlen hatte. Onkel verzieh dem Mann, vergaß aber seine Opfer. So beging der Kerl weiter Unrecht. Nun ahnte ich, Demokratie war nicht so wehrlos, wie sie der Onkel vorlebte.
Alle hungerten, auch die Kinder, doch nur sie starben zu Tausenden an Tuberkulose. Ich durfte überleben, aber ich musste nach langer Liegezeit in der Klinik erst wieder laufen lernen und dann die dritte Klasse nachholen. Nach meiner Versetzung in die vierte Klasse im Herbst 1947, berichtete die Zeitung ab Februar 1948 regelmäßig über die deutsche Bewegung von 1848, die ein Parlament sowie Presse- und Redefreiheit forderte. Zum Geburtstag bekam ich ein Buch über die deutsche Revolution, das 1893 herausgekommen war und Ereignisse schilderte, die mich ahnen ließen, was Demokratie war.
Ein Bericht faszinierte mich besonders. Er hatte mit dem Tag zu tun, an dem Robert Blum, der Führer der linken Fraktion des Paulskirchenparlaments, standrechtlich in Wien erschossen wurde. Jahre danach kletterte an jedem 9. November ein Mauergeselle auf den Frankfurter Domturm und hisste die verbotene schwarz-rot-goldene Fahne. Und jedes Mal musste der Senat der Stadt am anderen Tag einen Mann suchen, der bereit war, das Symbol deutscher Freiheit wieder herunterzuholen.
Ich erlebte das Programm für die Hundertjahrfeier zum Gedenken an die erste deutsche Nationalversammlung, das drei Tage dauerte. Am Hauptfeiertag läuteten schon um 8 Uhr alle Glocken. Professor Hallstein sprach, der Kanzler der Universität Chicago, Oberbürgermeister Kolb, der Direktor der Militärregierung und auch zuletzt der Festredner Fritz von Unruh, ein glühender Pazifist, der gerade aus der Emigration zurückgekehrt war.
Einen Monat später starb Opa Rausch, der einen Laden an der Ecke hatte. Er schenkte mir immer Bonbons. Seine Witwe behauptete, sie habe keine Ware mehr. Als ich durchs Kellerfenster sah, entdeckte ich Stapel mit Kaffee, Kakao, Butter und Seife. Am anderen Tag war Währungsreform, aber ich hatte nicht mal genug Geld, um ein Tütchen Bruchschokolade kaufen zu können.
Im Juli, als die Militärgouverneure den Ministerpräsidenten im IG-Farben-Haus den Auftrag zur Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung übergaben, sah ich mit Tausenden am Grüneburgplatz die Ankunft der Wagen.
Zwei Monate später stand in der Frankfurter Rundschau, der Hessische Ministerpräsident habe in Bonn die Beratungen des Parlamentarischen Rates eröffnet, dass das vorläufige Grundgesetz beschließen sollte. Und ich las, Frankfurt werde als Sitz des Wirtschaftsrates, der Bizonenämter und Ort der ersten Nationalversammlung am Ende der Beratung zur provisorischen Hauptstadt Westdeutschlands bestimmt.
Als ich im April 1949 meine Aufnahmeprüfung ins Gymnasium bestanden hatte, schrieb ich in ein Heft: Meine Heimatstadt wird Sitz einer vorläufigen Regierung im Westen, wie Berlin im Osten. Wenn die Menschen dann keine Armee wollen, bleiben wir vereint und Deutschland wird zu der Demokratie, für die ich mich stets einsetzen will.
Im Mai wurde Bonn Bundeshauptstadt und man verkündete das Grundgesetz. Vier Monate später fanden die ersten Bundestagswahlen statt. Doch schon im Oktober 1950, als ich im Internat lebte, entsetzte es meinen Lehrer, der die nordischen Länder lieben gelernt hatte, dass Pläne für eine Wiederbewaffnung geschmiedet wurden. Meine Schulkameraden, oft Söhne reicher, adliger Eltern, wollten sogar lieber auswandern, als in der Armee dienen.
Meinen Schulabschluss machte ich drei Jahre später in einer Schule in Baden, wo ich neben dem Unterricht in der Schreinerei arbeitete und bei einem jüdischen Ehepaar, das das KZ überlebt hatte, Schauspielunterricht erhielt.
Bevor ich die Lehre antrat, arbeitete ich als Bote in einem Verlag und als Heizer beim CVJM, dessen Leiter ein Schwede war, der hierher kam, um den Deutschen vorzuleben, was Demokratie war. Nachdem 1953 die zweite Bundestagswahl stattgefunden hatte und 1954 die Wehrergänzung zum Grundgesetz vom Parlament gebilligt wurde, reiste der Mann wieder in seine Heimat.
Als ich mit drei Bewerbern aus 200 ausgewählt wurde, die im März 1954 ihre Lehre als technische Zeichner bei einer Fabrik in Frankfurt antraten, hatte ich gute Chancen, Schiffbauingenieur zu werden, mein Traumberuf.
Ende Oktober wurde die Bundesrepublik, die noch keine Armee hatte, bei der Pariser Konferenz eingeladen, der NATO beizutreten. In der Mittagspause stritten viele der 100 Heranwachsenden des ersten Lehrjahres in der Kantine laut darüber. Einige bestürmten sogar die Ausbilder mit Fragen über die Zukunft. Wir ahnten, dass wir zu dem Jahrgang zählten, den man zuerst einzöge, wenn die Armee gegründet würde. Das wollte keiner. Wir hatten gerade Bombennächte überlebt, waren von Tieffliegern beschossen worden und hatten Großeltern, Eltern und Geschwister an der Front oder unter Trümmern verloren.
Ich blickte Werner an, meinen Nachbar an der Werkbank, ein Pfarrerssohn, dessen Großeltern in Buchenwald umgebracht worden waren. "Ich will nicht Soldat werden!" sagte ich.
"Ich auch nicht!" betonte Werner.
Der Obermeister eilte herbei: "Ihr seid hier in der Lehre und nicht zum Politisieren!" rief er.
"Wir haben das Recht, uns frei zu äußern. Steht im Grundgesetz!" widersprach ich erregt.
"Und du fällst immer auf, du mit deinem extremen Gerechtigkeitssinn!" schrie der Obermeister. "Eine Widerrede, und du fliegst!"
Drei Monate arbeitete ich still an meiner Drehbank oder zeichnete Schaltanlagen. Ende Januar 1955 wurden die Pariser Verträge ratifiziert. Es stand in der BILD-Zeitung, die ich in der Pause in der Lehrwerkstatt las.
"Ich zünde mich an, wenn ich zur Armee muss", schrie ich.
"Du versündigst dich!" rief Werner. "Außerdem weißt du noch nicht genau, welchen Jahrgang sie zuerst einberufen, wenn es überhaupt zu einer Bundesarmee kommt".
"Wenn das aber passiert und ich dran sein sollte...", unterbrach ich ihn.
"Aber es sind viele dagegen, nicht nur die Lehrlinge hier".
"Das reicht nicht!" schrie ich und sah, wie sich immer mehr Leute um uns versammelten.
"Es werden täglich mehr!" triumphierte Werner. "Der Widerstand gegen die Aufrüstung, der doch nur der deutschen Einheit dient, begann vor vier Jahren mit dem Rücktritt von Innenminister Heinemann".
"Genau", rief ein Ausbilder. "Er gründete mit Frau Wessel vom Zentrum die GVP wegen der geplanten Rüstung. Nun haben wir die außerparlamentarische Bewegung und die SPD auf unserer Seite. Und da soll es je wieder deutsches Militär geben?"
Bevor der Obermeister angerannt kam, standen einige wieder an ihren Werkbänken, aber es ging ein Raunen durch die Reihen, als er rief: "In einem Jahr steht die Armee!" Kurz abwartend fügte er hinzu: "Der erste Jahrgang dürfte dann der von 1937 sein!"
Da brüllte fast das ganze erste Lehrjahr, rund 100 Lehrlinge: "Nicht mit uns! Nicht mit uns!"
In mir tobte es, wie damals als Fritz mich anbettelte, ihm die Granaten zuzustecken, damit ihn der Heimleiter nicht mehr quälte. Auch jetzt musste ich was tun, um wieder frei atmen zu können und mich nie wieder mitschuldig zu fühlen.
Ich sprang auf die Werkbank, erhob die Hand zum Schwur und gelobte: "Sollten die mich einziehen, verbrenne ich mich mitten auf der Hauptwache!"
"Ich erinnere dich daran!" schrie der Obermeister, riss mich herunter und stieß mich vor sich her, der Meisterbude zu. Am nächsten Tag musste ich meine Papiere abholen. Da warteten 50 Lehrlinge, der Sohn des Pfarrers an der Spitze und sagten mir drohend, mich jeden 29. Januar an meinen Schwur zu erinnern.
Am 29. Januar 1956 standen tatsächlich 20 von ihnen vor der Firma, bei der ich als Operator von Bürodruckern arbeitete und wollten mich an meinen Schwur erinnern.
"Es gibt noch keine Wehrpflicht!" rief ich. "Sie mussten doch die erste Parade mit Freiwilligen abhalten!" Auf dem Heimweg betete ich, wie jeden Tag seit diesem letzten Januar, still dafür, das Entsetzliche möge niemals eintreten.
Es dauerte bis zum Juli 1956, als ich erfuhr, dass ich wegen des Stichtages 30. Juni genau achtundsechzig Tage zu alt für den ersten Jahrgang gezogener Rekruten sei und 'weißer Jahrgang'.
Ich atmete auf, fühlte mich wie neu geboren, unendlich dankbar und stark genug, ein Leben lang für Demokratie zu kämpfen.

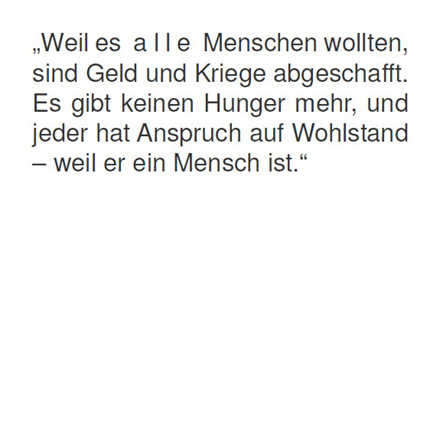
Aus der Arbeiterfotografie-Ausstellung "Kriegskinder" (siehe dazu auch http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=22222)
Siehe auch Auszüge aus dem Buch von Karl C. Fischer ERWACHSENDE KINDER:
1 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=23651
2 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=23667
3 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=23705
4 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=23728
5 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=23749
6 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=23766
Online-Flyer Nr. 612 vom 10.05.2017















