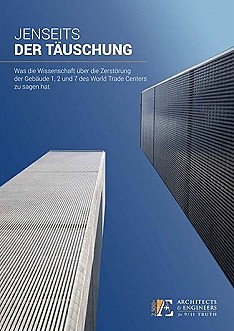SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Literatur
Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 7
Max - Jahrgang 27
Von Lutz Köhlert
Vor dem Haus ist niemand zu sehen, aber Stimmengewirr dringt heraus.
Max und Bodo nähern sich vorsichtig von der Rückseite, und Schmude schaut ins Fenster: „Der Posten ist drin. Wir lassen die Beutel hier.“ Er sieht sich um und stopft die Kastanien in ein Drainagerohr unterhalb des Bahndamms. Dann gehen sie hinein.
In der Küche herrscht Gedränge und aufgeregtes Gerede. Tünnes bemüht sich zu übersetzen, was der Posten sagt: „Jetzt haltet doch emal eure Goschen! Also: Sonntagvormittag kommt der Friseur, um neune. Alle Haare müssen runter, ratzekahl! Is wejen der Hygiene und kostet zehn Francs.“
Es entsteht allgemeine Aufregung: „Quatsch, Hygiene! Die wollen uns abstempeln.“
„Der Barbier will bloß ’n Geschäft machen.“
„Dann sehn wir ja aus wie die Russen!“ empört sich Sigi.
„Dazu brauchst du dir keine Glatze zu schneiden ...“, nimmt Tünnes ihn hoch.
Skrosznys Kommentar klingt etwas gröber: „Bezahlen soll’n wir das auch noch? Die ham woll ’ne Vollmeise!“
„Ist das überhaupt nach der Genfer Konvention?“ will Hugo Schmelzer wissen.
Schmelzer ist ein mittelgroßer knochiger Endvierziger mit Vollbart und gierigen roten Lippen, von Beruf Apotheker, aber ein bißchen schmierig, zudringlich, besserwisserisch und ein ausgeprägter Pessimist.
Tünnes übersetzt seine scheinbar sachliche Frage: „Est-ce que c’est permis sélon la Convention de Genève?“
Der Posten war im Krieg Maquard und hat nach dem Krieg die Kommunisten mit Stalin gewählt. Jetzt bleibt er gleichmütig, aber stur: „Est-ce que la SS a regardé sur la Convention de Genève lorsqu’ils ont brûlé Florac?“
„Er sagt, die SS habe auch nicht nach der Genfer Konvention gefragt, als sie Florac niedergebrannt hat.“
„Auch so ’n Greuelmärchen!“ verteidigt Sigi immer noch das Dritte Reich.
„Na, Florac ist hier um die Ecke. Kannste dir ansehen.“
„Alors, c’est tout?“ Der Posten hat keine Lust, weiterzudiskutieren, und schiebt sich hinaus.
Hinter ihm verebbt der Lärm in einer wirren Debatte zwischen Resignation – „Kannste doch nischt gegen machen“ – und Rachegedanken – „Dann überfallen wir den Ingenieur und rasieren ihm auch ’ne Glatze!“ ‚Der Ingenieur‘, Monsieur Lejeune, ist der Chef des Bergwerks. Unter ihm steht ein spanischer Steiger und unter diesem wieder der Untersteiger Mauser. Lejeune ist ein schmaler junger Mann mit einer schlanken, etwas blassen und durchsichtigen Frau, der sich immer für seine Einmischung zu entschuldigen scheint.
Schließlich findet man einen gemeinsamen Nenner: Gegen den Haarschnitt wird man sich auf die Dauer nicht zur Wehr setzen können. In den größeren Lagern werden allen Gefangenen Glatzen geschnitten. Daß man sich dadurch gedemütigt fühlt und wohl auch fühlen soll, steht auf einem anderen Blatt.
Auch Max empfindet es als Herabwürdigung, zumal er eigentlich kein Kriegsgefangener, sondern ein Internierter ist, der darüber hinaus zur Zwangsarbeit deportiert wurde. Aber kann es eine Schande sein, sich einem Zwang zu fügen?
Schändlich kann doch nur eine selbst begangene Tat oder Unterlassung sein. Max lernt, daß Ehre oder Ehrlosigkeit nur die Folge eigenen Verhaltens sein können. Ein anderer kann einem Ehre weder nehmen noch schenken.
Er gewinnt Abstand zu der törichten Geschichte, mit der er vor drei Jahren den ‚Erzählerwettbewerb‘ in einem Jungvolk-Lager gewonnen hatte.
In Kürze ging die Geschichte so: Friedrich II. hatte vor angetretener Truppe einen jungen Leutnant gekränkt. Der trat in strammer Haltung drei Schritte vor, sprach: „Eure Majestät haben mich beleidigt. Ich fordere Eure Majestät zum Duell!“, zog seine Pistole und richtete sie auf den König. Der König stand unbeweglich. Der Leutnant fuhr fort: „Als Beleidigter habe ich den ersten Schuß.“ Sprach’s und feuerte in die Luft. „Ich habe Eure Majestät verfehlt“, sagte der Leutnant, und weiter: „Da ich nicht erwarten kann, daß Euer Majestät auch nur einen Finger für mich krümmt, nehme ich mir die Freiheit, an Stelle Eurer Majestät zu schießen.“ Er richtete die Pistole gegen seinen Kopf und erschoß sich selber.
Vor drei Jahren noch fand Max das heldisch. Heute findet er’s blöde.
Aber er hatte auch einmal vor versammelter Mannschaft seinem Kompaniechef die Meinung gesagt, als der sie über den schlackebefestigten Kasernenhof robben ließ, bis die Jackenärmel durchgescheuert und die Ellbogen blutig waren. Max stand auf und nahm stramme Haltung an: „Gestatten Sie, Herr Leutnant, aber das ist eine sinnlose Schinderei! Wer hat was davon, wenn nachher die halbe Kompanie ins Krankenrevier zieht und dienstuntauglich geschrieben wird?!“ Der Leutnant bekam fast einen Schlaganfall und drohte mit Kriegsgericht und Festung als mildester Strafe. Die Strafe blieb aber aus. Immerhin hatte Max nicht versucht, seinen Leutnant oder sich selber umzubringen.
Man kommt überein, die Glatzen müssen sein, aber – man wird dafür nicht auch noch bezahlen. Die Haare abschneiden können sie selber!
Einige wollen den Anschein retten und dringen darauf, einen halben Zentimeter stehenzulassen, andere machen aus der Not einen Stil und lassen sich die Glatzen auch noch rasieren. Skroszny läßt sich nur das Schläfenhaar stutzen und stopft seine langen Scheitelhaare unter die Mütze, die er in den nächsten zwei Monaten nur noch im Bett abnimmt. Seine Frisur hat einen etwas ungewöhnlichen Charme.
Max legt sich eine spiegelblanke Glatze zu ...
Diese Pflichtübung hat aber auch eine unerwartet positive Folge.
Der Empfang des Friseurs am Sonntagmorgen wird zu einem Fest.
Der Dorffriseur erscheint in Begleitung des Postens mit seinem Handwerkszeug vor dem Haus. Die Gefangenen sind entgegen sonntäglicher Gepflogenheit alle schon aufgestanden und einigermaßen bekleidet. Die Haustür ist verriegelt, der Posten muß klopfen. Als niemand öffnet, versucht er es am Hintereingang – vergeblich. Er schaut ins Fenster, kann aber nichts erkennen. Nach wiederholtem Klopfen wird ihm mit gespieltem Erstaunen geöffnet: „Bonjour, monsieur!“ – „Schon so früh auf?“ – „Da isser ja, was willer denn?“ Eigenartigerweise haben alle Gefangenen Mützen auf.
Posten und Friseur sind etwas verwirrt, und der Posten will nochmals erklären: „C’est le coiffeur! Je l’avais annoncé. Alors, ouvrez qu’il puisse entrer ...“
Jetzt wird die Tür geöffnet, und als Posten und Friseur eingetreten sind, reißen die Gefangenen wie auf Kommando die Mützen vom Kopf und weisen allesamt kahlgeschorene Schädel vor! Gleichzeitig brüllen sie vor Lachen los und hopsen vor Vergnügen. Selbst der Posten muß lachen. Daß der Friseur wütend ist, wundert keinen, und der Posten muß sich sein Lachen verkneifen, um ihn nicht noch wütender zu machen. Er macht abrupt kehrt und stiefelt wieder nach Hause.
Dem Posten wird noch eine Selbstgedrehte angeboten, bevor auch er sich zum Gehen und seiner Sonntagsruhe zuwendet.
Die Gefangenen feiern ihren Erfolg mit frechen Reden:
„Dem haben wir aber das Geschäft vermasselt! Zweihundertsechzig Francs im Eimer!“
„Gottlieb kannste nicht mitzählen, der hat sowieso ’ne Glatze.“
„Du siehst aus, als hätt’ste die Motten.“
„Na und du siehst sowieso aus wie ’n Arsch mit Ohren.“
„Du fängst gleich ’n Ding!“
Und was der blumigen Sprüche mehr sind.
Bodo Schmude kratzt sich ausgiebig: „Mich jucken die Schnipsel noch überall.“
„Vielleicht solltest du dich mal waschen“, schlägt Tünnes vor.
„Waschen macht die Haut dünne.“
Hugo Schmelzer mustert ihn scharf: „Sind deine Klamotten vielleicht bewohnt?“ Er geht dichter an Bodo heran und betrachtet Kopf und Kragen. Bodo Schmude will ausweichen: „Geh mir von der Pelle!“, aber Hugo Schmelzer hält ihn fest: „Warte mal, Jungchen!“ Er klappt den Kragen der dreckigen Jacke zurück und sucht die Nähte ab, dann weicht er angeekelt zurück: „Ein Wunder, daß dich die Bienen nicht wegtragen! Du weidest ja ganze Herden.“
Max ist entsetzt: „Mich juckt’s auch schon überall!“ Er zieht seine Jacke aus und betrachtet die Nähte: „Ich seh aber nischt.“
Schmelzers erfahrener Blick entdeckt die Gesuchten: „Da sind sie doch.“
Ein allgemeines großes Suchen setzt ein, und schnell finden sich auch bei anderen Kleiderläuse. Auf dem Kopf hat sie offenbar nur Schmude.
Emil bringt entschlossen eine Richtung in die allgemeine Aufregung: „Nu is Schluß mit dem Dreck!“ Er ruft in die Küche: „Tünnes! Setz ’n jroßen Kessel Wasser auf. Wir eröffnen eine Entlausungsanstalt.“
Gegen die Trägheit des einen oder anderen setzt ein hektischer Betrieb ein: Wasser wird angeschleppt, Kleidungsstücke fliegen durch die Gegend, manchmal ‚versehentlich‘ jemandem um die Ohren, der ärgerliche Anlaß der Aufregung wird mit munteren Reden zu einer allgemeinen Gaudi.
„He! Behalt deine Bienen für dich! Du Läusemutterschiff.“
„Verzeihung, Gnädigste!“
„Ich werde das mal auf einen Haufen schmeißen, zum Verbrennen.“
„Du hast sie wohl nicht mehr alle beisammen, du Filzkopp. Jib die Jacke her! Die brauch’ ick für die nächste Modenschau.“
„Oh, ich dachte, du bist Mannequin für Bademoden.“
„Du doch auch – in der Entlausungsanstalt.“
Der allgemeine Anfall von Reinlichkeit und Ordnungssinn treibt Emil Lehmbäcker in die Kammer, in der Bodo Schmude eine speckige Matratze als Bett dient. „Mann, das stinkt ja hier wie drei beschissene Offizierslatrinen!“ tönt es aus dem Kabuff. „Ich hab’ immer gedacht, das Klosett nebenan stinkt so, aber neechen, dat sind Bodos Schätze!“
Schmudes Lager ist umgeben von allerlei Gerümpel, das man im Dunklen kaum identifizieren kann. Emil schleudert es mit spitzen Fingern ans Licht: Teile eines Bettgestells, ein zerlumptes Kissen, mehrere Nachttöpfe, ein Bidet mit geplatztem Email, ein gigantischer BH aus rosa Spitze, ein alter Korb, leere Flaschen, Wollsocken, denen die Fersen fehlen, und andere Kostbarkeiten mehr.
Viele Hände befördern den Kram geräuschvoll und in weitem Schwung hinaus auf einen großen Haufen. Hugo bemüht sich, das eine oder andere zu retten, wird aber von Max und Schmelzer daran gehindert.
Emil bewertet die Funde: „Sammelst du für die Weltausstellung oder wem willst du Konkurrenz machen?“
Skroszny hat sich auf seine Pritsche verzogen und will seine Ruhe haben: „Macht bloß nicht solchen Aufriß. Dat is’ doch unjemütlich ...“
Dann fällt ein Schein von Tageslicht aus der Kammer, und Emil schreit verwundert auf: „Mannchen! Hier ist ja sojar ein Fensterchen!“ Ein alte Badewanne hatte anscheinend das Fenster verdeckt und Emil kantet sie jetzt mühevoll durch die Kammertür: „Ich jlaube, das Kammerchen müssen wir ausschwefeln ...“
Die Sonne lacht, die Luft ist warm, das allgemeine Waschen und Reinemachen breitet sich um das Haus herum aus als ein Akt der Befreiung von Tristesse und Gammelei, von ‚laisser faire‘ und ‚laissez aller‘. Man wäscht Körper und Seele. Man kocht Wäsche, flickt Kleidung, schrubbt Dielen und bessert die faustgroßen Löcher aus, durch die man bis in den Keller schauen kann. Auch vom Hang vor dem Haus wird das Gerümpel beiseite geschafft und auf dem Hof auf einen Haufen gekippt. Am Hang wird ein kleiner Sitzplatz planiert und aus rohen Brettern werden ein Tisch und zwei Bänke zusammengenagelt.
Dorfbewohner schauen von der Straße aus verwundert auf das eifrige Treiben herab, die Männer lassen sich dadurch nicht stören.
Bodo Schmude ist bis auf eine Turnhose entblößt, sein Körper ist von Pickeln und Stichen übersät, Emil und Schmelzer schrubben den Protestierenden ab. Schmude strampelt: „Ick kann mir alleene waschen!“ Emil geht von den nackten Tatsachen aus: „Offenbar kannste nich.“
Sigi politisiert den hygienischen Mißstand: „Der reinste Auschwitz-Körper.“
Max versteht nicht, wovon die Rede ist: „Was heißt ‚Auschwitz-Körper‘?“
Sigi erläutert: „Der sieht aus wie ’n KZler.“
Max ist ehrlich nicht im Bilde: „Wieso? Waren die alle so dreckig?“
Tünnes betrachtet verwundert Max, als ob er von einem anderen Stern käme: „Mann! Die waren halb verhungert und sahen aus wie der Tod auf Latschen! Die hat man geprügelt und geschunden, bevor sie in die Gaskammer kamen und umgebracht wurden wie die Ratten! Das Tausendjährige Reich ist schon ein halbes Jahr im Eimer, und du hast noch nicht begriffen, was sich da abgespielt hat?“
Max ist es peinlich, daß er so wenig weiß: „In Norwegen haben sie uns davon nichts erzählt.“
Tanne wäscht sein Unterhemd und schaut resignierend durch die Löcher: „Zu viele haben Dreck am Stecken. Aber es kommt alles ans Tageslicht!“
Wie die Wellen nach einem Steinwurf ins Wasser breitet sich jetzt eine Diskussion über die KZ der Nazis aus. Sie wird aber nicht leidenschaftlich geführt, eher beiläufig, nahezu uninteressiert. Und sie erlischt so leicht, wie sie aufgeflammt ist. Man bespricht das Thema nur widerwillig.
Sigi hat seine eigene Wahrheit: „Ihr erzählt doch bloß Greuelmärchen!“
Auch Skroszny wäscht jetzt sein Hemd: „Von wejen Greuelmärchen! Ich habe Dachau gesehen. Die Häftlinge sind geprügelt worden, Männer, Frauen, Kinder. Die Aufseher haben sie totjeschlagen oder abjeschossen! Sie haben sie auf jede denkbare Art umjebracht. Und die übrijen wurden vergast. Juden, Kommunisten, Sozialdemokraten, Zigeuner!“
Sigi bleibt stur: „Zigeuner, Schwule, Zuhälter! Alles Schwindel. Arbeiten mußte die faule Bande. Einmal im Leben richtig malochen, das ist alles!“
Solche Sturheit macht Skroszny wütend: „Wo warst du denn, wenn du es besser weißt? Hast du vielleicht so ’n Lager bewacht?“
Sigi ist erschrocken: „Wie kommst du darauf? Ich glaube bloß nicht, was ich nicht selber gesehen habe. Und der deutsche Soldat hat sich anständig benommen! Vielleicht bei der WaffenSS das eine oder andere ...“
Emil meckert ein böses Lachen: „Da warste wohl nie bei, wenn wir in Rußland ein Dorf angezündet haben?“
Sigi verteidigt sich zunehmend hektisch: „Die Russen haben unsere Frauen vergewaltigt!“
Skroszny nickt: „Ja. Und wie ich in St-Laurent in ein Haus gehe, weil ich Geschrei höre, sind drei ‚anständige deutsche Soldaten‘ dabei, einer Französin einen reinzudrehen. Wie nennste denn das, du Schlauberger?“
Sigi murmelt noch irgend etwas und wendet sich ab, weil man ihm nicht zuhören will.
Der Abend wird mild. Man sitzt auf den neu gebauten Bänken, trinkt ‚un canon‘, einen kleinen Roten, dreht sich aus den letzten Tabakkrümeln eine Zigarette und spinnt Strategien für ein süßes Leben, Pläne für die Zukunft.
„Heimat, deine Sterne ...!“
Das Ganze spielt wie auf einem Theater zwischen Haus und Straße, mit dem Unterschied, daß der Zuschauerraum hier höher liegt als die Bühne. Ein Mädchenlachen läßt die Männer aufschauen. Auf der Straße amüsieren sich die jugendlichen Dorfschönen über die Kahlköpfe und ihre Männerwirtschaft.
Die Männer grinsen und winken: „Hallo!“, „Bonjour“, „Ça va?“
Max ist das peinlich, aber Bodo Schmude stellt sich in Positur und ruft hinauf: „He, Mademoiselle! Bonjour. Wulleh wuh promeneh?“ Er wirft Handküsse hinauf: „Wulleh wuh beseh?“
Bodos Französisch ist dünn. Er weiß nicht – ebensowenig wie Max –, daß im Französischen das Wort ‚baiser – küssen‘, so direkt gebraucht, immer die letzte Konsequenz der Liebe meint, den Beischlaf, und eigentlich nicht ausgesprochen werden darf. Die Mädchen werden denn auch rot, hören auf zu lachen und laufen davon.
Bodo bemerkt nicht, daß er ins Fettnäpfchen getreten ist, und erklärt großspurig: „Sehta? Man muß nur ranjehn.“
Aus der Tür der großen Stube kommt jetzt Robert mit einem Eimer voll Steine, an dem Gottlieb weinerlich-wütend herumzerrt: „Meine Steinsammlung! Nicht doch! Die habe ich gerade geordnet.“ Robert kippt die Ladung ungerührt auf den Hang: „Steck sie dir meinetwegen in den Hintern! Aber breite sie nicht auf meinem Bett aus.“
Gottlieb klaubt einige Steine wieder zusammen und wendet sich Hilfe heischend an Max, der am nächsten steht: „Sieh mal, Max, meine schöne Sammlung!“ Er zeigt ihm einzelne Steine: „Das hier ist Rotstein. Siehst du die schöne Farbe? Und hier – Blaustein. Wie der Mond am Tage. Alles ganz blau und silbern. Er ist am schönsten, wenn er naß ist.“ Gottlieb denkt gerne in poetischen Bildern, und Max nimmt ihn ein bißchen auf den Arm: „Wann ist denn der Mond naß, Gottlieb?“ Gottlieb wird keine Spur verlegen, sondern erläutert: „Wenn ihn die Wolkenschwämme waschen. Hast du noch nie gesehen?“
Sigi reibt sich gerne an Schwächeren: „Ist das nicht Silberstein?“
Gottlieb nimmt die Frotzelei ernst: „Oh nein! Silberstein muß ganz silbern sein, höchstens ein bißchen Gold dazwischen ...“
Sigi stichelt weiter: „Silberstein, Blaustein – gibt’s auch ’n Itzig-Stein oder ’n Moses-Stein?“
Das versteht Gottlieb nicht: „Wieso?“
Tünnes kann Sigis angeberische Tour nicht leiden, er kann seinen Nazi-Drall nicht leiden, er kann den ganzen Kerl nicht leiden. Tünnes selber ist geradlinig und offen, heitergelassen und strebt nach Gerechtigkeit in dem Bewußtsein, daß sie nur in Bruchstücken existiert. Hier hat er Mitleid mit dem arglosen Gottlieb und versucht, die Lage zu entspannen: „Wir werden mal aufpassen, Gottlieb, ob wir ’n Silberstein für dich finden. Und wenn wir nächstens wieder Käse kriegen, kriste die Schachtel zum Dareintun, damit de den Robert nicht ärjerst. Und“, Tünnes schaut Robert an, „der Robert wird sich nicht so aufpusten, wenn er mal über den Karton stolpert!“
Der Tritt vors Schienbein war nur verbal, aber Robert versteht, daß er durchaus real werden könnte.
Gottlieb sucht schon wieder die schönsten Steine aus dem Haufen zusammen und freut sich: „Ja, das wäre schön. Da wäre ich sehr dankbar!“
Einen Augenblick lang empfindet auch Max das Heil des Narren, der eine unbarmherzige Wirklichkeit einfach nicht zur Kenntnis nimmt. (PK)
Lesen Sie die Fortsetzung des biografischen Romans in der kommenden Ausgabe, oder - bequemer - bestellen Sie das Buch bei edition winterwork
Online-Flyer Nr. 300 vom 04.05.2011
Druckversion
Literatur
Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 7
Max - Jahrgang 27
Von Lutz Köhlert
Vor dem Haus ist niemand zu sehen, aber Stimmengewirr dringt heraus.
Max und Bodo nähern sich vorsichtig von der Rückseite, und Schmude schaut ins Fenster: „Der Posten ist drin. Wir lassen die Beutel hier.“ Er sieht sich um und stopft die Kastanien in ein Drainagerohr unterhalb des Bahndamms. Dann gehen sie hinein.
In der Küche herrscht Gedränge und aufgeregtes Gerede. Tünnes bemüht sich zu übersetzen, was der Posten sagt: „Jetzt haltet doch emal eure Goschen! Also: Sonntagvormittag kommt der Friseur, um neune. Alle Haare müssen runter, ratzekahl! Is wejen der Hygiene und kostet zehn Francs.“
Es entsteht allgemeine Aufregung: „Quatsch, Hygiene! Die wollen uns abstempeln.“
„Der Barbier will bloß ’n Geschäft machen.“
„Dann sehn wir ja aus wie die Russen!“ empört sich Sigi.
„Dazu brauchst du dir keine Glatze zu schneiden ...“, nimmt Tünnes ihn hoch.
Skrosznys Kommentar klingt etwas gröber: „Bezahlen soll’n wir das auch noch? Die ham woll ’ne Vollmeise!“
„Ist das überhaupt nach der Genfer Konvention?“ will Hugo Schmelzer wissen.
Schmelzer ist ein mittelgroßer knochiger Endvierziger mit Vollbart und gierigen roten Lippen, von Beruf Apotheker, aber ein bißchen schmierig, zudringlich, besserwisserisch und ein ausgeprägter Pessimist.
Tünnes übersetzt seine scheinbar sachliche Frage: „Est-ce que c’est permis sélon la Convention de Genève?“
Der Posten war im Krieg Maquard und hat nach dem Krieg die Kommunisten mit Stalin gewählt. Jetzt bleibt er gleichmütig, aber stur: „Est-ce que la SS a regardé sur la Convention de Genève lorsqu’ils ont brûlé Florac?“
„Er sagt, die SS habe auch nicht nach der Genfer Konvention gefragt, als sie Florac niedergebrannt hat.“
„Auch so ’n Greuelmärchen!“ verteidigt Sigi immer noch das Dritte Reich.
„Na, Florac ist hier um die Ecke. Kannste dir ansehen.“
„Alors, c’est tout?“ Der Posten hat keine Lust, weiterzudiskutieren, und schiebt sich hinaus.
Hinter ihm verebbt der Lärm in einer wirren Debatte zwischen Resignation – „Kannste doch nischt gegen machen“ – und Rachegedanken – „Dann überfallen wir den Ingenieur und rasieren ihm auch ’ne Glatze!“ ‚Der Ingenieur‘, Monsieur Lejeune, ist der Chef des Bergwerks. Unter ihm steht ein spanischer Steiger und unter diesem wieder der Untersteiger Mauser. Lejeune ist ein schmaler junger Mann mit einer schlanken, etwas blassen und durchsichtigen Frau, der sich immer für seine Einmischung zu entschuldigen scheint.
Schließlich findet man einen gemeinsamen Nenner: Gegen den Haarschnitt wird man sich auf die Dauer nicht zur Wehr setzen können. In den größeren Lagern werden allen Gefangenen Glatzen geschnitten. Daß man sich dadurch gedemütigt fühlt und wohl auch fühlen soll, steht auf einem anderen Blatt.
Auch Max empfindet es als Herabwürdigung, zumal er eigentlich kein Kriegsgefangener, sondern ein Internierter ist, der darüber hinaus zur Zwangsarbeit deportiert wurde. Aber kann es eine Schande sein, sich einem Zwang zu fügen?
Schändlich kann doch nur eine selbst begangene Tat oder Unterlassung sein. Max lernt, daß Ehre oder Ehrlosigkeit nur die Folge eigenen Verhaltens sein können. Ein anderer kann einem Ehre weder nehmen noch schenken.
Er gewinnt Abstand zu der törichten Geschichte, mit der er vor drei Jahren den ‚Erzählerwettbewerb‘ in einem Jungvolk-Lager gewonnen hatte.
In Kürze ging die Geschichte so: Friedrich II. hatte vor angetretener Truppe einen jungen Leutnant gekränkt. Der trat in strammer Haltung drei Schritte vor, sprach: „Eure Majestät haben mich beleidigt. Ich fordere Eure Majestät zum Duell!“, zog seine Pistole und richtete sie auf den König. Der König stand unbeweglich. Der Leutnant fuhr fort: „Als Beleidigter habe ich den ersten Schuß.“ Sprach’s und feuerte in die Luft. „Ich habe Eure Majestät verfehlt“, sagte der Leutnant, und weiter: „Da ich nicht erwarten kann, daß Euer Majestät auch nur einen Finger für mich krümmt, nehme ich mir die Freiheit, an Stelle Eurer Majestät zu schießen.“ Er richtete die Pistole gegen seinen Kopf und erschoß sich selber.
Vor drei Jahren noch fand Max das heldisch. Heute findet er’s blöde.
Aber er hatte auch einmal vor versammelter Mannschaft seinem Kompaniechef die Meinung gesagt, als der sie über den schlackebefestigten Kasernenhof robben ließ, bis die Jackenärmel durchgescheuert und die Ellbogen blutig waren. Max stand auf und nahm stramme Haltung an: „Gestatten Sie, Herr Leutnant, aber das ist eine sinnlose Schinderei! Wer hat was davon, wenn nachher die halbe Kompanie ins Krankenrevier zieht und dienstuntauglich geschrieben wird?!“ Der Leutnant bekam fast einen Schlaganfall und drohte mit Kriegsgericht und Festung als mildester Strafe. Die Strafe blieb aber aus. Immerhin hatte Max nicht versucht, seinen Leutnant oder sich selber umzubringen.
Man kommt überein, die Glatzen müssen sein, aber – man wird dafür nicht auch noch bezahlen. Die Haare abschneiden können sie selber!
Einige wollen den Anschein retten und dringen darauf, einen halben Zentimeter stehenzulassen, andere machen aus der Not einen Stil und lassen sich die Glatzen auch noch rasieren. Skroszny läßt sich nur das Schläfenhaar stutzen und stopft seine langen Scheitelhaare unter die Mütze, die er in den nächsten zwei Monaten nur noch im Bett abnimmt. Seine Frisur hat einen etwas ungewöhnlichen Charme.
Max legt sich eine spiegelblanke Glatze zu ...
Diese Pflichtübung hat aber auch eine unerwartet positive Folge.
Der Empfang des Friseurs am Sonntagmorgen wird zu einem Fest.
Der Dorffriseur erscheint in Begleitung des Postens mit seinem Handwerkszeug vor dem Haus. Die Gefangenen sind entgegen sonntäglicher Gepflogenheit alle schon aufgestanden und einigermaßen bekleidet. Die Haustür ist verriegelt, der Posten muß klopfen. Als niemand öffnet, versucht er es am Hintereingang – vergeblich. Er schaut ins Fenster, kann aber nichts erkennen. Nach wiederholtem Klopfen wird ihm mit gespieltem Erstaunen geöffnet: „Bonjour, monsieur!“ – „Schon so früh auf?“ – „Da isser ja, was willer denn?“ Eigenartigerweise haben alle Gefangenen Mützen auf.
Posten und Friseur sind etwas verwirrt, und der Posten will nochmals erklären: „C’est le coiffeur! Je l’avais annoncé. Alors, ouvrez qu’il puisse entrer ...“
Jetzt wird die Tür geöffnet, und als Posten und Friseur eingetreten sind, reißen die Gefangenen wie auf Kommando die Mützen vom Kopf und weisen allesamt kahlgeschorene Schädel vor! Gleichzeitig brüllen sie vor Lachen los und hopsen vor Vergnügen. Selbst der Posten muß lachen. Daß der Friseur wütend ist, wundert keinen, und der Posten muß sich sein Lachen verkneifen, um ihn nicht noch wütender zu machen. Er macht abrupt kehrt und stiefelt wieder nach Hause.
Dem Posten wird noch eine Selbstgedrehte angeboten, bevor auch er sich zum Gehen und seiner Sonntagsruhe zuwendet.
Die Gefangenen feiern ihren Erfolg mit frechen Reden:
„Dem haben wir aber das Geschäft vermasselt! Zweihundertsechzig Francs im Eimer!“
„Gottlieb kannste nicht mitzählen, der hat sowieso ’ne Glatze.“
„Du siehst aus, als hätt’ste die Motten.“
„Na und du siehst sowieso aus wie ’n Arsch mit Ohren.“
„Du fängst gleich ’n Ding!“
Und was der blumigen Sprüche mehr sind.
Bodo Schmude kratzt sich ausgiebig: „Mich jucken die Schnipsel noch überall.“
„Vielleicht solltest du dich mal waschen“, schlägt Tünnes vor.
„Waschen macht die Haut dünne.“
Hugo Schmelzer mustert ihn scharf: „Sind deine Klamotten vielleicht bewohnt?“ Er geht dichter an Bodo heran und betrachtet Kopf und Kragen. Bodo Schmude will ausweichen: „Geh mir von der Pelle!“, aber Hugo Schmelzer hält ihn fest: „Warte mal, Jungchen!“ Er klappt den Kragen der dreckigen Jacke zurück und sucht die Nähte ab, dann weicht er angeekelt zurück: „Ein Wunder, daß dich die Bienen nicht wegtragen! Du weidest ja ganze Herden.“
Max ist entsetzt: „Mich juckt’s auch schon überall!“ Er zieht seine Jacke aus und betrachtet die Nähte: „Ich seh aber nischt.“
Schmelzers erfahrener Blick entdeckt die Gesuchten: „Da sind sie doch.“
Ein allgemeines großes Suchen setzt ein, und schnell finden sich auch bei anderen Kleiderläuse. Auf dem Kopf hat sie offenbar nur Schmude.
Emil bringt entschlossen eine Richtung in die allgemeine Aufregung: „Nu is Schluß mit dem Dreck!“ Er ruft in die Küche: „Tünnes! Setz ’n jroßen Kessel Wasser auf. Wir eröffnen eine Entlausungsanstalt.“
Gegen die Trägheit des einen oder anderen setzt ein hektischer Betrieb ein: Wasser wird angeschleppt, Kleidungsstücke fliegen durch die Gegend, manchmal ‚versehentlich‘ jemandem um die Ohren, der ärgerliche Anlaß der Aufregung wird mit munteren Reden zu einer allgemeinen Gaudi.
„He! Behalt deine Bienen für dich! Du Läusemutterschiff.“
„Verzeihung, Gnädigste!“
„Ich werde das mal auf einen Haufen schmeißen, zum Verbrennen.“
„Du hast sie wohl nicht mehr alle beisammen, du Filzkopp. Jib die Jacke her! Die brauch’ ick für die nächste Modenschau.“
„Oh, ich dachte, du bist Mannequin für Bademoden.“
„Du doch auch – in der Entlausungsanstalt.“
Der allgemeine Anfall von Reinlichkeit und Ordnungssinn treibt Emil Lehmbäcker in die Kammer, in der Bodo Schmude eine speckige Matratze als Bett dient. „Mann, das stinkt ja hier wie drei beschissene Offizierslatrinen!“ tönt es aus dem Kabuff. „Ich hab’ immer gedacht, das Klosett nebenan stinkt so, aber neechen, dat sind Bodos Schätze!“
Schmudes Lager ist umgeben von allerlei Gerümpel, das man im Dunklen kaum identifizieren kann. Emil schleudert es mit spitzen Fingern ans Licht: Teile eines Bettgestells, ein zerlumptes Kissen, mehrere Nachttöpfe, ein Bidet mit geplatztem Email, ein gigantischer BH aus rosa Spitze, ein alter Korb, leere Flaschen, Wollsocken, denen die Fersen fehlen, und andere Kostbarkeiten mehr.
Viele Hände befördern den Kram geräuschvoll und in weitem Schwung hinaus auf einen großen Haufen. Hugo bemüht sich, das eine oder andere zu retten, wird aber von Max und Schmelzer daran gehindert.
Emil bewertet die Funde: „Sammelst du für die Weltausstellung oder wem willst du Konkurrenz machen?“
Skroszny hat sich auf seine Pritsche verzogen und will seine Ruhe haben: „Macht bloß nicht solchen Aufriß. Dat is’ doch unjemütlich ...“
Dann fällt ein Schein von Tageslicht aus der Kammer, und Emil schreit verwundert auf: „Mannchen! Hier ist ja sojar ein Fensterchen!“ Ein alte Badewanne hatte anscheinend das Fenster verdeckt und Emil kantet sie jetzt mühevoll durch die Kammertür: „Ich jlaube, das Kammerchen müssen wir ausschwefeln ...“
Die Sonne lacht, die Luft ist warm, das allgemeine Waschen und Reinemachen breitet sich um das Haus herum aus als ein Akt der Befreiung von Tristesse und Gammelei, von ‚laisser faire‘ und ‚laissez aller‘. Man wäscht Körper und Seele. Man kocht Wäsche, flickt Kleidung, schrubbt Dielen und bessert die faustgroßen Löcher aus, durch die man bis in den Keller schauen kann. Auch vom Hang vor dem Haus wird das Gerümpel beiseite geschafft und auf dem Hof auf einen Haufen gekippt. Am Hang wird ein kleiner Sitzplatz planiert und aus rohen Brettern werden ein Tisch und zwei Bänke zusammengenagelt.
Dorfbewohner schauen von der Straße aus verwundert auf das eifrige Treiben herab, die Männer lassen sich dadurch nicht stören.
Bodo Schmude ist bis auf eine Turnhose entblößt, sein Körper ist von Pickeln und Stichen übersät, Emil und Schmelzer schrubben den Protestierenden ab. Schmude strampelt: „Ick kann mir alleene waschen!“ Emil geht von den nackten Tatsachen aus: „Offenbar kannste nich.“
Sigi politisiert den hygienischen Mißstand: „Der reinste Auschwitz-Körper.“
Max versteht nicht, wovon die Rede ist: „Was heißt ‚Auschwitz-Körper‘?“
Sigi erläutert: „Der sieht aus wie ’n KZler.“
Max ist ehrlich nicht im Bilde: „Wieso? Waren die alle so dreckig?“
Tünnes betrachtet verwundert Max, als ob er von einem anderen Stern käme: „Mann! Die waren halb verhungert und sahen aus wie der Tod auf Latschen! Die hat man geprügelt und geschunden, bevor sie in die Gaskammer kamen und umgebracht wurden wie die Ratten! Das Tausendjährige Reich ist schon ein halbes Jahr im Eimer, und du hast noch nicht begriffen, was sich da abgespielt hat?“
Max ist es peinlich, daß er so wenig weiß: „In Norwegen haben sie uns davon nichts erzählt.“
Tanne wäscht sein Unterhemd und schaut resignierend durch die Löcher: „Zu viele haben Dreck am Stecken. Aber es kommt alles ans Tageslicht!“
Wie die Wellen nach einem Steinwurf ins Wasser breitet sich jetzt eine Diskussion über die KZ der Nazis aus. Sie wird aber nicht leidenschaftlich geführt, eher beiläufig, nahezu uninteressiert. Und sie erlischt so leicht, wie sie aufgeflammt ist. Man bespricht das Thema nur widerwillig.
Sigi hat seine eigene Wahrheit: „Ihr erzählt doch bloß Greuelmärchen!“
Auch Skroszny wäscht jetzt sein Hemd: „Von wejen Greuelmärchen! Ich habe Dachau gesehen. Die Häftlinge sind geprügelt worden, Männer, Frauen, Kinder. Die Aufseher haben sie totjeschlagen oder abjeschossen! Sie haben sie auf jede denkbare Art umjebracht. Und die übrijen wurden vergast. Juden, Kommunisten, Sozialdemokraten, Zigeuner!“
Sigi bleibt stur: „Zigeuner, Schwule, Zuhälter! Alles Schwindel. Arbeiten mußte die faule Bande. Einmal im Leben richtig malochen, das ist alles!“
Solche Sturheit macht Skroszny wütend: „Wo warst du denn, wenn du es besser weißt? Hast du vielleicht so ’n Lager bewacht?“
Sigi ist erschrocken: „Wie kommst du darauf? Ich glaube bloß nicht, was ich nicht selber gesehen habe. Und der deutsche Soldat hat sich anständig benommen! Vielleicht bei der WaffenSS das eine oder andere ...“
Emil meckert ein böses Lachen: „Da warste wohl nie bei, wenn wir in Rußland ein Dorf angezündet haben?“
Sigi verteidigt sich zunehmend hektisch: „Die Russen haben unsere Frauen vergewaltigt!“
Skroszny nickt: „Ja. Und wie ich in St-Laurent in ein Haus gehe, weil ich Geschrei höre, sind drei ‚anständige deutsche Soldaten‘ dabei, einer Französin einen reinzudrehen. Wie nennste denn das, du Schlauberger?“
Sigi murmelt noch irgend etwas und wendet sich ab, weil man ihm nicht zuhören will.
*
Der Abend wird mild. Man sitzt auf den neu gebauten Bänken, trinkt ‚un canon‘, einen kleinen Roten, dreht sich aus den letzten Tabakkrümeln eine Zigarette und spinnt Strategien für ein süßes Leben, Pläne für die Zukunft.
„Heimat, deine Sterne ...!“
Das Ganze spielt wie auf einem Theater zwischen Haus und Straße, mit dem Unterschied, daß der Zuschauerraum hier höher liegt als die Bühne. Ein Mädchenlachen läßt die Männer aufschauen. Auf der Straße amüsieren sich die jugendlichen Dorfschönen über die Kahlköpfe und ihre Männerwirtschaft.
Die Männer grinsen und winken: „Hallo!“, „Bonjour“, „Ça va?“
Max ist das peinlich, aber Bodo Schmude stellt sich in Positur und ruft hinauf: „He, Mademoiselle! Bonjour. Wulleh wuh promeneh?“ Er wirft Handküsse hinauf: „Wulleh wuh beseh?“
Bodos Französisch ist dünn. Er weiß nicht – ebensowenig wie Max –, daß im Französischen das Wort ‚baiser – küssen‘, so direkt gebraucht, immer die letzte Konsequenz der Liebe meint, den Beischlaf, und eigentlich nicht ausgesprochen werden darf. Die Mädchen werden denn auch rot, hören auf zu lachen und laufen davon.
Bodo bemerkt nicht, daß er ins Fettnäpfchen getreten ist, und erklärt großspurig: „Sehta? Man muß nur ranjehn.“
Aus der Tür der großen Stube kommt jetzt Robert mit einem Eimer voll Steine, an dem Gottlieb weinerlich-wütend herumzerrt: „Meine Steinsammlung! Nicht doch! Die habe ich gerade geordnet.“ Robert kippt die Ladung ungerührt auf den Hang: „Steck sie dir meinetwegen in den Hintern! Aber breite sie nicht auf meinem Bett aus.“
Gottlieb klaubt einige Steine wieder zusammen und wendet sich Hilfe heischend an Max, der am nächsten steht: „Sieh mal, Max, meine schöne Sammlung!“ Er zeigt ihm einzelne Steine: „Das hier ist Rotstein. Siehst du die schöne Farbe? Und hier – Blaustein. Wie der Mond am Tage. Alles ganz blau und silbern. Er ist am schönsten, wenn er naß ist.“ Gottlieb denkt gerne in poetischen Bildern, und Max nimmt ihn ein bißchen auf den Arm: „Wann ist denn der Mond naß, Gottlieb?“ Gottlieb wird keine Spur verlegen, sondern erläutert: „Wenn ihn die Wolkenschwämme waschen. Hast du noch nie gesehen?“
Sigi reibt sich gerne an Schwächeren: „Ist das nicht Silberstein?“
Gottlieb nimmt die Frotzelei ernst: „Oh nein! Silberstein muß ganz silbern sein, höchstens ein bißchen Gold dazwischen ...“
Sigi stichelt weiter: „Silberstein, Blaustein – gibt’s auch ’n Itzig-Stein oder ’n Moses-Stein?“
Das versteht Gottlieb nicht: „Wieso?“
Tünnes kann Sigis angeberische Tour nicht leiden, er kann seinen Nazi-Drall nicht leiden, er kann den ganzen Kerl nicht leiden. Tünnes selber ist geradlinig und offen, heitergelassen und strebt nach Gerechtigkeit in dem Bewußtsein, daß sie nur in Bruchstücken existiert. Hier hat er Mitleid mit dem arglosen Gottlieb und versucht, die Lage zu entspannen: „Wir werden mal aufpassen, Gottlieb, ob wir ’n Silberstein für dich finden. Und wenn wir nächstens wieder Käse kriegen, kriste die Schachtel zum Dareintun, damit de den Robert nicht ärjerst. Und“, Tünnes schaut Robert an, „der Robert wird sich nicht so aufpusten, wenn er mal über den Karton stolpert!“
Der Tritt vors Schienbein war nur verbal, aber Robert versteht, daß er durchaus real werden könnte.
Gottlieb sucht schon wieder die schönsten Steine aus dem Haufen zusammen und freut sich: „Ja, das wäre schön. Da wäre ich sehr dankbar!“
Einen Augenblick lang empfindet auch Max das Heil des Narren, der eine unbarmherzige Wirklichkeit einfach nicht zur Kenntnis nimmt. (PK)
Lesen Sie die Fortsetzung des biografischen Romans in der kommenden Ausgabe, oder - bequemer - bestellen Sie das Buch bei edition winterwork
Online-Flyer Nr. 300 vom 04.05.2011
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE
















 Mai 1945 - Der zweite Weltkrieg ist zu Ende. Zu den ziel- und richtungslosen deutschen Soldaten gehört auch Max, siebzehnjähriger Kadett der Deutschen Kriegsmarine, den es nach Norwegen verschlagen hat. Er wird von den Engländern interniert, von den Amerikanern abtransportiert und den Franzosen übergeben. Die stecken ihn in eine Antimonmine in den Cevennen. Dort arbeitet er bis Ende 1947, meist unter Tage. Die Arbeit ist schwer und nicht ungefährlich. Eine gewisse Entschädigung dafür ist das sanfte Mittelmeerklima, seine schöne Vegetation und reiche Fruchtbarkeit. Noch Jahrzehnte später wird er von den sonnigen Felsterrassen über dem Gardon träumen, vom „Garten Frankreichs“, wo er das „Dornröschenschloß“ findet und seine erste Liebe, Marie-Paule.
Mai 1945 - Der zweite Weltkrieg ist zu Ende. Zu den ziel- und richtungslosen deutschen Soldaten gehört auch Max, siebzehnjähriger Kadett der Deutschen Kriegsmarine, den es nach Norwegen verschlagen hat. Er wird von den Engländern interniert, von den Amerikanern abtransportiert und den Franzosen übergeben. Die stecken ihn in eine Antimonmine in den Cevennen. Dort arbeitet er bis Ende 1947, meist unter Tage. Die Arbeit ist schwer und nicht ungefährlich. Eine gewisse Entschädigung dafür ist das sanfte Mittelmeerklima, seine schöne Vegetation und reiche Fruchtbarkeit. Noch Jahrzehnte später wird er von den sonnigen Felsterrassen über dem Gardon träumen, vom „Garten Frankreichs“, wo er das „Dornröschenschloß“ findet und seine erste Liebe, Marie-Paule. Max, Jahrgang 1927, 16jähriger Luftwaffenhelfer, später Kadett der Kriegsmarine auf dem Zerstörer „Hans Lody“, schildert seine Erlebnisse während des Krieges und in französischer Kriegsgefangenschaft. Seine Erinnerungen kreisen um die Arbeit im Bergwerk, um die erste Liebe zu der Französin Marie-Paule, die vergeblichen Fluchten und die endliche Heimkehr in das besetzte Deutschland. Reflexionen über die Sinnlosigkeit und Grausamkeit des Krieges haben angesichts weltweiter kriegerischer Aktivitäten nichts von ihrer Aktualität verloren.
Max, Jahrgang 1927, 16jähriger Luftwaffenhelfer, später Kadett der Kriegsmarine auf dem Zerstörer „Hans Lody“, schildert seine Erlebnisse während des Krieges und in französischer Kriegsgefangenschaft. Seine Erinnerungen kreisen um die Arbeit im Bergwerk, um die erste Liebe zu der Französin Marie-Paule, die vergeblichen Fluchten und die endliche Heimkehr in das besetzte Deutschland. Reflexionen über die Sinnlosigkeit und Grausamkeit des Krieges haben angesichts weltweiter kriegerischer Aktivitäten nichts von ihrer Aktualität verloren.